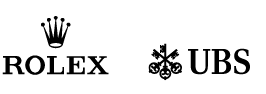Maria Stuarda
Tragedia lirica in zwei Akten von Gaetano Donizetti (1797-1848)
Libretto von Giuseppe Bardari
nach der gleichnamigen Tragödie von Friedrich Schiller
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 40 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 05 Min.
Einführungsmatinee am 25 Mrz 2018.
Mit freundlicher Unterstützung der Kühne-Stiftung
Vergangene Termine
April 2018
Mai 2018
Gut zu wissen
Maria Stuarda
Kurzgefasst
Maria Stuarda
In Gaetano Donizettis Oper Maria Stuarda gibt es eine Szene von singulärem Rang im Belcanto Repertoire des 19. Jahrhunderts: Königin Elisabeth I. und ihre Rivalin Maria Stuart stehen sich gegenüber und schleudern sich Vorwürfe und hasserfüllte Beleidigungen ins Gesicht. Historisch hat es diese Szene wohl nie gegeben. Die Konfrontation der schottischen und der englischen Königin ist ein Geniestreich aus der Feder von Friedrich Schiller. Gaetano Donizetti hat das hitzige Duell der Königinnen zum Herzstück seiner Oper gemacht – und damit einen seiner bühnenwirksamsten Momente überhaupt geschaffen. Donizettis Librettist hat Schillers Tragödie radikal vereinfacht: Maria Stuart ist seit Jahren im Schloss Fotheringhay gefangen. Aus Angst vor ihren Ansprüchen auf den englischen Königsthron hat Elisabeth I. sie dort einsperren lassen. Bei der Begegnung der beiden Königinnen eskalieren die Rivalitäten, und Elisabeth fasst den Entschluss, Maria töten zu lassen. Als der Graf von Leicester um Gnade für die schottische Königin bittet, glaubt sich Elisabeth von dem Mann, den sie selber liebt, verraten und ordnet Marias Hinrichtung an. Maria Stuarda ist ein schauriges und hochemotionales Historiendrama, ganz nach dem Geschmack der italienischen Romantiker. Doch der Erfolg wollte sich nicht einstellen: König Ferdinand II. verbot die Aufführung der politisch zu anrüchigen Erstfassung, und als die Uraufführung 1835 schliesslich an der Mailänder Scala stattfand, trat die berühmte Maria Malibran mit heiserer Stimme auf die Bühne. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts fand die Oper ihren festen Platz im Repertoire und wurde zum Bravourstück für die beiden Königinnen.
Wir sind sicher, eine dem hohen Rang der Partien angemessene Besetzung gefunden zu haben: Keine Geringere als die Starsopranistin Diana Damrau singt die Titelpartie. Die italienische Sopranistin Serena Farnocchia, die am Opernhaus Zürich zuletzt u.a. als Madama Cortese (Il viaggio a Reims) und Alice Ford (Falstaff) zu erleben war, steht ihr als Elisabeth I. gegenüber. Pavol Breslik gibt den Grafen von Leicester. Mit David Alden inszeniert einer der erfahrensten Vertreter seiner Zunft zum ersten Mal am Opernhaus Zürich.
Gespräch

Frau Damrau, eine Partie, für die Sie weltweit gefeiert wurden, ist Mozarts Königin der Nacht. Als Donizettis Maria Stuarda debütieren Sie nun wieder in einer königlichen Rolle. Mögen Sie es, mächtige Frauen auf der Bühne zu verkörpern?
In der Zwischenzeit habe ich mit Marguerite de Valois in Meyerbeers Les Huguenots sogar noch eine weitere Königin gesungen. Bisher zwar nur konzertant. Das szenische Debüt ist aber in Paris geplant. Ich mag es schon sehr, vornehme und kraftvolle Frauenrollen zu spielen! Mozarts Königin der Nacht sehe ich da allerdings eher als ein Zwitterwesen: sie hat ja auch magische und dämonische Kräfte. Bei Maria Stuart fasziniert mich dagegen der Ge-danke, dass diese Figur historisch ist, dass es sie wirklich gegeben hat. Und trotzdem liegt eigentlich nichts auf der Hand. Es ranken sich so viele Mythen und Legenden um diese Frau, dass man als Interpretin zunächst viele Fragen hat. Wenn man diese Oper von Donizetti aufführt, die ja auch nur einen Teil der historischen Wahrheit abbildet, muss man als erstes sehen, was uns da eigentlich vom Komponisten überliefert wurde. Seine Musik ist für mich die wichtigste Grundlage für die Interpretation, die wir in den Proben gerade zu finden versuchen.
Aber auch für Donizetti war die Figur aus dem 16. Jahrhundert bereits ein Mythos. Im Gegensatz zu ihrer kühl abwägenden Kontrahentin Elisabeth I. wird Maria Stuart gerne als leidenschaftliche, impulsive, unüberlegte Frau gesehen, die ihre weiblichen Reize als Waffe einsetzte. Können Sie diesem gängigen Bild etwas abgewinnen?
Ich möchte sie keinesfalls auf diese Deutung reduzieren! Maria Stuart ist für mich eine Figur mit vielen Facetten, was natürlich mit ihrem extremen Schicksal zu tun hat. Es ist auffällig, dass die Partie musikalisch neben intensiven, kraftvollen Ausbrüchen immer auch sehr verinnerlichte, ruhige Momente umfasst. Diese Unterschiede möchte ich gerne zeigen. Maria Stuart wurde als junges Mädchen nach Frankreich gebracht und mit Franz II. verheiratet, der für kurze Zeit König von Frankreich war. Die vornehmen Sitten am französischen Hof haben sie sehr geprägt. Ich glaube, von dort rührt ihre Leidenschaftlichkeit her, ihre Liebe zum Schönen, aber auch die edle, vornehme Haltung, die sie als Frau begehrenswert machte. Ich empfinde es als einen speziellen Moment, wenn sie sich in Donizettis Oper, also während der Jahre ihrer Gefangenschaft in England, nach Frankreich zurücksehnt. Es fühlt sich für mich immer so an, als wäre es nicht nur eine Sehnsucht nach vergangenen Zeiten, sondern gleichzeitig bereits eine Todessehnsucht.
In Schottland, wohin Maria Stuart nach dem frühen Tod ihres ersten Mannes, des Königs von Frankreich, zurückkehrte, wehte ein anderer Wind …
Schottland war im Vergleich zu den französischen Gepflogenheiten natürlich harsches Gebiet. Und es erstaunt eigentlich nicht, dass eine schöne junge Frau mit erlesenen Sitten in dieser rohen Umgebung von machthungrigen Männern mit politischen und religiösen Interessen einen schweren Stand hatte. Wenn eine Monarchin in dieser Zeit von Männern umworben wurde, dann ging es ja nicht nur um körperliche, sondern immer auch um politische Interessen. Ein Unschuldslamm war Maria Stuart aber sicher nicht! Sie war wohl an der Ermordung ihres zweiten Mannes beteiligt und hat auch während der Gefangenschaft noch versucht, ihre Macht spielen zu lassen. Die treibenden Kräfte waren dabei aber stets ihr tiefer katholischer Glaube und der – berechtigte! – Anspruch auf die englische Krone. Es ist ein komplexer Charakter. Wie viel man von diesen psychologischen Details in die Interpretation einbringen kann, ist aber eine andere Frage. Im Zentrum der Oper steht ja die explosive Begegnung zwischen Maria Stuart und der englischen Königin Elisabeth, die es in Wahrheit nie gegeben hat. Man muss da sowieso abstrahieren …
Könnte man sogar sagen, dass die historischen Fakten für diese Oper eher zweitrangig sind? Diente der Stoff Donizetti vielleicht eher als Vorwand, ein wirkungsvolles Stück für zwei sich zankende Diven auf die Bühne zu bringen?
Natürlich ist das Stück auf Wirkung ausgelegt! Diese Szene der Konfrontation ist der Wahnsinn: Da stehen zwei Tigerinnen, zwei Schlachtschiffe … Und dann kommt es zur Eskalation! So eine Begegnung zwischen zwei Sopranistinnen gibt es ja in der Operngeschichte sonst kaum. Serena Farnocchia, die Sängerin der Elisabeth, und ich haben zusammen bereits Donna Anna und Donna Elvira in Don Giovanni gesungen, und jetzt stehen wir uns als rasende Königinnen gegenüber … Das ist eine Situation, die unglaublich Spass macht, und man stachelt sich gegenseitig an. Ich habe gehört, dass Edita Gruberova und Agnes Baltsa in einer Vorstellung sogar die Rollen getauscht haben … Diese Szene ist eine Plattform für ganz grosses Theater!
Sie sind eine Sängerin, die sich auf der Bühne sichtlich wohl fühlt. Haben Sie beim Einstudieren einer Partie bereits Ideen für die szenische Umsetzung im Kopf? Oder entwickeln Sie die erst in der Arbeit mit dem Regisseur?
Das ist eine spannende Frage, gerade weil ich so eine historische Königinnenfigur noch nie gespielt habe. Es gibt ja im Theater den schönen Spruch: «Den König spielen immer die Anderen», und da ist schon etwas dran. Natürlich schaue ich als Vorbereitung Filme oder Theaterstücke. Aber im Detail weiss keiner von uns, wie sich Königinnen im 16. Jahrhundert aufgeführt haben. Natürlich kann man steif durch die Gegend laufen, stolz gucken und eine elegante Handbewegung machen … Aber wenn man einfach nur hinblickt und alle liegen flach wie Pizza auf dem Boden, dann hat das eine andere Wirkung! Wenn man eine Königin spielt, ist man schon sehr darauf angewiesen, was um einen herum geschieht. Auf die erste Zusammenarbeit mit David Alden habe ich mich gefereut. Es gefällt mir, dass er sich von den historischen Tatsachen inspirieren lässt und sich trotzdem ein eigenes Elisabethanisches Zeitalter schafft. Eine historische Kostüm- und Requisitenschlacht brauche ich nicht. Ein Schlüsselerlebnis war für mich in dieser Hinsicht die Traviata- Inszenierung von Willy Decker in Salzburg. Nachdem ich mir diese Partie früher immer nur ganz klassisch vorstellen konnte, habe ich dort gemerkt, dass in einer schlüssig modernisierten Inszenierung vieles noch deutlicher herauskommen kann.
Neben der Violetta haben Sie im Lauf Ihrer Karriere auch sehr unterschiedliche Partien von Donizetti gesungen: In Zürich zuletzt Adina in L’elisir d’amore und natürlich überall immer wieder Lucia di Lammermoor. Ist Maria Stuarda im Vergleich dazu eine Partie, die ein bisschen mehr ins dramatische Fach führt?
Auf jeden Fall! Wie alt ist Maria Stuarda geworden? Vierundvierzig? Das istendlich einmal eine Rolle in meinem Alter! Nach den ganzen jungen Mädchen und flotten Fegern finde ich es jetzt schon toll, eine Frau in einer Machtposition zu spielen. Ich hasse es allerdings, wenn mich jemand fragt: Wie ist es denn, Opferrollen zu spielen? Frauen wie Maria Stuart sind keine Opfer. Sie sind nicht schwach. Sie sind Opfer ihrer Zeit! Und Lucia di Lammermoor wird auch noch Opfer einer Krankheit und dazu zwangsverheiratet. Aber sie kämpft bis aufs Blut um ihre Liebe und um ihre Freiheit. Das sind zwar alles historische Stoffe, aber auch Dinge, die in unserer Zeit noch passieren. Wenn ich darüber nachdenke, finde ich schon, dass viele Opernkomponisten der Emanzipation ein bisschen geholfen haben. Was beispielsweise Marie in Donizettis Fille du régiment für eine Plattform kriegt, und wie sie sich durchsetzen kann … Das finde ich grossartig!
Mit Marie sprechen Sie eine weitere Donizetti-Partie an, die, anders als Maria Stuarda, ins komische Fach gehört. Persönlich machen Sie stets einen fröhlichen und humorvollen Eindruck. Fällt es Ihnen auch auf der Bühne leichter, komische Charaktere zu verkörpern?
Ich liebe und brauche beides. Ohne Komödie kann ich nicht leben. Letztes Jahr habe ich als Contessa im Figaro debütiert. Und auch Rosina im Barbiere oder Adèle im Comte Ory sind Rollen, die ich sehr geliebt habe. Gerade Ensemblestücke, in denen es rasant zu und her geht, machen mir unglaublich viel Freude! Und jetzt kommt halt eine Zeit, in der es etwas ernster wird …
Das ist aber keine generelle Richtung?
Überhaupt nicht. Aufhören werde ich sowieso irgendwann mit der Hexe aus Hänsel und Gretel. Die ist zwar nicht lustig, aber ich glaube, ich würde unglaublich viel Spass mit dieser Partie haben. Ich liebe es einfach, mich in jede neue Rolle hineinzuversetzen und herauszuholen, was geht. Deshalb nennt man mich wohl immer wieder ein «Bühnentier»…
Die Partie der Maria Stuarda singen Sie hier zum ersten Mal. Wie bereiten Sie sich auf ein Rollendebüt vor?
Das Besondere am Belcanto ist, dass alles von der Stimme ausgeht. Natürlich muss man rechtzeitig Noten und Text lernen. Aber die endgültige Wahrheit oder die richtige Interpretation steht da nicht drin. Wir arbeiten hier in Zürich mit der neuen kritischen Ausgabe der Partitur. Und alle diese verschiedenen Fassungen sind entstanden, weil das Werk an verschiedenen Orten und mit unterschiedlichen Sängern aufgeführt wurde. Maria Stuarda kann auch von einem Mezzosopran gesungen werden, wie bei der Mailänder Uraufführung von Maria Malibran. Im Belcanto stellt jeder Sänger die Vorzüge der eigenen Stimme heraus, es geht um Können, aber auch um persönlichen Geschmack. Dazu kommt, dass die Ausgestaltung der Gesangslinien stark mit dem verknüpft ist, was man szenisch zum Ausdruck bringen möchte. Koloraturen dürfen im Belcanto nicht zum Selbstzweck werden. Gerade durch die Wahl der Gestaltung legt man fest, wie aggressiv, wütend oder verinnerlicht man eine bestimmte Passage rüberbringen möchte. Der wichtigste Teil der Erarbeitung einer Partie geschieht also auf den Proben, in Zusammenarbeit mit dem Dirigenten und dem Regisseur.
Ihr Mann, Nicolas Testé, singt in dieser Produktion den Giorgio Talbot, der Maria Stuarda vor ihrer Hinrichtung heimlich die Beichte abnimmt; Ihre beiden 5- und 7-jährigen Söhne sind auch in Zürich. Ist es nicht eine riesige Herausforderung, eine so grosse Karriere und ein glückliches Familienleben unter einen Hut zu bringen?
Es ist in unserem Beruf schon schwierig, sich gut zu organisieren, gerade weil wir sehr viel unterwegs sind. Aber glücklicherweise ist mein Mann diese Situation durch seine eigene Karriere auch gewöhnt. Ohne Kompromisse geht es natürlich nicht. Es ist jetzt gerade die Zeit, in der die Kinder viel Aufmerksamkeit brauchen, aber auch die Zeit zum Singen! Grosses Glück haben wir mit der Schule der Kinder: Das zentralistischorganisierte Lycée français, das sie besuchen, hält sich strikt an den Lehrplan. Deshalb ist es möglich, die Kinder an verschiedenen Orten zur Schule gehen zu lassen und ihnen trotzdem eine kontinuierliche Bildung zu ermöglichen. Gerade freuen sie sich, in Zürich Schulkollegen von früher wiederzufinden. Und Zürich soll ja in Zukunft unsere Basis werden.
Warum Zürich?
Es ist einfach strategisch wunderbar gelegen. Meine Eltern sind von Bayern aus schnell hier und wir haben hier ein wunderbares Opernhaus mit Repertoirebetrieb …
... und wir die Hoffnung, dass Sie dann öfter bei uns auftreten!
Wir arbeiten dran!
Welche Partien haben Sie im Kopf, wenn Sie etwas längerfristig in die Zukunft denken? Werden weitere Rollen von Verdi oder sogar solche von Wagner für Sie ein Thema?
Das könnte vielleicht einmal ein Thema werden. Aber vorher würde ich die Strauss-Partien etwas ausweiten und im französisch-lyrischen Fach etwas weitergehen. Elettra in Idomeneo würde ich gerne einmal singen. Aber grundsätzlich werde ich meinen Kernmöglichkeiten im lyrischen und Koloraturfach treu bleiben. Wenn man mit einer Partie wie Maria Stuarda – im wahrsten Sinne des Wortes – etwas Blut geleckt hat, dann will man natürlich schon gerne wissen, wie sich eine Anna Bolena anfühlt! Oder Elisabetta in Roberto Devereux … Das sind Partien, die ich sehr liebe und die ich mir für die Zukunft wünsche. Aber gerade jetzt, wo die Kinder klein sind und die Familie einen wichtigen Stellenwert für mich hat, will ich keine zu grossen und kraftraubenden Schritte in ungewisses Neuland wagen.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 57, März 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Gespräch
Das Weibliche und das Politische
Die Ranküne um Macht und Liebe der Königinnen Maria Stuart und Elisabeth I. steht im Zentrum von Gaetano Donizettis Oper «Maria Stuarda». Wer waren die beiden Frauen und wie hat sich der Blick auf sie im Laufe der Jahrhunderte verändert? Ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen.
Frau Bronfen, Maria Stuart ist eine berühmte schottische Königin des 16. Jahrhunderts. Als Politikerin war sie aber nicht von grosser Bedeutung. Warum ist ihr Schicksal heute trotzdem so bekannt?
Entscheidend zum Ruhm von Maria Stuart beigetragen hat sicher das Drama von Friedrich Schiller, das um 1800 entstanden ist. Dass sich einer der angesehensten Dichter der deutschen Klassik für Maria Stuart interessierte und sie als eine Figur der Freiheit, also als selbstbestimmtes Subjekt verstand, das sich gegen Tyrannei und politische Machenschaften auflehnt, ist in dieser Hinsicht ganz wesentlich. Ausgehend von diesem Drama setzte im 19. Jahrhundert ein Interesse an Maria Stuart ein, das sich in zahlreichen Romanen, Theaterstücken, Opern und im 20. Jahrhundert schliesslich in Kino- und Fernsehfilmen niederschlug. Auch die Oper von Gaetano Donizetti basiert auf dem Drama von Schiller und gehört in diese Reihe. Einen weiteren Grund für Maria Stuarts Bekanntheit sehe ich aber auch darin, dass sie seit Schiller immer als Kontrahentin der englischen Königin Elisabeth I. dargestellt wird, die politisch eine sehr bedeutende Figur war. Schiller hat die direkte Konfrontation der beiden Regentinnen, die in Wirklichkeit nie stattgefunden hat, erfunden und sie zum Höhepunkt seines Trauerspiels gemacht.
Maria Stuart und Elisabeth I. waren miteinander verwandt und hatten aufgrund komplexer Abstammungsverhältnisse beide Ansprüche auf den englischen Thron. In der genannten dramatischen Konfrontation beleidigt Maria ihre Kontrahentin schwer und fordert dadurch ihr eigenes Todesurteil heraus …
Der Konflikt dieser beiden Königinnen hat in politisch und religiös sehr unsicheren Zeiten stattgefunden. Es herrschte damals auf der britischen Halbinsel ein ständiger Kampf über die Vorherrschaft des katholischen oder des protestantischen Glaubens, in dem Maria als Katholikin und Elisabeth als Protestantin jeweils eine starke Position einnahmen. Aufgrund der politischen Wirren und Machenschaften wurde die Regentschaft Elisabeths nie richtig legitimiert. Ihre Furcht vor Maria Stuarts Ansprüchen war also berechtigt. Indem Elisabeth das Todesurteil über Maria Stuart verhängte, festigte sie ihre eigene Macht. Sie war sich aber auch bewusst, dass sie durch diese Entscheidung ihren eigenen Kopf riskierte. Eine Königin öffentlich hinrichten zu lassen, war ein ungeheurer Akt. Aus diesem Grund zögerte sie das Urteil jahrelang hinaus und bevorzugte es, Maria Stuart gefangen zu halten.
Hängt das negative Bild, das Elisabeth in den späteren Erzählungen, also auch in der Oper von Donizetti, anhaftet, wesentlich mit diesem Konflikt zusammen?
Zu ihrer Zeit war Elisabeth zwar eine umstrittene, aber auch eine schillernde Figur. Schon im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts wurde das Bild, das man von ihr hatte, aber zunehmend schlechter. In England wurde sie als «virgin queen» immer mehr zu einer lächerlichen Figur gemacht. Aber auch aus künstlerischer Sicht verlor man das Interesse an dieser kühl kalkulierenden, angeblich unfruchtbaren Staatsmännin, die nichts für die romantischen und melodramatischen Fantasien hergab. Diese Entwicklung erreichte ihren Höhepunkt im 19. Jahrhundert, in dem man sich besonders für die Figur Maria Stuarts interessierte: Maria Stuart wurde zur «Königin der Herzen» stilisiert, deren Schicksal den Stoff für leidenschaftliche Erzählungen lieferte, während daneben das Bild von Elisabeth als das einer machthungrigen, intriganten und schrägen Regentin verblasste. Elisabeths Ansehen wurde dann erst im 20. Jahrhundert rehabilitiert.
Inwiefern?
Trotz ihren korrupten politischen Machenschaften war Elisabeth ja eine höchst kluge, mit allen Wassern gewaschene Politikerin, die es in Zusammenarbeit mit ihren Beratern verstanden hat, ein System aufzubauen, das sich inmitten von unüberschaubaren Bürgerkriegen und religiösen Konflikten sehr lange gehalten hat. In den vergangenen Jahrzehnten wurde diese Tatsache plötzlich wieder aktuell. So betonte zum Beispiel der Filmregisseur Shekhar Kapur in seinen beiden Elizabeth-Filmen mit Cate Blanchett in der Titelrolle die Bedeutung Elisabeths als weiblicher Politikerin. Er stellt sich in diesen Filmen die Fragen, was es für eine Frau bedeutet, Politikerin zu sein, oder ob eine Frau dazu fähig ist, ein Heer anzuführen. Im Zusammenhang mit Thatcher-England oder Merkel-Deutschland ist das wieder brisant geworden. Gleichzeitig rückte damit das Interesse an Maria Stuart in den Hintergrund. Ich glaube, wir interessieren uns in Europa unterdessen weniger für die Liebesaffären und Romanzen eines Einzelsubjekts als vielmehr für die Möglichkeiten und Schwierigkeiten, die eine Frau hat, wenn sie in eine politische Machtfunktion kommt.
Dass sich die Sicht auf beide Königinnen im Lauf der Zeit verändert, zeigt, dass wir eigentlich nicht von historischen Personen, sondern von zwei grossen Mythen sprechen, an denen unsere Kultur kontinuierlich bastelt …
Es sind zwei sehr unterschiedliche Mythen. Elisabeth ist für den Satz berühmt geworden, sie habe zwar den schwachen Körper einer Frau, aber das Herz eines Königs – also eines Mannes. Zu den ersten, die Elisabeth zu Beginn des 20. Jahrhunderts wieder «entdeckten», gehört Virginia Woolf, die sich besonders für diesen androgynen Aspekt interessierte. Der Mythos von Elisabeth lässt nicht zu, dass man sie auf ihr Frausein reduziert. Das hängt auch damit zusammen, dass sie sich als eine der ersten politischen Diven in Szene setzte und dadurch ihre öffentliche Stellung als Herrscherin halten konnte. Sie wusste, wie man aus Politik Theater macht! Damit verglichen, ist der Mythos von Maria Stuart völlig unpolitisch. Sie hat nicht als Politikerin für den Katholizismus gekämpft wie beispielsweise die als «Bloody Mary» bekannte Maria Tudor. Maria Stuart ist die «Königin der Herzen»: Weiblichkeit, Emotionen, Liebesabenteuer, versuchte und vereitelte Flucht, Hin- und Hergerissen-Sein, Aufopferung … Das sind die Bereiche, von denen ihr Mythos erzählt. Im Fokus steht also immer ihr persönliches Schicksal.
Könnte der Mythos von Maria Stuart denn ein anderer sein, wenn er von anderen Autoren bearbeitet worden wäre?
Wer weiss, wer Maria Stuart wirklich war … Die Historiker haben sich mit ihrer Geschichte natürlich kritischer befasst. Man muss grundsätzlich davon ausgehen, dass sie Teil dieses unglaublich komplizierten Machtgefüges im 16. Jahrhundert gewesen ist. Alle mussten ihre Legitimität in dieser Zeit durch Gewalt durchsetzen, und ich kann mir vorstellen, dass Maria Stuart dabei genau so intrigant gewesen ist wie Elisabeth. Natürlich wäre es viel interessanter, sie im Sinne von Shakespeares Lady Macbeth oder anderen machtsüchtigen Königinnen zu sehen. Es drängt sich also die Frage auf, warum das nicht so geschehen ist? Dass sich Schiller oder Donizetti für Maria Stuart interessierten, beweist ja auch, dass diese sehr gut in ein bestimmtes Frauenbild hineinpasst: Es ist das Bild einer Kultur, die gerne leidende, sich aufopfernde und tote Frauen mag. Der Tod verleiht Maria Stuart ihre Erhabenheit. Als Leiche kann sie in das Pantheon der leidenden, grossartigen, verkannten, missbrauchten und geopferten politischen Figuren eingehen.
Stefan Zweig, der mit seinem Essay über Maria Stuart zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der gleichen Tradition weiterdachte, schreibt: Maria Stuart sei «in erster und letzter Linie Frau» gewesen …
Die Begeisterung für Maria Stuart ist eigentlich Ausdruck einer kulturellen Angst gegenüber weiblichen Herrscherinnen. Wenn man, wie Stefan Zweig es tut, behauptet, eine Herrscherin sei ja eigentlich nur Frau gewesen, dann muss man sich nicht mit ihrem Herrscherinnentum auseinandersetzen. Das ist bei Maria Stuart möglich, aber bei Elisabeth nie möglich gewesen.
Ist es denn sinnvoll, den Mythos von Maria Stuart stets weiterzuerzählen und dieses Frauenbild dadurch geradezu zu zementieren?
In diesem Fall wäre ich mit einer Dekonstruktion des Mythos glücklicher als damit, ihn weiter zu verfestigen! Ich stehe noch immer unter Schock, dass Hillary Clinton nicht als amerikanische Präsidentin gewählt wurde, bin aber fest davon überzeugt, dass wir kulturell nicht darauf vorbereitet waren. Das ist auch nicht erstaunlich, wenn man verfolgt, wie Frauen in Machtpositionen im amerikanischen Mainstreamfilm und Fernsehen dargestellt werden. Im Gegensatz zu einem schwarzen Präsidenten, für den es vor der Wahl von Barack Obama zahlreiche Beispiele im Kino gegeben hatte, können sich viele Amerikaner eine gute weibliche Regentin noch immer nicht vorstellen. In Europa ist die Situation etwas anders, weil es hier die Tradition der Aristokratie gab. Man tendiert dazu, zu vergessen, dass Königinnen im Mittelalter etwas Normales waren. Für die Aristokratie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit waren persönliche Emotionen völlig unwichtig; entscheidend war die symbolische Position, die man eingenommen hat. Wenn Schiller oder Zweig Maria Stuart in erster Linie als Frau sehen, dann ist das also eine sehr bürgerliche Sicht auf die Aristokratie.
Das heisst, wir müssten bürgerliche Sichtweisen über Bord werfen, wenn wir heute über Frauen in Machtpositionen nachdenken wollen?
Aufschlussreich finde ich die Denkfigur des deutschen Historikers Ernst Kantorowicz: In seiner Studie Die zwei Körper des Königs geht er von einem natürlichen und einem symbolischen Körper des Königs aus: Entscheidend ist für den König (oder die Königin) der symbolische Körper, der von verschiedenen natürlichen Körpern besetzt werden kann, aber immer weiterlebt. Im Mittelalter oder der Frühen Neuzeit wurde man also in erster Linie König oder Königin, das Geschlecht war ein untergeordneter – natürlicher – Aspekt. Mit ihren bürgerlichen Vorstellungen rüttelten Stücke wie Schillers Maria Stuart an dieser Idee, und der natürliche Körper rückte in den Vordergrund. Das funktioniert im Fall von Frauen natürlich wesentlich leichter …
… weil die grossen Erzählungen dieser Zeit von Männern geschrieben wurden …
… und weil man bei Männern von öffentlichen Figuren ausgeht, während man bei Frauen bis vor nicht allzu langer Zeit von häuslichen Figuren ausgegangen ist. Virginia Woolf musste sich in ihrem Essay Ein Zimmer für sich allein noch 1929 unglaublich dafür stark machen, dass Frauen überhaupt in der Öffentlichkeit arbeiten, Bibliotheken besuchen, oder Professorinnen werden dürfen. Daran zeigt sich, wie hartnäckig sich die Vorstellung der Frau als einer romantischen und häuslichen Figur gehalten hat. Im Gegensatz dazu hat man sich bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts nie sonderlich für die Emotionen der Männer interessiert. Die Männer waren immer die Denker, Verkäufer, Entdecker oder eben Könige – also immer als Ausübende ihrer Arbeit entscheidend. Auch deshalb ist es so viel leichter, eine Königin auf ihre Weiblichkeit zu reduzieren.
Emotionen spielen in der Oper eine grosse Rolle. Im Vergleich zu Schillers analytischem Drama ist Donizettis Maria Stuarda als wirkungsvolle Dreiecksgeschichte für zwei Soprandiven und einen lyrischen Tenor eingerichtet. Ist die kritische Auseinandersetzung mit einem überkommenen Frauenbild in diesem Fall überhaupt möglich?
Zwei Soprane auf einer Bühne … Wie soll denn das gehen? Die Rivalität, die in dem Stoff angelegt ist, wird natürlich geradezu potenziert, indem auf der Opernbühne zwei Diven gegeneinander ausgespielt werden. Da geht es ja zusätzlich um die Frage, wer höher, virtuoser und schöner singen kann! Und dank dem Tenor, auf den sich die Begierde der beiden Frauen richtet, wird bei Donizetti eher die Eifersucht als die Politik zur treibenden Kraft der Handlung. Das bedeutet aber, dass hier beide Frauen, Maria Stuart und Elisabeth, auf ihre persönliche Fehde reduziert werden – und zwei Frauen, die sich in ihrem Geltungsdrang gegenseitig zerfleischen, sind für die Männer ja wieder eine beruhigende Vorstellung …
… und bieten ein lustvolles Theatererlebnis. Sollen wir uns also auch in Zukunft daran erfreuen, Frauenbild hin- oder her?
Eine kritische Einstellung des Rezipienten wäre schon wünschenswert. Wir müssen den Mythos um Maria Stuart nicht verwerfen, aber wir sollten daran arbeiten und hinterfragen, warum man diese Geschichte so schreibt und nicht anders. Es geht also darum, zu verstehen, warum dieser Mythos so gut funktioniert! Und dieses Verständnis hilft uns vielleicht bei unserem heutigen Auftrag weiter, uns eine schillernde Palette von Frauen vorstellen zu können, die in der Öffentlichkeit als Politikerinnen existieren können.
Das Gespräch führte Fabio Dietsche.
Elisabeth Bronfen ist Professorin für Anglistik an der Universität Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 57, März 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Sound-Übertragung von nebenan

Bühne hier, Orchester da. So spielen wir.
Unser Orchester und Chor werden derzeit aus einem externen Proberaum live in die Vorstellungen eingespielt. Dank diesem weltweit einzigartigen Spielmodell heisst es trotz Abstandsregeln: Vorhang auf für grosses Musiktheater! Erfahren Sie, wie unsere «Sound-Übertragung von nebenan» funktioniert und wie Sie mit Ihrer Spende in Ihren Musikgenuss investieren können. mehr
Essay

Donizettis Opern sind klar strukturiert, eingängig und auf grosse dramatische Wirkung ausgelegt. Für mich zählt er zu den begabtesten Komponisten theatralischer Situationen. Rossini, der die Form der italienischen Oper zu Beginn des 19. Jahrhunderts prägte, hat fantastische Kunstwerke geschaffen; aber sie stellen Regisseure vor riesige Herausforderungen! Damit verglichen, sind Donizettis formale und musikalische Muster manchmal etwas vorhersehbar, aber gerade in dieser Einfachheit sehr wirkungsvoll! Auch Maria Stuarda ist auf den ersten Blick eine Oper mit einer simplen – aber besonderen – Figurenkonstellation: Es geht um zwei rivalisierende Soprane, die Königinnen Elisabeth von England und Maria von Schottland, zwischen denen ein junger umworbener Tenor, der Earl of Leicester, steht. Aber ich finde, dass sich viel komplexere Charaktere hinter den vordergründig einfachen Strukturen verbergen, als man zunächst denkt.
In Schillers Drama, auf dem die Handlung der Oper basiert, haben die beiden Königinnen ungefähr gleich viel Gewicht. Bei Donizetti verschiebt sich dieses Gleichgewicht zugunsten von Maria Stuarda. Das hat damit zu tun, dass die Oper im 19. Jahrhundert in einem streng katholischen Land entstanden ist. Bei Donizetti liegen die Sympathien deutlich auf der Seite der schottischen Königin, die für den katholischen Glauben kämpft und als Märtyrerin stirbt. Während Maria als leidende, empfindsame und leidenschaftliche Frau gezeichnet ist, werden Elisabeth in Donizettis Oper kaltherzige, mächtige und intrigante Züge verliehen. So wollte man die Protestantin damals in Italien sehen.
In meiner Inszenierung möchte ich die beiden Frauen aber nicht so eindimensional zeigen. Interessant finde ich, dass beide Frauen geradezu gegen ihre eigenen Charakterzüge ankämpfen. Das zeigt sich deutlich in ihren jeweiligen Szenen mit dem Earl of Leicester, für den sie beide etwas empfinden: Maria versucht ihm gegenüber genau die «weibliche» Leidenschaftlichkeit zu bekämpfen, die ihr immer zugeschrieben wird. Bei Elisabeth spielt dagegen eine leidenschaftlich empfundene Eifersucht eine grosse Rolle: Elisabeths Entscheidung, Maria Stuarts Todesurteil zu unterzeichnen, hängt ja bei Donizetti stark mit dieser Eifersucht zusammen: Sie glaubt, dass Leicester für Maria mehr empfindet als für sie selbst.
Leicester treibt im Kreuzfeuer der beiden Frauen ein sehr gefährliches Spiel, und es ist eher erstaunlich, dass er am Ende seinen Kopf noch hat. Elisabeth spielt mit ihm und versucht ihn zu verführen, im Fall von Maria will uns die Oper dagegen von einer aufrichtigen Liebe überzeugen … Ich bin mir aber nicht sicher, ob Maria ihn letztlich nicht auch nur benutzen will, um aus ihrer ausweglosen Lage herauszufinden. Immerhin weiss man aus der Geschichte, dass Maria Stuarts zweiter Mann unter mysteriösen Umständen ermordet wurde. Ich glaube schon, dass auch sie eine kompromiss- und skrupellose Seite hatte.
Auffällig finde ich, dass die beiden Frauen trotz oder gerade wegen ihrer Machtspiele am Ende die starken Figuren sind, während sich Leicester von ihnen manipulieren lässt. Das erinnert mich manchmal ein wenig an die Opernstoffe von Leoš Janáček, in denen immer die Frauen die stärkeren sind. In diesem Punkt finde ich Donizettis Oper auch aus heutiger Sicht interessant. Zwar glaube ich nicht, dass sie uns etwas über die politischen Umstände unserer Zeit erzählen kann, aber immerhin ist es ein Stück über mächtige Frauen und die Tatsache, wie wir als Männer mit ihnen umgehen müssen. Es zeigt, was die Geschichte aus mächtigen Frauen macht: nämlich Märtyrerinnen, falsche Intrigantinnen oder geschlechtslose, beziehungsweise «männliche» Wesen! Es gibt ja sogar die Gerüchte, dass Elisabeth I. in Wahrheit ein Mann war und deshalb Zeit ihres Lebens eine «virgin queen» geblieben ist. Aber ich denke, das ist nur das übliche böse Geschwätz über mächtige Frauen, wie die Männer sie gerne sehen wollen.
In den letzten Spielzeiten habe ich mich besonders viel mit Opern beschäftigt, in denen es um Frauen in Machtpositionen geht, darunter Meyerbeers Les Huguenots oder Rossinis Semiramide. Während ich daran gearbeitet habe, glaubte ich, dass Hillary Clinton die nächste Präsidentin von Amerika werden könnte. Dass sie die Wahl verloren hat, zeigt für mich, dass wir anhand dieser Stoffe gerade heute über solche Fragen nachdenken sollten – auch wenn Donizetti selbst nicht so darüber gedacht hat.
Durch die Gegenüberstellung zweier Frauen von hohem Rang wird in dieser Oper die Selbstdarstellung zu einem grossen Thema. Das ist für die Inszenierung natürlich hochinteressant; und ich sehe darin auch einen Akt, der einen engen Zusammenhang mit dem Politischen hat: Das Leben von Elisabeth I. war eine grosse Inszenierung. Vom Kostüm über die Haltung bis zu ihren Aussagen hat sie jahrelang ein brillantes Schauspiel durchgezogen. Aber auch Maria Stuart hat natürlich selbst zu dem Mythos beigetragen, der sie heute umgibt. Politik ist immer eine Performance, in der es um die Kontrolle des eigenen Images geht.
Realistische politische Vorgänge interessieren mich in meinen Inszenierungen aber immer nur in gewissem Mass, weil ich Oper nicht als realistische Kunstform verstehe: Die Musik fügt der Textebene stets einen Subtext hinzu, der für mich als Regisseur sehr wichtig ist. Die Empfindungen, die die Musik auslöst, können weniger konkret gefast werden, was sie für die Inszenierung umso interessanter macht. Die visuelle Struktur auf der Bühne soll mit der Architektur der Musik korrespondieren. In dieser Hinsicht arbeite ich ähnlich wie ein Choreograf. Das heisst aber nicht, dass die Musik szenisch abgebildet werden muss; oft finde ich auch eine Gegenbewegung dazu oder eine daraus abgeleitete Interpretation. Ich denke, mein Stil speist sich aus einer eigenartigen Mischung von realistischen Vorgängen mit solchen, die aus dem Bereich des Unterbewussten kommen, von symbolischen Bildern, einer Portion Ironie und Sarkasmus und einem zuweilen hysterischen schwarzen Humor. Es ist ein stetiges Auf und Ab zwischen diesen verschiedenen Bereichen, und ich kann diese Überschneidungen nicht konstant kontrollieren. Ich schwanke zwischen verschiedenen Realitäten, wenn ich inszeniere.
Text von David Alden.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 57, März 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay

Während meiner Studienzeit in Mailand habe ich die Anfänge der historischen Aufführungspraxis auf dem Gebiet der «Alten Musik» verfolgt und mich dabei gefragt, wie authentisch die Partituren und Aufnahmen von Donizetti- oder Bellini-Opern eigentlich das abbilden, was diese Komponisten ursprünglich beabsichtigt hatten. Viele Opern dieser Zeit – darunter auch Maria Stuarda – wurden zwischen 1850 und 1950 nie gespielt. In der Zwischenzeit vollzog sich aber eine enorme Entwicklung auf dem Gebiet der italienischen Oper: Werke von Verdi, Puccini oder Mascagni erforderten ganz andere Gesangsstimmen und zunehmend einen grösseren Orchesterapparat. Auf der Basis dieser gewandelten Ästhetik wurden Mitte des 20. Jahrhunderts einige Belcanto-Opern wiederentdeckt und aufgeführt. Meine Lehrer am Konservatorium standen ganz in dieser Tradition, die sie nicht gross hinterfragt haben. Meine Generation ist nun in der glücklichen Lage, mit etwas mehr Abstand einerseits die grossartigen Aufnahmen und Stimmen aus den 1950er-Jahren zu studieren und andererseits auf kritische Editionen zurückzugreifen, die in den letzten Jahren entstanden sind und wichtige Details zur Aufführungspraxis liefern.
Gerade bei Donizettis Maria Stuarda finde ich die kritische Auseinandersetzung wichtig, da diese Oper eine verzwickte Entstehungsgeschichte hat. Donizetti komponierte die Oper 1834 im Auftrag des Teatro San Carlo in Neapel. Das Drama um die schottische Königin Maria Stuart hat er wohl selber vorgeschlagen, und es ist eigentlich erstaunlich, dass er dieses Sujet im katholischen und erzkonservativen Unteritalien, das damals noch ein eigenes Königreich war, überhaupt vertonen durfte! Als die Oper fertig war und bereits die Proben liefen, wurde das Stück von der Zensur verboten: Eine Oper, in der eine katholische Königin zum Tod durch Enthauptung verurteilt wird, wurde vom Königshaus in dieser politisch ohnehin unruhigen Zeit nicht auf der Bühne geduldet. Um die bereits komponierte Musik trotzdem verwenden zu können, musste Donizetti deshalb in kürzester Zeit ein neues Thema finden und einen anderen Text schreiben lassen, den man der Komposition unterlegen konnte. Aus diesem akrobatischen Unternehmen resultierte die Oper Buondelmonte, durch die Donizetti die geplante Aufführung in Neapel retten konnte. Ich finde es aber falsch, wenn man deshalb denkt, Donizetti habe Musik geschrieben, die keinen engen Bezug zum Text hat! Aus Briefen des Komponisten weiss man, dass er mit dieser Situation sehr unglücklich war. Es war eine Notlösung und zudem kein besonderer Erfolg. Die eigentliche Uraufführung der Maria Stuarda konnte erst 1835 an der Mailänder Scala stattfinden, wo die Zensur weniger streng war. Trotz der berühmten Sängerin Maria Malibran in der Titelpartie wurde die Oper aber auch dort kein durchschlagender Erfolg.
Da ich gerade erst I puritani von Bellini dirigiert habe, fallen mir jetzt die Unterschiede zwischen diesen beiden Zeitgenossen besonders auf: Donizetti stammt aus dem norditalienischen Bergamo, einer Gegend, die unter der Herrschaft der Habsburger zu leiden hatte, Bellini hingegen aus Sizilien, das unter dem Einfluss der Bourbonen stand. Der eine war rauer Kälte und Nebel ausgesetzt, der andere von Sonne und Orangenblüten umgeben. Das prägte ihren musikalischen Stil deutlich: Bei Bellini ist jede Aussage von purer Schönheit umgeben. Selbst die blutige Fehde zwischen den Capulets und den Montagues «erstickt» bei ihm in Schönheit. Die Lösungen, die Donizetti findet, sind dagegen viel schroffer. Er wollte das Publikum schockieren und schreckte dabei nicht vor blutigen Kämpfen, rollenden Köpfen oder spektakulären Selbstmorden zurück. Gemeinsam ist beiden die meisterhafte Beherrschung des Belcanto-Kompositionsstils. Unter diesem sehr unterschiedlich verwendeten Begriff verstehe ich eine besondere Kompositionsweise, die den Gesang ins Zentrum stellt, während dem Orchester eher eine «neutrale» Funktion zukommt. Das bedeutet aber nicht, dass Bellini oder Donizetti keine Ahnung von Orchestrierung hatten. Natürlich kannten sie beispielsweise die Sinfonien von Beethoven und wussten, wie differenziert und ausdrucksstark man den Orchesterapparat einsetzen kann. Aber der Belcanto-Stil erfordert eine ganz bewusste Zurücknahme des Orchesters: Der Ausdruck geht in diesen Werken immer vom Gesang aus.
Zudem zeugen gerade Donizettis Opern von einem stark ausgeprägten Bewusstsein für das musikalische und dramaturgische Timing. Die kritische Neuausgabe zeigt, dass Maria Stuarda ursprünglich in zwei, und nicht, wie lange angenommen, in drei Akten konzipiert war. In Bezug auf die Handlung ist das nur logisch: Während der erste Akt kontinuierlich auf den grossen Höhepunkt der Oper, die Konfrontation zwischen den Königinnen Maria und Elisabeth, ausgerichtet ist, steht am Ende des zweiten Akts die Hinrichtung Marias, also wiederum ein ganz entscheidendes Ereignis. Innerhalb dieser grossen Spannungsbögen funktioniert die Belcanto-Oper immer durch den Wechsel zwischen retardierenden und dramatischen Momenten. In den Arien werden die gleichen Texte und gleichen Melodien so oft wiederholt, bis sich beim Hörer eine Vertrautheit einstellt. Ich vergleiche das gerne mit der Popmusik unserer Zeit: Auch Popsongs entfalten ihre Wirkung ja dadurch, dass man sie wiederholt hört und sich mit dem darin vermittelten Gefühl vertraut macht. Wenn bei Donizetti im Rezitativ darauf ein dramatischer Moment folgt, beispielsweise wenn Maria ihre Kontrahentin Elisabeth als Bastard beschimpft, dann wird der Zuhörer aus dem zuvor etablierten Gefühl herausgerissen und die Dramatik erreicht ihre grösste Wirkung. Hierin sehe ich übrigens einen entscheidenden Grund, warum die Belcanto-Opern lange Zeit nicht mehr gespielt wurden: Komponisten wie Puccini oder die Veristen interessierten sich nicht mehr für diese ständigen Wiederholungen. Für sie stand die kontinuierliche Entwicklung der Handlung im Vordergrund, bei ihnen passiert alles im Jetzt. Dass Donizetti nach Momenten grosser dramatischer Spannung gesucht hat, zeigt aber auch die ungewöhnliche Besetzung dieser Oper: Zwei rivalisierende Sopranstimmen, die über sämtliche Männerrollen dominieren, sind schon eine ausserordentliche Besonderheit!
Text von Enrique Mazzola.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 57, März 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
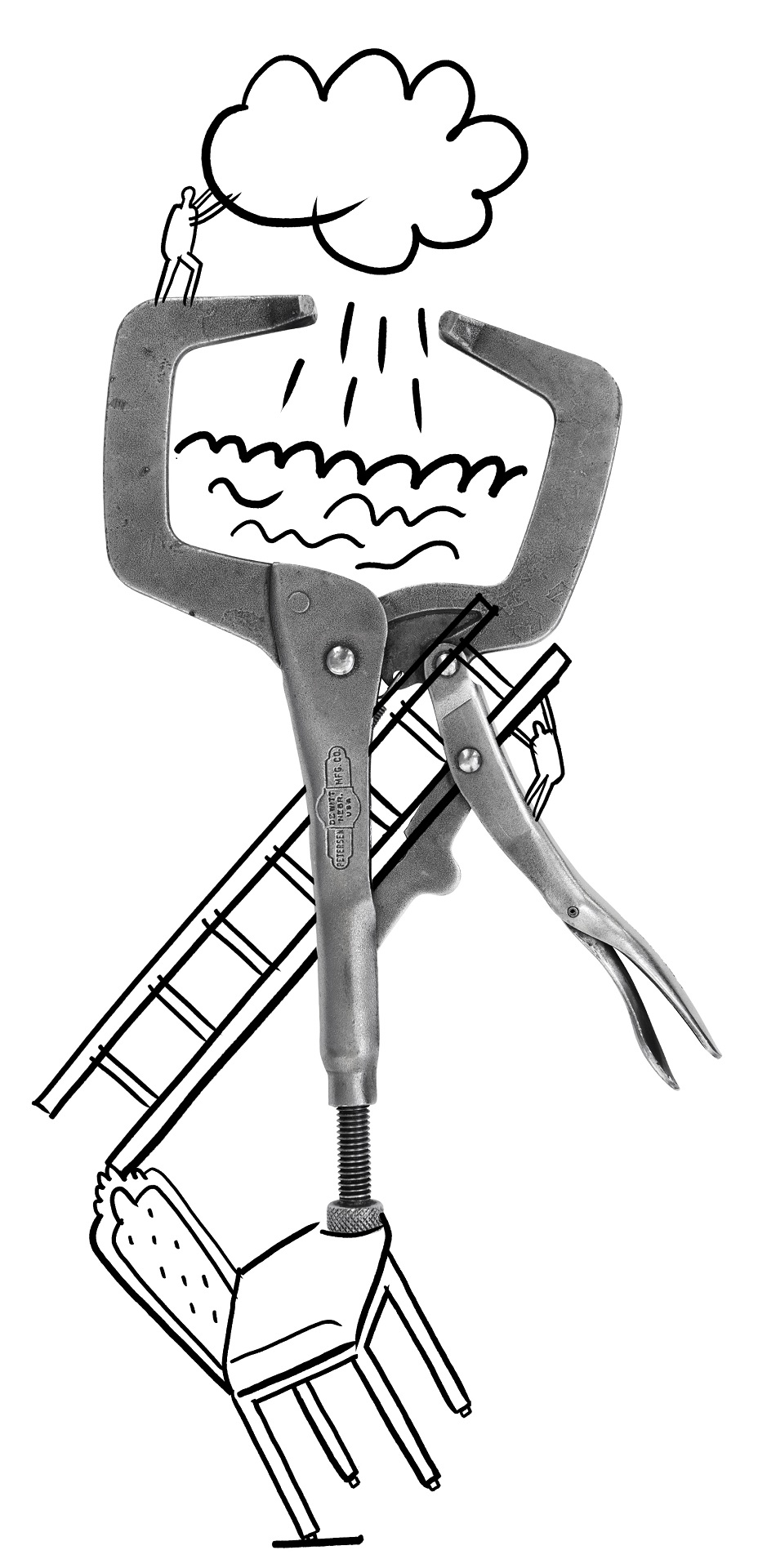
Die Axt muss stecken bleiben
Ein Blick hinter die Kulissen und in die Welt der Bühnentechnik von «Maria Stuarda». Der technische Direktor am Opernhaus Zürich, Sebastian Bogatu, gibt Auskunft über schwungvolle Axtschläge, praktische Holzspiesse und die Herausforderung, unserer Souffleurin kein Härchen zu krümmen.
Manche Wünsche eines Regisseurs scheinen auf den ersten Blick ganz einfach – und stellen dann doch eine viel grössere Herausforderung dar als gedacht. In seiner Inszenierung von Maria Stuarda verlangte David Alden, dass ein Solist eine Axt auf den Souffleurkasten schlägt und diese darin stecken bleibt. Da im Souffleurkasten in diesem Fall unsere liebe Souffleurin Heike sitzt, ist bei dieser Aktion zuerst einmal wichtig, dass ihr dabei kein Härchen gekrümmt wird. Ausserdem ist dafür zu sorgen, dass sich die Verletzungsgefahr, die von einer Axt ausgeht, in Grenzen hält. Das machen wir, indem wir das Blatt der Axt (das ist das scharfe und schwere Stück Metall am Ende des Stiels) nicht aus geschärftem Eisen bauen, sondern aus stumpfem Holz. Und «wir» ist in diesem Fall unser Requisiteur Simon, der die Axt aus Hartholz genauso baut, wie es sich der Bühnenbildner vorstellt: Mit einem langen Stiel, einem sehr breiten Blatt und einer geschwungenen Schneide. Wäre diese aus Eisen, hätte der Solist aufgrund des Gewichts und des entstehenden Schwungs erhebliche Mühe, den Souffleur kasten zu treffen. Und der Kasten würde dabei mit Sicherheit in zwei Teile zerlegt werden, und Heike eventuell auch … Also besser kein Eisen.
Zunächst hatten wir die Idee, eine offene Kiste auf den Souffleurkasten zu montieren und diese mit einem bemalten Styroporklotz zu füllen. Doch bei Schlagversuchen mit der Axt wurde das Styropor nicht zerschnitten, sondern nur zusammengedrückt, und die Axt blieb nicht stecken. Und wenn das Styropor doch mal auseinanderbrach, dann waren die Bruchkanten im Styropor weiss, und das quietschende Geräusch dabei war auch nicht wirklich passend …
Also haben wir die Kiste mit einem dünnen Holzdeckel versehen und versucht, diesen zu spalten. Doch entweder kamen wir mit der Holzaxt nicht durch den Deckel durch, oder der Deckel zerbrach und die Axt blieb nicht stecken, sondern kippte um.
Das Problem war ja auch, dass wir keinen grossen Aufbau auf dem Souffleurkasten machen konnten, da dieser sonst merkwürdig aussieht und die Darstellenden auf der Bühne den Dirigenten nicht mehr sehen könnten. Wir brauchten etwas, in das man einfach hineinschlagen konnte, das die Axt festhalten musste, dabei nach Holz klang und sinnvollerweise wiederverwertbar sein sollte, da der Solist das ja üben musste. Ein vorgefertigter Schlitz im Holz? Wird vom Solisten nicht getroffen, und man sieht ihn die ganze Zeit. Uns drohten diesmal die Ideen auszugehen.
Doch dann hatten wir den Einfall, die Kiste mit stehenden Schaschlikspiessen zu füllen. Das sind 30 cm lange, angespitzte dünne Holzstäbchen, auf die man beim Grillieren Fleisch und Gemüse aufspiesst. Die Idee war, dass die Schneide der Axt von den senkrecht stehenden Holzspitzen so abgelenkt werden sollte, dass das Blatt immer zwischen die Schaschlikspiesse rutschen und dort festklemmen würde.
Die Kiste war mit ca. 50 × 40 cm überschaubar gross – dennoch waren wir erstaunt, dass wir mehr als zwanzigtausend (!) Spiesse zum Füllen benötigten. Dank unserer hauseigenen Gastronomie hatten wir diese bereits in kürzester Zeit organisiert; sie wurden in der Schreinerei auf 10 cm Länge gekürzt und in die Kiste gestellt. Schnell stellten wir fest, dass wir durch die Dichte der Füllung genau festlegen konnten, wie fest die Axt geschlagen werden musste und wie stark diese dann festklemmte. Damit die Oberfläche gut aussah, haben wir die Kiste mit einem schwarzen Papier abgeklebt: Dieses konnte unser Solist mit der Axt gut zerteilen. So muss für jede Vorstellung lediglich ein neues Papier montiert werden – die Spiesse rutschen beim Schlag zur Seite und klemmen die Axt zuverlässig fest. Eigentlich doch ganz einfach.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 58, April 2018
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Maria Stuarda
Synopsis
Maria Stuarda
Maria Stuart wird seit Jahren von der englischen Königin Elisabeth I. gefangen gehalten. Nachdem ihr zweiter Mann, Henry Darnley, unter ungeklärten Umständen ums Leben gekommen war und sie dessen mutmasslichen Mörder Lord Bothwell geheiratet hatte, wurde Maria Stuart als Königin von Schottland abgesetzt. Die Protestantin Elisabeth gewährt der Katholikin Maria seither Exil auf englischem Boden, lässt sie aber streng überwachen. Die beiden Königinnen sind eng miteinander verwandt und Elisabeth fürchtet sich vor Maria Stuarts Ansprüchen auf die englische Krone.
Erster Akt
Elisabeth I. hat einen Heiratsantrag vom König von Frankreich erhalten. Da sie um ihre Unabhängigkeit als Königin fürchtet, zögert sie, diesen anzunehmen.
Giorgio Talbot, der mit Maria Stuarts Überwachung beauftragt ist, bittet um Gnade für sie. Lord Cecil, der Elisabeths Regierung angehört, drängt sie dazu, Maria Stuart hinzurichten.
Der Graf von Leicester erscheint. Elisabeth ist ihm leidenschaftlich zugetan, vermutet aber, dass er nicht sie, sondern Maria Stuart liebt. Sie bittet ihn, dem französischen Gesandten ihren Ring zu bringen als Zeichen dafür, dass sie den Heiratsantrag des Königs annimmt. Leicesters teilnahmslose Reaktion bestätigt ihre Vermutung und verärgert sie.
Talbot überbringt Leicester einen Brief von Maria Stuart. Die Erinnerung an sie befeuert Leicesters Leidenschaft und stärkt seinen Wunsch, sie zu befreien.
Elisabeth bemerkt Leicesters innere Unruhe und stellt ihn zur Rede. Leicester bittet Elisabeth um Gnade für Maria Stuart. Er überredet sie dazu, die schottische Königin zu treffen und sich persönlich von deren Unschuld zu überzeugen. Elisabeth wird von Eifersucht geplagt, gewährt Leicester jedoch seinen Wunsch. Maria Stuart darf mit ihrer Vertrauten, Anna Kennedy, einen Moment ausserhalb der Gefängnismauern verbringen. Sie erinnert sich an ihre glückliche Kindheit in Frankreich.
Eine Jagdgesellschaft nähert sich. Leicester erscheint und kündigt die Königin Elisabeth an. Er bittet Maria, sich demütig zu verhalten.
Die beiden Königinnen stehen sich gegenüber. Maria fällt vor Elisabeth auf die Knie und bittet um Gnade. Elisabeth rast innerlich vor Eifersucht. Als Leicester sich offenkundig für Maria einsetzt, beschimpft Elisabeth Maria als Mörderin und Verbrecherin. Daraufhin spricht Maria Elisabeth das legitime Recht auf den englischen Thron ab und beschimpft sie als Bastardin. Elisabeth prophezeit Maria ein grausames Schicksal und lässt sie abführen.
Zweiter Akt
Cecil drängt die zögernde Elisabeth, Maria Stuart zum Tod zu verurteilen. Elisabeth befürchtet, dass der Mord an einer Königin auf sie zurückfallen wird. Als Leicester sich erneut für die Begnadigung Marias einsetzt, unterschreibt sie jedoch das Todesurteil. Von Leicester verlangt sie, der Hinrichtung beizuwohnen.
Cecil überbringt Maria Stuart das Todesurteil. Gegenüber Talbot, der sich als katholischer Priester zu erkennen gibt, gesteht Maria, an der Ermordung ihres früheren Mannes beteiligt gewesen zu sein. Sie streitet jedoch ab, eine Verschwörung gegen Elisabeth geplant zu haben. Talbot vergibt Maria ihre Sünden. Sie ist in ihrem Glauben gestärkt.
Im Kreis ihrer Vertrauten betet Maria Stuart vor der Hinrichtung zu Gott. Sie wünscht, dass Anna sie zur Hinrichtung begleiten darf. Sie vergibt Elisabeth und bittet Cecil, ihr das mitzuteilen. Nachdem sie sich vom verzweifelten Leicester verabschiedet hat, geht Maria würdevoll ihrer Hinrichtung entgegen.
Biografien

Enrique Mazzola, Musikalische Leitung
Enrique Mazzola
Enrique Mazzola ist seit 2019/20 Generalmusikdirektor der Lyric Opera of Chicago sowie Erster ständiger Gastdirigent an der Deutschen Oper Berlin. Von 2012 bis 2019 war er Musikdirektor des Orchestre National d’Île-de-France. 2018 wurde er in Frankreich zum «Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres» ernannt. Wichtige Engagements der jüngeren Zeit führten ihn u.a. zu den Salzburger Festspielen (Orphée aux enfers), an die Wiener Staatsoper (Don Pasquale), an die Metropolitan Opera (La Fille du régiment), ans Opernhaus Zürich (Don Pasquale, Maria Stuarda, Il turco in Italia, Il barbiere di Siviglia, I Puritani), zu den Bregenzer Festspielen (Rigoletto, Mosè in Egitto) und zum Glyndebourne Festival (Luisa Miller, Il barbiere di Siviglia) sowie zu Konzerten mit dem Orchestre Nationale du Capitole de Toulouse, dem Philharmonia Orchestra, dem Royal Scottish National Orchestra, dem Orchestra of the Age of Englightenment und dem Oslo Philharmonic. Ausserdem dirigierte er beim Rossini Opera Festival, am Moskauer Bolschoitheater, beim Maggio Musicale Fiorentino, an der Scala di Milano, am New National Theatre in Tokio, beim Festival d’Aix-en-Provence, beim Wexford Opera Festival, an der Opéra du Rhin und bei den Münchner Opernfestspielen. Die Spielzeit 2021/22 führte ihn für Macbeth und L’elisir d’amore nach Chicago, für I vespri siciliani an die Deutschen Oper Berlin, für Anna Bolena nach Zürich und Amsterdam, für Madama Butterfly zu den Bregenzer Festspielen und für eine Operngala mit Renée Fleming in die Royal Festival Hall London.

David Alden, Inszenierung
David Alden
David Alden zählt zu den erfolgreichsten Regisseuren der Gegenwart. Für seine Arbeiten wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der «South Bank Show Award» für seine Inszenierung von Brittens Peter Grimes sowie der «Olivier Award» für seine Inszenierung von Janáčeks Jenůfa, beide an der English National Opera. Seine langjährige Zusammenarbeit mit der Bayerischen Staatsoper wurde mit dem «Bayerischen Theaterpreis» ausgezeichnet. Bedeutende Produktionen an der Bayerischen Staatsoper waren Ariodante, La forza del destino, Il ritorno d’Ulisse in patria, Pique Dame, Lulu, La donna del lago, Tannhäuser sowie Der Ring des Nibelungen. Zusammen mit seinem Bruder Christopher Alden inszenierte er halbszenische Vorstellungen der drei Mozart/Da Ponte-Opern mit dem Chicago Symphony Orchestra unter Daniel Barenboim. Seine Arbeit führte ihn u.a. an die New Yorker Met, die Lyric Opera of Chicago, die Komische Oper Berlin, die Volksoper Wien, die English National Opera, die New Israeli Opera in Tel Aviv, das Teatro Real Madrid sowie an die Opernhäuser von Dallas, Köln, Frankfurt und Graz. Jüngst inszenierte er Lohengrin am Royal Opera House Covent Garden in London, Les Huguenots an der Deutschen Oper Berlin, Billy Budd am Bolschoitheater Moskau, Semiramide in München und Catalanis Loreley für die St. Galler Festspiele. Seine Produktionen von Thomas Adès Powder her Face für das Aldeburgh Festival, Ariodante für die English National Opera sowie Rodelinda, Rinaldo und Tannhäuser für die Bayerische Staatsoper sind auf DVD erhältlich. In Zürich inszenierte er zuletzt Maria Stuarda und Anna Bolena.

Gideon Davey, Bühnenbild und Kostüme
Gideon Davey
Gideon Davey, geboren in Bristol, ist Kostüm- und Bühnenbildner für Theater, Film und Fernsehen. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Regisseuren David Alden und Robert Carsen. Zudem wirkte er u.a. in Produktionsteams von Andreas Homoki, Jetske Mijnssen, Floris Visser, Stephen Lawless und Jasmina Hadziahmetovic mit. Seine Kostüme für David Aldens Inszenierung von Il ritorno d’Ulisse in patria an der Staatsoper in München brachten ihm die Auszeichnung «Kostümbildner des Jahres 2005» der Zeitschrift Opernwelt ein. Zu seinen Arbeiten gehören Wozzeck, Agrippina und Platée am Theater an der Wien mit Robert Carsen, Luisa Miller an der Staatsoper Hamburg mit Andreas Homoki, Semele bei den Händel-Festspielen Karlsruhe mit Floris Visser, Alfredo Catalanis Loreley am Theater St. Gallen und Pique Dame an der English National Opera mit David Alden sowie Luigi Rossis Orfeo an der Opéra national de Lorraine mit Jetske Mijnssen. Am Opernhaus Zürich entwarf er bisher das Kostüm- bzw. Bühnenbild für Das Gespenst von Canterville, Robin Hood, Der Zauberer von Oz, Idomeneo, Arabella, Hippolyte et Aricie, Maria Stuarda, Hänsel und Gretel, Anna Bolena, Dialogues des Carmélites und Roberto Devereux. Er schuf die Kostüme für Aldens Lohengrin am Royal Opera House London, Bühne und Kostüme für Carsens Giulio Cesare an der Scala in Mailand und 2021 Bühne und Kostüme für Il trionfo del Tempo e del Disinganno bei den Salzburger Festspielen. Jüngst war er an der Mailänder Scala für Peter Grimes, an der Deutschen Oper Berlin für Anna Bolena, an der Oper Halle für Il barbiere di Siviglia sowie an der Oper Köln für Idomeneo engagiert.

Martin Gebhardt, Lichtgestaltung
Martin Gebhardt
Martin Gebhardt war Lichtgestalter und Beleuchtungsmeister bei John Neumeiers Hamburg Ballett. Ab 2002 arbeitete er mit Heinz Spoerli und dem Ballett Zürich zusammen. Ballettproduktionen der beiden Compagnien führten ihn an renommierte Theater in Europa, Asien und Amerika. Am Opernhaus Zürich schuf er das Lichtdesign für Inszenierungen von Jürgen Flimm, Grischa Asagaroff, Matthias Hartmann, David Pountney, Moshe Leiser/Patrice Caurier, Damiano Michieletto und Achim Freyer. Bei den Salzburger Festspielen kreierte er die Lichtgestaltung für La bohème und eine Neufassung von Spoerlis Der Tod und das Mädchen. Seit der Spielzeit 2012/13 ist Martin Gebhardt Leiter der Beleuchtung am Opernhaus Zürich. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn heute mit dem Choreografen Christian Spuck (u. a. Winterreise, Nussknacker und Mausekönig, Messa da Requiem, Anna Karenina, Woyzeck, Der Sandmann, Leonce und Lena, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, Dornröschen). Er war ausserdem Lichtdesigner für die Choreografen Edward Clug (u.a. Strings, Le Sacre du printemps und Faust in Zürich; Petruschka am Moskauer Bolschoitheater), Alexei Ratmansky, Wayne McGregor, Marco Goecke und Douglas Lee. Mit Christoph Marthaler und Anna Viebrock arbeitete er beim Händel-Abend Sale, Rossinis Il viaggio a Reims und Glucks Orfeo ed Euridice in Zürich sowie bei Lulu an der Hamburgischen Staatsoper. 2020 gestaltete er das Licht an der Oper Genf für Les Huguenots in der Regie von Jossi Wieler und Sergio Morabito. 2021 folgte Christian Spucks Orlando am Moskauer Bolschoitheater und 2022 Don Giovanni am New National Theatre Toyko.

Fabio Dietsche, Dramaturgie
Fabio Dietsche
Fabio Dietsche studierte Dramaturgie an der Zürcher Hochschule der Künste sowie Querflöte bei Maria Goldschmidt in Zürich und bei Karl-Heinz Schütz in Wien. Erste Erfahrungen als Dramaturg sammelte er 2012/13 bei Xavier Zuber am Konzert Theater Bern, wo er u.a. Matthias Rebstocks Inszenierung von neither (Beckett/Feldman) in der Berner Reithalle begleitete. Seit 2013 ist er Dramaturg am Opernhaus Zürich, wo er sein Studium mit der Produktionsdramaturgie von Puccinis La bohème abschloss. Hier wirkte er u.a. bei den Uraufführungen von Stefan Wirths Girl with a Pearl Earring und Leonard Evers Odyssee, an der Kammeroper Jakob Lenz von Wolfgang Rihm und an der Schweizerischen Erstaufführung von Manfred Trojahns Orest mit. Er arbeitete u.a. mit Robert Carsen, Tatjana Gürbaca, Rainer Holzapfel, Andreas Homoki, Ted Huffman, Mélanie Huber, Barrie Kosky, Hans Neuenfels und Kai Anne Schuhmacher zusammen. Zurzeit studiert er berufsbegleitend Kulturmanagement an der Universität Zürich.

Serena Farnocchia, Elisabetta I., Königin von England
Serena Farnocchia
Serena Farnocchia stammt aus Italien. Sie war Preisträgerin bei der «Luciano Pavarotti Competition» in Philadelphia und gehörte zum Opernstudio der Mailänder Scala. Unter Riccardo Muti gab sie dort ihr Debüt auf der grossen Bühne als Donna Anna (Don Giovanni). Seither kehrt sie nicht nur regelmässig nach Mailand zurück, sondern ist durch wiederholte Zusammenarbeiten mit Häusern wie der Bayerischen Staatsoper München, dem Opernhaus Zürich, dem Teatro La Fenice, dem New National Theatre Tokyo, der Semperoper Dresden, dem Grand Théâtre de Genève, dem Maggio Musicale in Florenz und der Deutschen Oper am Rhein verbunden. Ausserdem gastierte sie u.a. an der Opera de Lille, dem Teatro San Carlo in Neapel, dem Santa Fe Opera Festival, der Lyric Opera Chicago, der Canadian Opera Company in Toronto, dem Glyndebourne Festival, der San Francisco Opera, der Oper Frankfurt, in Essen, in Israel und an vielen anderen Orten rund um die Welt. Ihr Repertoire umfasst Partien wie Fiordiligi (Così fan tutte), Contessa (Le nozze di Figaro), die Titelpartie in Luisa Miller, Leonora (Il trovatore), Amelia (Simon Boccanegra), Elisabetta (Don Carlo), Desdemona (Otello), Alice Ford (Falstaff), Adalgisa (Norma), Liù (Turandot), Mimì (La bohème) und Micaëla (Carmen). Unlängst sang sie u.a. Elisabetta (Don Carlo) am Verdi-Festival in Parma, Amelia in München, Cio-Cio San (Madama Butterfly) in Hamburg und Venedig, Mimì in St. Gallen sowie Aida an der Oper in Rom und am Grand-Théâtre de Genève. Am Opernhaus Zürich war sie zuletzt als Alice Ford, Madama Cortese (Il viaggio a Reims), in Messa da Requiem sowie als Elisabetta I (Maria Stuarda) zu hören.

Diana Damrau, Maria Stuarda, Königin von Schottland
Diana Damrau
Diana Damrau ist ständiger Gast auf den Bühnen der international führenden Opern- und Konzerthäuser. Ihr umfangreiches Repertoire liegt im lyrischen und Koloraturfach und beinhaltet u. a. die Titelrollen in Donizettis Lucia di Lammermoor, Massenets Manon sowie die Königin der Nacht in Mozarts Zauberflöte. Regelmässig ist sie an den bedeutendsten Häusern wie etwa der Bayerischen Staatsoper, der Metropolitan Opera in New York und der Mailänder Scala zu erleben. Speziell für sie komponiert wurden die Iain Bells Oper A Harlot’s Progress (Theater an der Wien, 2013) und Lorin Maazels 1984 (Royal Opera House, 2005). Als Exklusivkünstlerin von Warner Classics/Erato hat sie zahlreiche preisgekrönte CD- und DVD-Aufnahmen veröffentlicht. Diana Damrau ist eine der wichtigsten Liedinterpretinnen unserer Zeit. Sie tritt regelmässig in renommierten Konzertsälen wie der Londoner Wigmore Hall, der Carnegie Hall in New York und der Berliner Philharmonie auf. Enge künstlerische Partnerschaften verbinden sie mit dem Pianisten Helmut Deutsch und dem Harfenisten Xavier de Maistre. 2022 wird sie in den wichtigsten Konzertsälen Europas zusammen mit Jonas Kaufmann und Helmut Deutsch ein Programm mit Liebesliedern von Brahms und Schumann präsentieren. Auf der Opernbühne singt sie in dieser Saison noch Anna Bolena an der Wiener Staatsoper und gibt ihr Rollendebüt als Gräfin in Strauss’ Capriccio an der Bayerischen Staatsoper. Diana Damrau ist Kammersängerin der Bayerischen Staatsoper, Trägerin des Bayerischen Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst sowie des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik Deutschland.

Pavol Breslik, Roberto, Graf von Leicester
Pavol Breslik
Der slowakische Tenor Pavol Breslik war von 2003 bis 2006 an der Berliner Staatsoper engagiert und wurde 2005 von der Fachzeitschrift Opernwelt zum «Nachwuchssänger des Jahres» gekürt. Seit 2006 ist er regelmässiger Gast an den grossen europäischen Opernhäusern. An der Wiener Staatsoper sang er Lenski (Eugen Onegin), Nemorino (L’elisir d’amore), Don Ottavio (Don Giovanni) und Alfredo (La traviata), und an der Bayerischen Staatsoper gab er zwei wichtige Rollendebüts: Gennaro (Lucrezia Borgia) an der Seite von Edita Gruberova und Edgardo (Lucia di Lammermoor) mit Diana Damrau. Am Royal Opera House Covent Garden war er als Lenski sowie als Ferrando (Così fan tutte), Don Ottavio und Tamino (Die Zauberflöte) zu hören. Ausserdem gastierte er an der Pariser Oper, dem Liceu Barcelona, dem Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel, der Berliner Staatsoper, den Salzburger Festspielen, dem Aix Festival, dem Theater an der Wien, der Semperoper Dresden und dem Grand Théâtre Genf. Von 2012 bis 2018 war Pavol Breslik Ensemblemitglied am Opernhaus Zürich, wo er u.a. Števa (Jenůfa), Don Ottavio, Nadir (Les pêcheurs de perles), Peter Quint (The Turn of the Screw) und Leicester (Maria Stuarda) sang. Jüngst debütierte er mit grossem Erfolg in der Rolle des Prinzen (Rusalka) am Nationaltheater Prag. 2021 wurde ihm der Ehrentitel «Bayerischer Kammersänger» verliehen.

Nicolas Testé, Giorgio Talbot
Nicolas Testé
Der französische Bass-Bariton Nicolas Testé studierte an der Opéra National de Paris und im Centre de Formation Lyrique in Paris. 1998 gewann er den zweiten Platz beim “Voix Nouvelles”-Wettbewerb. Er gastiert regelmässig auf internationalen Bühnen, u.a. an der Metropolitan Opera New York, der Staatsoper München, der Los Angeles Opera, der Deutschen Oper Berlin, der Opéra National de Paris, am Teatro San Carlo in Neapel, dem Grand Théâtre de Gènéve, am Teatro La Fenice in Venedig, am Theater an der Wien sowie beim Glyndebourne Festival und bei den Chorégies d’Orange. Konzertant war er u.a. im Festspielhaus Baden-Baden, in der Elbphilharmonie Hamburg, der Semperoper Dresden, der Philharmonie München, im Teatro Colón in Buenos Aires, der Shanghai Symphony Hall und in der Suntory Hall in Tokio zu erleben. In der Spielzeit 2017/18 war er als Raimondo (Lucia di Lammermoor) an der Bayerischen Staatsoper München, als Basilio (Il barbiere di Siviglia) an der Opéra Bastille in Paris, als Giorgio Talbot (Maria Stuarda) in Zürich, als Méphistophélès (Faust) und als Alvise Badoero (La Gioconda von Ponchielli) an der Deutschen Oper Berlin zu Gast. Die Spielzeit 2018/19 führte ihn an die Opéra Bastille als Marcel in Les Huguenots, an die Met New York als Nourabad in Les Pêcheurs de perles, ans Théâtre des Champs-Elysées Paris als Hérode in L’enfance du Christ und als Claudius in Thomas’ Hamlet ans Gran Teatre del Liceu Barcelona. Zuletzt war er im Februar 2020 als Frère Laurent in Roméo et Juliette an der Scala in Mailand zu erleben.

Andrzej Filonczyk, Lord Guglielmo Cecil
Andrzej Filonczyk
Andrzej Filonczyk, Bariton, stammt aus Polen. Er erhielt ab seinem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht. Ab 2014 studierte er Gesang an der Opernakademie der Polnischen Nationaloper in Warschau. Er feierte Erfolge bei mehreren nationalen und internationalen Wettbewerben. So gewann er etwa den ersten Preis und weitere Auszeichnungen beim Internationalen Bohuslav Martinů-Wettbewerb 2014 in Prag sowie den ersten Preis beim Internationalen Stanisław Moniuszko-Wettbewerb 2016 in Warschau. Sein Operndebüt gab er als Tonio (Pagliacci) an der Oper «Stanisław Moniuszko» in Poznań und wurde dafür mit dem Preis für das Debüt des Jahres ausgezeichnet. Am selben Haus sang er 2016 erstmals die Titelrolle in Eugen Onegin. Auf dem Konzertpodium war er u.a. als Solist in Faurés Requiem an der Oper Warschau zu hören. Als Teilnehmer des Young Singers Project bei den Salzburger Festspielen sang er 2016 den Diener in Thaïs. Ebenfalls 2016 sang er Schaunard (La bohème) am Teatro Lirico di Cagliari. In der Spielzeit 2016/17 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und war hier u.a. als Mathias/Wirt (Der feurige Engel), Figaro (Il barbiere di Siviglia) sowie in Don Carlo zu hören. Bei den Salzburger Festspielen 2017 sang er Gubetta in Lucrezia Borgia. 2017/18 kehrte Andrzej Filonczyk als Figaro nach Zürich zurück, war in Don Carlos an der Pariser Opéra zu erleben und sang Silvio in Pagliacci am Royal Opera House Covent Garden in London; als Silvio war er in der Spielzeit 2016/17 bereits am Teatro Regio di Turino zu hören. Geplant sind u.a. Marcello in La bohème mit der Canadian Opera Company und in Klagenfurt sowie Figaro und Schaunard (La bohème) in Paris.

Hamida Kristoffersen, Anna Kennedy
Hamida Kristoffersen
Hamida Kristoffersen stammt aus Norwegen. Sie absolvierte ihre Gesangsausbildung an der Universität Tromsø, besuchte Meisterkurse bei Kiri Te Kanawa, Brigitte Fassbaender, Barbara Hendricks sowie Enza Ferrari und nimmt seit 2013 regelmässig Unterricht bei Patricia McGaffrey in New York. Ausgezeichnet wurde sie u.a. mit dem «Premio Verdi 2013» und einem Ingrid Bjoner-Stipendium bei der «Queen Sonja Competition». Sie war als Mimì (La bohème) und als Contessa (Le nozze di Figaro) mit der Arctic Opera und dem Arctic Philharmonic Orchestra zu erleben. Ausserdem sang sie 2014 Konzerte mit dem Norwegian Radio Orchestra und dem Oslo Philharmonic Orchestra. In der Spielzeit 2014/15 wurde Hamida Kristoffersen Mitglied im Internationalen Opernstudio in Zürich und war hier u.a. als Pamina (Die Zauberflöte), Tamiri (Il re pastore), Giannetta (L’elisir d’amore) und Annina (La traviata) sowie in Die Frau ohne Schatten, Luisa Miller, und Fälle von Oscar Strasnoy zu erleben. 2015 debütierte sie als Micaëla (Carmen) an der Oper Oslo und sang im Sommer 2017 Mimì (La bohème) an der Oper Hedeland in Dänemark. 2016-2019 war sie Ensemblemitglied in Zürich, wo sie u.a. als Dama (Macbeth), Berta (Il barbiere di Siviglia), Erste Dame (Die Zauberflöte), in der Uraufführung von Xavier Dayers Der Traum von Dir, als Blumenmädchen (Parsifal), Anna Kennedy (Maria Stuarda), als La Virtù (L’incoronazione di Poppea), als Gretel und Sandmännchen (Hänsel und Gretel) sowie als Diane (Hippolyte et Aricie) auf der Bühne stand. Dabei arbeitete sie mit DirigentenInnen wie Gianandrea Noseda, Emmanuelle Haïm, Ottavio Dantone, Nello Santi, Laurence Cummings, Enrique Mazzola und Simone Young.