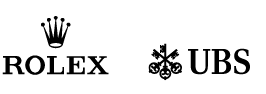L’Olimpiade
Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)
Arien von Giovanni Battista Pergolesi
mit einem Dokumentarfilm von David Marton und Sonja Aufderklamm
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 2 Std. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Pressestimmen
«Man sieht es den Aufnahmen an, wie behutsam und offen all diese Menschen aufeinander zugingen, wie wichtig diese Begegnungen waren.»
Tages-Anzeiger, 13.03.22«The videos gave us the chance of seeing, really seeing a segment of society with hardly any representation in the media or the arts»
bachtrack, 15.03.22
Interview

Neue Ideen in der Stunde Null
Eigentlich wollte der Regisseur David Marton die Oper «L’Olimpiade» von Giovanni Battista Pergolesi inszenieren, ein legendäres Meisterwerk des neapolitanischen Barock. Aber dann kam die Coronakrise, und alles wurde anders: Der Regisseur hat einen Dokumentarfilm über alte Menschen gedreht und in Beziehung zu Pergolesis Arien gesetzt. Das Ergebnis ist ein zutiefst emotionales Bühnenkunstwerk aus Live-Gesang, intimer filmischer Beobachtung und Erzählungen von gelebtem Leben
David, dein Pergolesi-Projekt L’Olimpiade, das am 12. März endlich seine Premiere erlebt, hat eine abenteuerliche Entstehungsgeschichte. Durch die Corona-Pandemie hat es sich künstlerisch völlig verändert. Was genau ist da passiert?
Ursprünglich hatte mich das Opernhaus Zürich engagiert, um die Barockoper L’Olimpiade von Giovanni Battista Pergolesi zu inszenieren. Die Besetzung war engagiert, das Bühnenbild entworfen. Aber dann kam im Januar 2020 die Coronakrise und hat unsere ursprünglichen Pläne völlig über den Haufen geworfen. Wir mussten mitten im ersten, harten Lockdown entscheiden, wie es mit unserem Pergolesi-Projekt weitergeht. Ich war in Budapest, eingesperrt wie fast alle. Die Zeit stand still, und meine künstlerischen Projekte stürzten wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Mir kam es plötzlich absurd vor, alte Inszenierungskonzepte unter strengen Corona-Einschränkungen irgendwie halbgut umzusetzen. Meine Strategie war eher: Lass alle ursprünglichen Pläne fahren und schaue, was passiert. Vielleicht entstehen ja aus dieser Null-Situation neue Ideen, denen ich zu einem anderen Zeitpunkt gar nicht folgen würde.
Und welche Ideen sind dir gekommen?
Ich habe, während ich in meiner Wohnung in Budapest festsass, Bildmaterial im Internet gesucht und es mit Arien von Pergolesi zusammengeschnitten. Der Effekt war faszinierend. Pergolesis Arien sind unglaublich lebendig, kraftvoll, emotional, und sie laden die Bilder mit ihrer Emotionalität auf. Am stärksten ist dieses Phänomen, wenn die Bilder einen Kontrast zur Musik bilden und mit Langsamkeit und Detailbeobachtung operieren.
Du hast mit Nahaufnahmen von Gesichtern experimentiert, wie es einst Ingmar Bergman in seinem berühmten Film Persona getan hat.
Ja, aber mit Ingmar Bergman möchte ich meine Arbeit nicht vergleichen. Persona ist einer der bedeutendsten Filme der Filmgeschichte und Bergman generell berühmt dafür, wie nahe man Menschen mit der Kamera kommen kann. Aber es stimmt, ich habe auch Bergman-Szenen mit Pergolesi-Arien zusammengeschnitten und fand es sehr spannend, wie die Musik kleinste Regungen der Mimik oder das Licht in den Augen plötzlich anders erscheinen lässt und Tiefenschichten des Gesichtsausdrucks offenlegt. Diese Tiefenschichten sind in Bildern von Menschen ja vorhanden. Man muss sie nur herausholen. Man muss sie erblicken.
Die Experimente haben dich auf den Gedanken gebracht, die Pergolesi- Oper als Filmprojekt zu realisieren, da szenische Proben nur mit Abstand und Maske möglich waren.
Den Impuls, szenische Aktion durch Film zu ersetzen, hatten gerade im Schauspielbereich in der damaligen Corona-Situation ja viele. Mir ging es allerdings sehr konkret um die Wechselwirkungen von Bildern und Musik. Dieses Thema treibt mich schon seit Beginn meiner Theaterlaufbahn um: Dass man über die Verwendung von Musik nicht nur im Sinne von Narration nachdenkt. Dass man Bildfolgen und Szenen ähnlich rhythmisieren kann wie Musik. Dass Musik in der Oper nicht immer eine Geschichte transportieren muss, sondern Bilder und Musik auf einer anderen Ebene zusammenkommen und diese sich gegenseitig bespiegeln.
Als du das Opernhaus dann mit dem Wunsch konfrontiert hast, einen Dokumentarfilm über alte Menschen zu drehen und den mit den Pergolesi- Arien zu verbinden, waren wir sehr überrascht, denn der Inhalt der Oper und die alten Menschen haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Ausserdem waren die Altersheime im Sommer und Herbst 2020, als du drehen wolltest, wegen der Infektionsgefahr noch streng abgeschottet.
Ich wollte, dass das Projekt etwas mit der Zeit zu tun hat, in der wir uns befinden. Und die Situation der alten Menschen während der Pandemie hat mich sehr beschäftigt: Wie verletzlich sie sind, wie sie von ihren Angehörigen zwangsweise getrennt wurden, obwohl ihr Leben ja auch schon ohne Corona von grosser Einsamkeit geprägt war. Ich dachte: Ältere Menschen bilden einen wesentlichen Teil des Opern-Publikums, die wegen Corona nun nicht mehr ins Theater gehen können. Wie wäre es daher, wenn wir zu ihnen gingen, ihnen Musik vorspielten und zuhören würden? So ist die Idee entstanden, einen Dokumentarfilm über alte Menschen zu drehen. Ich habe dann spontan die österreichische Filmemacherin und Kamerafrau Sonja Aufderklamm als Partnerin für das Projekt gewinnen können, gemeinsam haben wir den Film dann realisiert. Sonja war genau die richtige für das Vorhaben. Sie hat einen künstlerischen Blick für die Komposition von Filmbildern und ein sensibles Auge für Menschen. Im Sommer, als grenzüberschreitende Reisen wieder möglich waren, sind wir nach Zürich gekommen, haben tatsächlich alte Menschen getroffen, mit ihnen geredet und drei Wochen lang gedreht. Es war ein grosser Glücksfall, dass uns trotz der strengen Schutzmassnahmen die Türen geöffnet wurden – von einem Altersheim in Rümlang in der Nähe des Zürcher Flughafens, aber auch von anderen alten Menschen, die uns in ihre Wohnungen und in ihr Leben gelassen haben.
Was habt ihr bei dieser Dokumentarfilm-Recherche zum Thema gemacht?
Wir haben den Menschen Pergolesi vorgespielt und dann ganz offen geschaut, wohin uns die Musik bei den Gesprächen und den Filmaufnahmen führt. Ich hatte zwar Ideen im Kopf, was ich fragen wollte, aber die Gesprächsthemen ergaben sich fast von selbst.
Haben sie mit dem Inhalt der Oper zu tun? Das L’Olimpiade-Libretto von Metastasio handelt ja, raffiniert verschachtelt, von Menschen, die auf der Suche nach einer selbstbestimmten Existenz sind, die gegen die strengen Gesetze ihrer Väter aufbegehren, die vom Schicksal an fremde Orte versprengt wurden und auf der Suche nach ihrer Familie und ihrer eigenen Identität sind.
Das Libretto und seine Handlung haben wir nicht thematisiert, alleine die Musik war unser Ausgangspunkt. Aber interessant war, dass wir in den Gesprächen doch bei ähnlichen Motiven gelandet sind – strenge Väter, Schicksalsschläge, familiäre Zwänge. Das sind Themen, die einem offenbar am Herzen liegen, wenn man ein langes Leben im Rücken hat. Ich fand die Parallelen zu Motiven des Operninhalts mitunter verblüffend, gerade weil wir sie nicht bewusst angesteuert hatten.
Die Handlung der Oper wird also weder durch die Musik noch durch Film, Bühne und Szene erzählt?
Nein. Wir haben alle Rezitative, in denen in einer Barockoper ja die Handlung transportiert wird, gestrichen. Der Abend besteht musikalisch aus einer Abfolge von Arien und kurzen Gesprächssequenzen anstelle der Rezitative.
Sind Arien nicht immer an ein Handlungsmoment, an eine Situation oder ein szenisches Gegenüber gebunden?
Ich glaube nicht, dass das Erzählen von Geschichten immer die Hauptaufgabe von Oper ist, insbesondere nicht im Barockzeitalter. Emotionen, die in der Musik zum Ausdruck kommen, können von der Handlung, an die sie geknüpft sind, auch eher zugedeckt werden. Narration kann die Perspektive auf die Musik verengen. Das gilt natürlich nicht generell, vor allem nicht für den gesamten Bogen der Operngeschichte. Aber für mich ist das ein wichtiger Ansatz, dem ich nachgehe. Ich finde, es wird in der Wahrnehmung von Musik zu viel Aufmerksamkeit auf ihre Begründbarkeit durch Kontext gelegt und weniger darauf, dass ihr immer auch etwas zutiefst Intuitives und Unerklärbares innewohnt. Das kommt womöglich ohne Handlung viel besser zum Vorschein. Bei unseren Gesprächen sagte eine Dame nach dem Hören einer Arie: Der Komponist wisse auch nicht, warum er das komponiert habe, er habe es aber auf jeden Fall geschrieben, damit wir es in uns aufnehmen können. Das fand ich in seiner Schlichtheit einen schönen Satz, weil er das Unerklärliche an Musik in Worte fasst.
Wenn es der Inhalt der Oper nicht ist, worin besteht dann die Verbindung zwischen der Musik und den Filmaufnahmen alter Menschen?
Im emotionalen Bezug dieser beiden scheinbar weit voneinander entfernten Kunstformen. Ich kann ein Beispiel geben: Wenn ein Mensch mit 90 Jahren sich vom Stuhl erhebt, ist das ein ungeheurer Kraftaufwand. Und in der Verbindung mit der Musik wird der als solcher erfahrbar. Was wir normalerweise bloss als Moment der Unsicherheit und Fragilität wahrnehmen, wirkt durch die Musik wie eine Heldentat. Das ist in meiner Wahrnehmung viel stärker, als wenn ich auf der Bühne eine Heldentat mit Sängern spielen lassen würde. Wenn man über alte Menschen spricht, redet man gerne über ihre Gebrechlichkeit und die Mühen, die ihnen der Lebensalltag bereitet. Oder umgekehrt: Wir staunen, wie fit sie noch sind, wenn sie etwa im hohen Alter noch Fahrrad fahren. Aber die Wahrheit ist für mich etwas Anderes: Wir sind immer die gleichen Menschen, nur in unterschiedlichen Körpern, erst in jungen, später in alten. Ich wollte mit Hilfe von Pergolesis unglaublich vitaler Musik zeigen, dass die Menschen eigentlich gar nicht alt sind, sondern lediglich gealterte junge Menschen.
Und was geben umgekehrt die Dokumentarfilmaufnahmen der Musik?
Die Bilder verändern unsere Wahrnehmung der Musik. Wir hören die Arien anders. Ein Kameraschwenk verändert die Aufmerksamkeitsführung, ein ruhig und lang stehendes Bild schafft ein anderes Zeitempfinden für die Musik. Wie und wodurch sich die menschliche Wahrnehmung verändert, ist grundsätzlich ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Wie man durch das Leben gehend plötzlich angeregt durch einen scheinbar unbedeutenden Augenblick einen anderen Blick kriegt. Ich denke, das kennt jeder von uns, dass man durch einen einzigen Anblick auf einmal beispielsweise eine ganze Stadt anders sieht. Das sind erhellende Momente. Eine andere Wahrnehmung zu schaffen, das wünsche ich mir auch für die Kunstform Oper, die so sehr traditionsverhaftet ist. Es soll am besten alles so sein, wie es gewesen ist. Dabei ist doch gerade die Operngeschichte voll von Künstlern, die sich radikal abgesetzt haben vom Althergebrachten, um neue Perspektiven zu schaffen. Trotz des höfischen Prunks und dem repräsentativen Gebaren war die Oper immer eine erstaunlich unruhige Kunstgattung. Sie hat sich in ihrer Geschichte nie lange zu einer dauerhaften Form verfestigt, war ständig in einem Stadium des Umbruchs. Es ging den Komponisten immer darum: Wie weit kann ich gehen, wie kann ich die Form erneuern? Wir Regisseure versuchen diese Dynamik auf einer Interpretationsebene fortzuführen und die Werke immer wieder neu zu erzählen, was natürlich viel schwieriger ist, weil wir nicht wirklich Neues schaffen, sondern das Gegebene immer neu zu erzählen versuchen.
Wie muss man sich die theatralische Situation grundsätzlich vorstellen, wenn Pergolesis Arien mit den Dokumentarfilmaufnahmen zusammenkommen? Nimmt der Abend dann eher den Charakter einer Kinovorführung an?
Das würde ich so nicht sagen, aber das Opernhaus wird in dieser Produktion schon zu einem anderen Theaterraum. Man muss es als Zuschauer annehmen, in die Oper zu gehen und diese in unserem Ansatz aus einer völlig veränderten Perspektive zu erfahren. Man könnte den Abend auch als eine Art Oratorium begreifen. Das Zürcher Orchestra La Scintilla wird live im Orchestergraben spielen. Es gibt grossartige Solistinnen und Solisten, die die Arien singen. Es gibt ein Bühnenbild, das unser ursprüngliches Bühnenkonzept in einem wegen Corona nicht zu Ende gebauten Zustand zeigt. Ich mag das Unfertige daran. Mir fehlt nichts, obwohl vieles fehlt. Oper erscheint darin wie eine ferne Erinnerung, wie ein Traum, wie eine Hoffnung, aber gerade nicht als Realität.
Die Premiere der Produktion sollte im November 2020 über die Bühne gehen. Aber auch das hat die Corona- Pandemie verhindert. Wie war die Situation damals?
Wir haben geprobt und auf die Premiere hingearbeitet. Ottavio Dantone, unser Dirigent und musikalischer Partner, und alle Sängerinnen und Sänger waren da und total offen für das, was wir vorhatten. Auch das Haus hat uns wahnsinnig unterstützt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Energie in eine Produktion gelegt, weil alles künstlerisch so neu und spannend war und unglaublich viel Freude gemacht hat. Sonja und ich haben Nachdrehs gemacht und nachts wie im Rausch editiert und geschnitten, um das Material am nächsten Morgen für die Proben fertig zu haben. Und als die allerletzten Files aus der Farbkorrektur kamen und tatsächlich alles fertig war, lasen wir bereits auf den Nachrichtenportalen, dass der nächste Lockdown verhängt wird. Eine interne Generalprobe hat noch stattgefunden, die Premiere dann nicht mehr.
Wie ging es dir damit?
Für mich war das der absolute Tiefpunkt der gesamten Coronazeit, weil die Entstehung des Projekts für mich der absolute Höhepunkt war. Es war wie ein K.O.-Schlag. Ich habe lange gebraucht, um mich davon zu erholen. Ich bin noch einen Monat in Zürich in der Theater- wohnung geblieben, weil ich es einfach nicht geschafft habe, abzureisen. Auch meine Folgeprojekte wurden abgesagt. Ich war wie gelähmt.
Hast du daran geglaubt, dass das Projekt irgendwann doch noch auf die Bühne kommt?
Nein.
Es gab keinen Funken Restoptimismus?
Ich habe bis heute aufgehört, an irgendetwas zu glauben, solange es nicht tatsächlich stattfindet. Im Moment sieht es sehr danach aus, dass unser Pergolesi- Projekt am 12. März Premiere haben wird, aber hundertprozentig glaube ich es erst, wenn es passiert ist.
Was hat sich seit der abgesagten Premiere im November 2020 in Bezug auf die Produktion verändert?
Im Leben der alten Menschen, die im Film vorkommen, hat sich einiges verändert – und nicht zum Guten. Zwei Mitwirkende sind inzwischen verstorben. Es macht mich sehr traurig, dass sie die Aufführung nicht mehr sehen können, obwohl sie so viel von sich gegeben haben. Ich bin gerade im Kontakt mit dem Altenheim, das wir besucht haben, und einer der Mitwirkenden hat mir eine sehr persönliche Mail geschrieben, in der er beklagt, dass das Leben in dem Altenheim seit damals noch viel stiller geworden ist. Als wir gedreht haben, gab es noch einen gewissen Humor im Umgang mit der Situation und Lust zu kommunizieren. In der Mail klingt es nun so, als hätten die vergangenen anderthalb Jahre einfach nur an den Kräften gezehrt. Insofern zeigt unser Film noch eine belebtere Form der Wirklichkeit.
Hat die Produktion Auswirkungen auf deine zukünftige künstlerische Arbeit?
Sie hat meinen Blick auf Oper und Musiktheater völlig verändert. Die Form der filmisch-dokumentarischen Arbeit mit Musik, die wir hier in Zürich entwickelt haben, ist für mich ein Weg, den ich unbedingt weitergehen will. Ich tue im Moment nichts anderes, als dem zu folgen. Ich habe inzwischen auch an einer reinen Filmversion des Pergolesi- Projekts gearbeitet, die ich veröffentlichen werde. Die Zürcher Arbeit ist eine wichtige Weichenstellung für mich, aber vielleicht auch allgemein dafür, dass man die Verbindung von Oper und gesellschaftlicher Wirklichkeit ganz anders denken kann als in der herkömmlichen Form von Inszenierungen.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 90, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Interview

Ottavio, du kennst den Komponisten Giovanni Battista Pergolesi so gut wie kaum ein anderer Dirigent. Was fasziniert dich an ihm?
Dass er als Komponist so wahnsinnig jung war und in diesen jungen Jahren eine kompositorische Reife an den Tag legt, die kaum zu glauben ist.
Pergolesi wurde 1710 geboren. Er beendete seine musikalische Ausbildung 1731 und starb fünf Jahre später im Alter von 26 Jahren an Tuberkulose. Er hatte also nur fünf Jahre, in denen er sein gesamtes Opernschaffen entfaltete. Wie ist so etwas überhaupt möglich?
Ganz einfach: Pergolesi war ein Genie. Die Oper L’Olimpiade, mit der wir uns hier in Zürich gerade befassen, hat er ein Jahr vor seinem Tod geschrieben. Mehr als 50 andere Komponisten haben diesen Stoff von Pietro Metastasio vertont, es war eines der am häufigsten vertonten Libretti der damaligen Zeit. Aber Pergolesis Version wurde sofort als meisterhaft anerkannt. Schon bald nach seinem Tod gab es zwanzig Abschriften von L’Olimpiade. Für das 18. Jahrhundert war das ein Ausweis absoluter Berühmtheit. Verglichen mit heute, würde das einem Verkauf von zigtausenden CDs entsprechen. Noch berühmter war sein Stabat Mater. Pergolesi-Abschriften kursierten überall. Auch Johann Sebastian Bach etwa besass eine Abschrift des Stabat Mater. Die Komponistenfigur Pergolesi war ein Mythos, der natürlich auch durch seinen frühen Tod genährt wurde.
Vom Wunderkind Mozart wissen wir, dass dessen ausserordentliche Befähigung durch die strenge Schule des Vaters, ausgedehnte Reisen usw. gefördert wurde. Wie war das bei Pergolesi?
Er wurde in Jesi in den Marken geboren und entstammt eher bescheidenen familiären Verhältnissen. Schon als Kind war er ein begabter Sänger im örtlichen Domchor. Sein Vater, ein Landvermesser, hat ihn früh zu einer musikalischen Ausbildung nach Neapel geschickt. Dort hatte er sehr gute Lehrer, sein wichtigster war Francesco Durante. Dadurch war Pergolesi von Anfang an zu Hause im neapolitanischen Stil, der damals der führende in der musikalischen Welt war. Jeder Komponist, der etwas auf sich hielt, kam nach Neapel, um den dortigen Kompositionsstil zu studieren.
Was weiss man sonst noch über sein Leben?
Nicht sehr viel. Er hatte eine sehr schwache gesundheitliche Konstitution von früher Kindheit an und eine Gelenkversteifung im Bein, wegen der er hinkte. Es gibt ein Bildnis aus dem Jahr vor seinem Tod, auf dem die Gebrechlichkeit des 25-Jährigen zu erkennen ist.
Du hast Pergolesis Geburtsort Jesi erwähnt. Das ist ein Ort, zu dem auch du eine enge persönliche Verbindung hast.
Genau. Jesi ist ein kleines Städtchen, das jedes Jahr ein Festival zu Ehren von Pergolesi ausrichtet. Dort habe ich mit meinem Ensemble, der Accademia Bizantina, alle grossen Bühnenwerke von Pergolesi aufgeführt und sie auch auf Tourneen in anderen Städten präsentiert. Wobei man sagen muss, dass solche Aufführungen eher die Ausnahme sind: Pergolesi wird, gemessen an seinem Rang als Barockkomponist, bis heute viel zu selten gespielt, weder in Italien noch anderswo.
Worin besteht das Geniale in seinem Komponieren?
Er hatte mit Anfang zwanzig einen absolut unverwechselbaren Stil. Daran erkennt man, dass er ein ganz grosser Komponist war. Faszinierend an seinem Stil ist die unglaubliche Effizienz, mit der er Emotionen in seiner Musik zu fokussieren versteht. Es hat eine geradezu strategische Qualität, wie er Gefühle durch Musik erzeugt.
Was unterscheidet ihn von den anderen Komponisten seiner Zeit? Was ist neu und revolutionär an seiner Art zu schreiben?
Es wäre falsch, in ihm einen Umstürzler zu sehen. Pergolesi hat den neapolitanischen Opernstil nicht revolutioniert, sondern weiterentwickelt und die musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten der Zeit maximal ausgeschöpft. Er verkörpert eine neue Generation im Vergleich zu etablierten Älteren wie Alessandro Scarlatti oder Francesco Durante. Sein Schreiben ist geprägt von einer untrüglichen Intuition und, wie gesagt: Man erkennt Pergolesi sofort. Vielleicht wäre er ein Revolutionär der Musikgeschichte wie Beethoven geworden, wenn er länger gelebt hätte. Wir wissen es nicht.
Ist sein Stil, für Gesang zu schreiben, nicht auch lyrischer, natürlicher und beweglicher als der seiner älteren Zeitgenossen?
Das stimmt. Er schreibt nicht virtuos um der Virtuosität willen, die Gesangskunst gerät bei ihm nicht zum Selbstzweck. Es gibt zwar auch bei Pergolesi hochvirtuose Arien wie beispielsweise die grosse Arie von Megacle «Torbido in volto e nero» in L’Olimpiade. Das ist etwas vom Schwierigsten, das die Opernliteratur des 18. Jahrhunderts überhaupt zu bieten hat. Aber alles steht im Dienst des Gefühlsausdrucks.
Man fragt sich, wie ein Jüngling von einundzwanzig Jahren, der ausser kirchlichem Internatsleben und musikalischem Unterricht noch nicht viel erlebt hat, so tiefgründig über Liebe, Rache, Verzweiflung und Vergebung schreiben konnte. Aus eigener Lebenserfahrung hat er da ja wohl kaum geschöpft.
Wir wissen wenig darüber, was Pergolesi in seinem eigenen Leben emotional bewegt hat. Aber ich bin überzeugt davon, dass er die Erfahrung persönlichen Leides sehr wohl kannte. Das muss so gewesen sein. Die Frage, die du stellst, folgt unserem Denken von heute: Dass ein Künstler etwas erlebt haben muss, um es in Kunst zum Ausdruck bringen zu können. Im 18. Jahrhundert war das nicht so. Emotionen in Töne zu kleiden war eine Kunst, die man unabhängig von persönlichen Erfahrungen praktizierte. Die Komponisten schrieben mit Distanz zu ihrer eigenen Biografie über die Leidenschaften ihrer Opernfiguren. Trotzdem oder gerade deshalb kommt mir Pergolesis Art zu komponieren wie eine Vorwegnahme eines frühromantischen Empfindens vor, das tatsächlich eigene Gefühle und eigenes Leid in der Kunst verarbeitet. Die emotionale Reife und Tiefe bei Pergolesi hat für mich etwas quasi Romantisches, obwohl die Romantik ja in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch sehr weit weg war.
In den Lexika werden vor allem Pergolesis Verdienste für die Entwicklung der Opera buffa herausgestellt. Waren die tatsächlich so gross?
Absolut. Pergolesi hat, wie üblich, Intermezzi für seine grossen Seria-Opern komponiert. Diese Intermezzi in einer Länge von vierzig bis fünfzig Minuten hatten die Aufgabe, die langen, ernsten Opernabende in Form einer komischen Einlage aufzulockern und waren eigentlich Nebensächlichkeiten. Aber Pergolesi hat sie so gut geschrieben, dass ihnen plötzlich eine ganz neue Bedeutung zukam. Für die Oper Adriano in Siria beispielsweise, aus der auch einige Arien in L’Olimpiade übernommen sind, schrieb Pergolesi das Intermezzo Livietta e Tracollo, und das war so originell, dass es in den Vorstellungen zum eigentlichen Höhepunkt des Abends avancierte. Pergolesi hat dem Interesse an der Opera buffa einen enormen Schub verliehen und – natürlich vor allem mit seinem bekanntesten Stück La serva padrona – sehr viel dazu beigetragen, dass sie sich als eigenständige Form im Opernrepertoire etablieren konnte. Er schreibt wunderschöne Musik in den Buffas. Musik und die dramatischen Situationen sind ganz eng aufeinander bezogen. Alles wirkt frisch und spontan und ist wirklich komisch.
Pergolesis Nachruhm war enorm. Welchen Einfluss hatte er auf die folgenden Generationen?
Zunächst einmal hatte Pergolesi einen Rieseneinfluss auf die neapolitanische Schule selbst, aber durch deren Bedeutung auch weit darüber hinaus. Grosse Komponisten haben sich ja zu allen Zeiten von Meisterwerken anderer inspirieren lassen, aber Pergolesi wurde von den nachfolgenden Generationen besonders stark wahrgenommen. Seine Opern galten als Meilensteine der Gattung und wurden intensiv studiert. Die Komponisten haben ihn gar nicht unbedingt kopiert, aber sie haben sich von ihm inspirieren lassen. Es ist mitunter mehr ein unterschwelliger Einfluss, der da stark wirkte. Wenn ich etwa Opern von Giovanni Paisiello oder Niccolò Jommelli höre, klingt in meinen Ohren immer Pergolesi durch. Ich kann das oft gar nicht so genau benennen, aber es ist völlig evident. Und manche seiner Arien, vor allem aus L’Olimpiade, wurden zu regelrechten Hits, wenn man etwa an «Mentre dormi» denkt oder «Se cerca, se dice». «Se Cerca» war so berühmt, dass es von anderen Komponisten parodiert wurde, und das Publikum verstand sofort den Bezug, weil die Arie so bekannt war.
Die Arien «Mentre dormi» und «Se cerca, se dice» werden wir in unserer Zürcher Pergolesi-Produktion hören, gesungen von Anna Bonitatibus und Vivica Genaux. Aber die ganze Oper hören wir nicht. Der Abend besteht musikalisch lediglich aus einer Abfolge der L’Olimpiade-Arien, alle Rezitative sind gestrichen. Was sagt der Dirigent und Pergolesi-Experte dazu?
Es herrschte eine grosse Freiheit in der Aufführungspraxis zu Pergolesis Zeit. Die Werkgestalt war offen und überhaupt nicht so festgelegt, wie wir das heute gerne glauben. Ich habe beispielsweise L’incoronazione di Dario von Antonio Vivaldi gemacht. Das Manuskript ist im dritten Akt voll von wüsten und dramaturgisch sinnlosen Strichen, die irgendwelchen aus heutiger Sicht völlig unergründlichen Umständen geschuldet sind. Die Opernpraxis hing damals von vielen stückfernen Faktoren ab, vom Geld, von den Wünschen der Auftraggeber, von den Vorlieben der Sängerstars, von den technischen Möglichkeiten usw. Dementsprechend war der Umgang mit den Partituren. Die Komponisten haben sich auf die jeweiligen Gegebenheiten eingestellt. Es geht in der Barockoper nicht darum, alles genau so zu realisieren, wie es geschrieben steht. Deshalb sehe ich in unserem Versuch, Pergolesis Arien mit dem Medium des Films in Verbindung zu bringen, auch nichts philologisch Verwerfliches. Es ist eine künstlerische Antwort auf die Corona-Pandemie und die Unmöglichkeit, Oper in gewohnter Form zu spielen. Die Komponisten im 18. Jahrhundert hätten auch so reagiert.
Darf man einen Barockopern-Abend auf die Bühne bringen, ohne eine Geschichte zu erzählen? Sind Arien nicht immer Teil einer Handlung?
Ich finde: Nein. Arien führen sehr wohl ein Eigenleben jenseits der Handlung. Für die Operngänger der Barockzeit waren die Rezitative nicht so mit den Arien verbunden, wie wir das heute empfinden. Die Opernabende waren sehr lang, und wie wir wissen, hat sich das Publikum während der Rezitative auch mit anderen Dingen beschäftigt und vor allem den Arien, den Sängern, den musikalischen Höhepunkten die Aufmerksamkeit geschenkt. Man darf nicht vergessen, dass die Leute damals immer wieder in die gleiche Oper gingen. Die Handlung war ihnen deshalb geläufig. Ausserdem kannte man die Textbücher der populären Stoffe. Es gibt ja heute Liebhaber von Barockopern, die unbedingt alles hören wollen, alle Arien, die kompletten Rezitative, ohne Striche. Ich halte davon gar nichts. Das entspricht auch nicht der historischen Situation.
Die Arien haben ja einen Text, der sich in unserem Pergolesi-Projekt nicht, wie im szenischen Spiel, an ein Gegenüber richtet. David Martons Konzept zielt auf eine vor allem emotionale Verbindung zwischen Gesang und Bild. Ist das ein Problem?
Barockarien haben einen musikalisch-emotionalen Wert jenseits des Textes. Die Verbindung von Text und Musik ist nicht so eng, wie wir das aus dem 19. Jahrhundert kennen. Es gibt viele Beispiele dafür, wie im 18. Jahrhundert Arien in eine andere Oper übernommen wurden und dort mit einem neuen Text in einem veränderten emotionalen Kontext dennoch funktionieren. Oder denken wir an die sogenannten Kofferarien, die die berühmten Kastraten im Gepäck hatten und die eingebaut werden mussten, egal ob sie zum Stück passten oder nicht. In L’Olimpiade hat Pergolesi mit «L’infelice in questo stato» ausgerechnet einer kleinen Nebenfigur, Alcandro, eine seiner schönsten Arien spendiert, die ausschliesslich durch ihren musikalischen Moment wirkt. Wir versuchen hier in Zürich, auf eine ernsthafte, aber sehr experimentelle Weise mit Pergolesis Musik umzugehen. Das ist für mich philologisch durchaus legitim. David sucht mit Pergolesi nach einer Theatersprache, die mit unserer Zeit zu tun hat, und dabei unterstütze ich ihn. Das tue ich übrigens in allen Produktionen, egal in welche überraschenden Gefilde sie mich führen. Ich bin da immer positiv. Vielleicht entdecken wir ja eine Form von Musiktheater, wie sie uns bisher noch nicht begegnet ist, und die Menschen werden auf eine völlig neue Weise berührt.
Das Gespräch führte Claus Spahn
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 90, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Aus den Werkstätten
Der Prospekt
Alle Götter sind vereint. Zumindest auf dem Prospekt, der das Bild «La caída de los gigantes sitiando el Olimpo» von Francisco Bayeu y Subias zeigt und der zur Zeit in unserer neuen Produktion «Olimpiade» zu sehen ist. Ein Prospekt ist ein grosses bühnenfüllendes Gemälde, das das szenische Geschehen so schön bebildert und umrahmt. Prospekte gibt es schon seit der Antike, Archäologen wiesen gemalte Theaterhintergründe schon aus der Zeit 500 v. Chr. nach.
Wenn Sie sich einen solchen Prospekt daheim aufhängen wollen, benötigen Sie viel Platz, immerhin sind unsere Prospekte 17 Meter breit und 10 Meter hoch!
Die Kunst bei der Herstellung dieser Prospekte liegt in der Übertragung der Vorlage auf den originalgrossen Malhintergrund. Denn die Vorlagen aus denen diese Prospekte entstehen, sind meist relativ klein. In unserem Falle ist die Vorlage nur im Format A3 vorhanden. Wie entsteht denn dann daraus ein so detailreiches Gemälde in dieser überdimensionalen Grösse?
Wenn Sie sich selber an ein solches Vorhaben wagen, benötigen Sie einen Malersaal, der eine grössere Fläche hat als der Prospekt selber. Sie malen das Bild solange es am Boden liegt, eine Staffelei wäre in dem Falle auch unpraktisch. Zuerst nehmen Sie ein grosses, nahtloses Stück Baumwollstoff und nageln es faltenfrei auf dem Boden auf. Anschliessend grundieren Sie das Tuch mit weisser Farbe. Dann nehmen Sie Schnüre und legen ein 1 x 1 Meter grosses Raster über den Stoff.
Dieses Raster legen Sie massstabsgetreu auch über Ihre Vorlage. Jetzt können Sie mit Kohlestiften die Formen des Bildes der Vorlage auf den Stoff übertragen. Radieren können Sie auch, dazu blasen Sie die Kohlezeichnung einfach weg und zeichnen wieder neu.
Nun tinten Sie die Linien mit Beize nach. Diese Linien bleiben immer sichtbar, auch wenn Sie mehrere Farbschichten verwenden. Jetzt malen Sie in mehreren Farbaufträgen so detailgetreu wie möglich. Vielleicht müssen Sie Details erfinden, die in der kleinen Vorlage nicht erkennbar sind. Zwischendurch sehen Sie sich Ihr Gemälde immer mal wieder aus der Entfernung an, 5 bis 10 Meter sind ideal und Sie malen solange, bis Ihnen das Ergebnis gefällt und Ihrer Vorlage entspricht. Wenn Sie geübt sind und mit Ihren Bekannten in einem Team arbeiten, sind Sie nach 4- 5 Wochen fertig.
Jetzt müssen Sie den Prospekt nur noch aufrollen und bei sich zu Hause aufhängen!
Am besten nutzen Sie dazu solche Züge, wie wir sie im Opernhaus haben, die können immerhin 21 Meter hochfahren!
Von Jörg Zielinski, Leiter des Ausstattungswesens am Opernhaus Zürich
Volker Hagedorn trifft...

Vivica Genaux
Vivica Genaux stammt aus Alaska, lebt in Italien und gehört seit vielen Jahren zu den weltweit führenden Mezzosopranistinnen im Barockrepertoire. Sowohl im Konzertsaal als auch auf der Opernbühne wurde sie insbesondere mit dem für Kastraten komponierten Repertoire berühmt. Vivica Genaux veröffentlichte zahlreiche CD-Produktionen, darunter die sehr erfolgreichen «Arias for Farinelli».
Ein Bahnhof in Osaka, im Winter 1982. Charles T. Genaux, ein amerikanischer Biochemiker auf Forschungsreise, wartet mit seiner Familie auf den Zug nach Okinawa. Seine Tochter Vivica, dreizehn, kommt strahlend mit einem Büchlein an. In einer Buchhandlung in Japan hat sie das Libretto von My Fair Lady entdeckt – auf englisch. «Ich weiss nicht, wie das möglich war!» Sie freut sich jetzt noch, viele Jahre später. «Ich war schon immer verliebt in die Rolle der Eliza. Ich liebte Audrey Hepburn, Julie Andrews, jede, die das sang, und war sowieso schon entschlossen, im Sommer die Eliza in einer Produktion meiner High School zu singen.» Der Fund war für sie so etwas wie ein Wink der Götter. «Ich lernte den ersten Akt auf dem Weg nach Okinawa und den zweiten auf dem Rückweg.» Und im Sommer hat sie dann tatsächlich die Eliza gespielt und gesungen, als Allerjüngste auf der Schülerbühne – in Fairbanks, Alaska, wo sie geboren ist.
Vivica Genaux hatte das vor eineinhalb Jahren erzählt, als wir uns während der Proben zu Pergolesis Oper L’Olimpiade in Zürich trafen. Die zweite Coronawelle bäumte sich gerade gefährlich auf. Vivica war engagiert für die Partie des Megacle, der Kastratenrolle in der Oper, und dankbar, überhaupt proben zu dürfen. «Das Opernhaus Zürich ist eines der wenigen Häuser, wo wir jetzt noch arbeiten können», hatte sie damals gesagt. Aber es kam dann doch anders. Die Produktion musste wegen des kurze Zeit später verhängten Lockdowns nach der Generalprobe abgesagt werden. Vivica Genaux reiste, enttäuscht und traurig wie alle Beteiligten, nach Hause in ihre Wahlheimat Italien, ohne eine einzige Vorstellung gesungen zu haben. Aber die Opernhausleitung versuchte das PergolesiProjekt durch Verlegung zu retten, schaffte es, alle Künstlerinnen und Künstler zu einem neuen Premierentermin zusammenzubringen, schob diesen zusätzlich in den eng getakteten Spielplan, und sagte dafür sogar den Opernball ab – sodass Vivica Genaux nun doch noch mit den virtuosen MegacleArien in Zürich auf der Bühne stehen wird.
Sie mag diese Arien, «so eine Art BroschiSound, bambambambam», hatte sie gesagt, als sei völlig klar, dass ich Riccardo Broschi kenne, den komponierenden Bruder des Kastraten Farinelli. Vivica Genaux denkt und spricht unglaublich schnell und klar, auf englisch – so, wie sie auf italienisch singt, wenn sie abhebt. Die Kunst der Koloratur beherrscht sie in Perfektion, dazu voller Esprit und Sinnlichkeit. In «nahe zu unsingbaren Arien», staunte 2019 die Frankfurter Allgemeine Zeitung, entfache Genaux «ein Feuerwerk vokaler Hochseilakte». Das Virtuose ist dabei ein Ausdruck der Gefühle, die sie in ihren Rollen interessieren. «In einer Arie von Pergolesi, die offenbar der Hit der Show war, Se cerca, se dice, gibt es ein stop and go ganz unterschiedlicher Energien, Megacle ist hin und her gerissen. Wenn man es sich anguckt, sieht es sehr einfach aus, man könnte fürchten, es sei langweilig, aber es ist sehr direkt, sehr aufrichtig, eine Art Lascia ch’io pianga. In der Welt barocker Opern bewegt sie sich, als sei sie darin aufgewachsen, und gleich hinein ins Mezzofach.
Das Gegenteil ist der Fall. Aufgewachsen in Fairbanks, einer Stadt voller Musicals und damals ohne Oper, am 64. nördlichen Breitengrad, von Goldgräbern gegründet, im Kalten Krieg eine USMilitärbasis. «Es gab da viele VietnamVeteranen, die in der Gesellschaft nicht mehr zurechtkamen und einen Platz suchten, wo sie nicht konform sein mussten. Alaska ist eine sehr offene Gesellschaft. Auch mein Vater war nicht der Typ für social rules, er liess sich nichts vorschreiben, baute ein Blockhaus und unterrichtete seine Studenten so, wie er es wollte. Man lebte weit weg von den anderen, aber dazu kam ein starkes Bedürfnis nach Zusammensein. Sport? Bei vierzig Grad minus kann man nicht mal Ski fahren. Die Künste waren wirklich wichtig, eine Lebensnotwendigkeit. Du konntest alles machen, egal wie talentiert. Mitmachen war das Wichtigste. Nicht dieses Elitezeug, oohh, du darfst nicht… nein! Oh doch, ich darf, und du darfst auch. Come, come, come!»
In Fairbanks hörte sie Cab Calloway und Canadian Brass, Martha Graham kam mit ihrer Dance Company, Vivica Genaux sang im Chor – und sie wollte Eliza sein. Nach dem Winter 1982 in Japan, das frisch erworbene Libretto im Gepäck, begleitete sie den Vater weiter nach Texas, und dort bekam sie eine Gesangslehrerin. Keine Geringere als Dorothy Dow in Galveston unterrichtete die Dreizehnjährige, eine berühmte Hochdramatische, die einst die Opernwelt von Zürich aus erobert hatte und nun das Mädchen zur Sopranistin machte. Doch Virginia Zeani, bei der Vivica später in Indiana studierte, wunderte sich, als sie hörte, wie die junge Sängerin sich in die tiefen Lagen von Fiordiligis Come scoglio warf. «But my darrling,» imitiert Vivica sie lachend, «if you want for to sing like this you must for to be mezzosoprano!»
Vivica war besonders das romantische Sopranrepertoire so unangenehm wie das Geigenspiel, das sie gelernt hatte. «Ich konnte diese Rollen nicht ertragen, diese Mädchen, die als einzige Lösung für den Konflikt in ihrem Leben hatten, wahnsinnig zu werden, zu sterben oder sich umzubringen. In Barockopern sind Frauen viel stärker. Irgendwas passierte im Zeitalter der Aufklärung, weswegen sie geschwächt werden sollten. Nur bei Rossini gibt es noch starke Frauen, Mezzos: Rosina, Isabella, Cenerentola. Also sang ich in den ersten drei Jahren meiner Karriere nur Rossini – und er wurde mein Rettungsboot.» Denn nach einem ihrer Auftritte, 1998, wurde sie zu einem Vorsingen an der Staatsoper unter den Linden eingeladen. René Jacobs brauchte einen Selimo für Hasses Oper Solimano und engagierte Vivica sofort. Es wurde ein Triumph.
«Barockmusik war meine Welt! Viel mehr Freiheiten, wie ein grosser Sandkasten!» Freiheiten für die Verzierungen, die sie so liebt, und für das besondere Temperament, das mit dem Mezzofach verbunden ist. «So much more me! Mezzocharaktere sind die, die andere in Schwierigkeiten bringen, die Manipulatoren. Selbst wenn sie sterben, haben sie vorher noch Schaden angerichtet», sagt sie unbändig lachend: «I love trouble making!» Und egal, wie gross der Schaden ist, wieviel Verzweiflung, gebrochene Herzen, Opfer es gibt, «Barockoper hat eine schöne, elegante Art, auf Schmerz und Leiden zu schauen. Es ist artistisch. Es ist auch wahrhaftig, aber du bist in einer cornice, einem Rahmen. Im richtigen Leben gibt es so viel Leiden ohne Hoffnung. Das Theater bringt mich eine Stufe höher, es gibt mir Hoffnung und Inspiration.»
Damit meint Vivica Genaux kein Theater der Weltflucht. Hinter ihren vokalen Feuerwerken steckt enorm viel Reflexion – und auch Erfahrung aus dem ungeliebten Geigenspiel. «Wie auf der Violine musst du den Ton denken, ehe du ihn greifst. Das d kann auch gesungen als leere Saite klingen oder auf der GSaite gegriffen werden. Man kann die Stimmbänder dünn oder dick werden lassen. Trotzdem, ein Sänger ist ein ganz anderes Tier als ein Instrumentalist. Mein Körper ist das Instrument, und meine Rollen ändern mich im Innern. Es macht mich wahnsinnig, wenn Leute sagen, man müsse das ‹natürlich› machen. Der Apparat im Hals war ursprünglich nicht mal zum Sprechen gemacht, nur zum Schlucken und Atmen und damit das Essen nicht in die Lunge fällt!»
Seit neuestem steigt sie noch tiefer ein und studiert Psychologie, um jungen Sängern so helfen zu können, wie das mit Psychologie für Sportler längst getan wird, «fundiert, nicht als Wohlfühlaktion. Als in Norditalien der erste Lockdown begann, fragte ich mich, wie lange es dauern würde, und wollte meine Zeit nicht verschwenden. Also beschloss ich, online zu studieren. Und da ich mit Autorität nicht gut klarkomme, nahm ich Alaska. Ich wollte bei der Sorte Leute lernen, mit denen ich aufwuchs. Und so war’s. Really me.» Auch wenn Vivica nicht weiss, welche Zukunft es für Sängerinnen und Sänger gibt, sieht sie die Barockoper als Überlebensmodell. «Diese Stücke sind nicht in Stein gemeisselt. Man kann sie jeder Situation anpassen.»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 90, Februar 2022
Das MAG können Sie hier abonnieren.