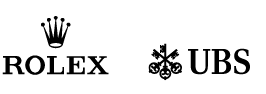L'incoronazione di Poppea
Opera musicale in drei Akten von Claudio Monteverdi (1567-1643)
Dichtung von Francesco Busenello
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 3 Std. 10 Min. inkl. Pause nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 15 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Gespräch

Sexualität und Macht
Monteverdis «L’incoronazione di Poppea» zeigt eine hedonistische Gesellschaft zur Zeit des grausamen römischen Kaisers Nero, in der Sexualität skrupellos als Machtinstrument eingesetzt wird. Ein Gespräch mit Regisseur Calixto Bieito vor der Premiere im Juni 2018 über die faszinierende Aktualität dieser 376 Jahre alten Oper.
Dieser Artikel erschien im Juni 2018.
Calixto, du hast im Laufe deiner Karriere viele Opern unterschiedlichster Komponisten auf die Bühne gebracht, doch bisher noch nie ein Stück von Monteverdi.
L’incoronazione di Poppea möchte ich schon seit vielen, vielen Jahren inszenieren – seit ich das Stück vor ungefähr 30 Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Damals war ich sofort fasziniert davon. Seitdem warte ich auf die Gelegenheit. Und nun ist sie endlich da!
Warum hat dich dieses Stück vom ersten Moment an fasziniert?
Zuallererst wegen der Musik, die einfach unglaublich schön ist. Aber sie ist nicht nur schön – sie entfaltet gemeinsam mit der Handlung dieses Stückes auch eine ambivalente Wirkung. In Poppea wird eine hedonistische, dekadente Gesellschaft gezeigt, in der die Menschen sich extrem egoistisch verhalten. Jeder ist getrieben von seinem persönlichen Ehrgeiz, Sexualität wird als Machtinstrument eingesetzt. Es kommt einem fast so vor, als sei damit unsere heutige Gesellschaft gemeint – obwohl das Stück vor mehr als 350 Jahren entstanden ist. Der Kaiser Nerone denkt ausschliesslich an seine eigenen Bedürfnisse, er sagt im Stück: Das Volk, der Senat, mein Ruf, das alles ist mir egal – solange ich das bekomme, was ich möchte, nämlich Poppea zu heiraten und zur Kaiserin zu machen, egal, zu welchem Preis. Die Charaktere, die Monteverdi und sein Librettist Busenello geschaffen haben, sind uns so nah, dass wir uns vielleicht sogar leichter mit ihnen identifizieren können als mit Figuren aus Opern des 19. Jahrhunderts. Und die Art und Weise, wie sie sich musikalisch äussern, begünstigt das, denn die Musik baut ganz auf der Sprache auf. Ich denke übrigens, dass auch jungen Menschen der Einstieg in die Oper mit einem Stück wie Poppea leichter fallen könnte als mit den meisten anderen Opern.
Deine Bühnenbildnerin Rebecca Ringst hat einen Laufsteg entworfen; spielt die Oper in deiner Inszenierung in der Modewelt?
Ich will keine Fashion-Show machen und auch keine Geschichte über irgendeinen Modezar erzählen, das interessiert mich nicht. Dass wir uns für diesen Laufsteg entschieden haben, ist als Metapher für unsere heutige Welt gemeint. Es geht darum, wie wir uns selbst Tag für Tag auf Facebook und Instagram präsentieren, ständig Selfies von uns posten, unsere Meinung bedenkenlos auf Twitter öffentlich äussern, egal, wie extrem oder verletzend sie für andere sein mag. Mir kommt es vor, als seien viele Menschen heute regelrechte Exhibitionisten. Diskrete Menschen sind viel schwerer zu finden.
Tatsächlich gibt es in Poppea kaum eine Figur, die nicht zuallererst an sich selbst denkt.
Jeder möchte die Situation für seinen eigenen Vorteil ausnutzen, jeder möchte auf der sozialen Leiter ein paar Stufen nach oben kommen, wenn irgendwie möglich. Sehr schön zu sehen ist das an Arnalta, Poppeas Amme, die bei uns von einem Mann gespielt wird und in meiner Inszenierung eher ein politischer Berater ist: Er rät Poppea zunächst von einer Verbindung mit Nerone ab, aber als Poppea dann tatsächlich Kaiserin wird, ist er der erste, der von dieser Entwicklung profitieren möchte.
Auch Seneca, der Philosoph und Lehrer Nerones, ist keineswegs der über allem stehende Moralist, sondern ein durchaus ambivalenter Charakter …
Senecas Texte darüber, wie man leben sollte, deckten sich nicht unbedingt mit dem, wie er selbst lebte. Als Stoiker predigte er Enthaltsamkeit, hatte aber selbst nicht nur eine Ehefrau, sondern wohl auch die eine oder andere Geliebte. Er hielt andere dazu an, bescheiden zu leben, häufte aber selbst einiges an materiellem Besitz an. Da ist es nicht verwunderlich, dass auch Nerone sich über die Argumente seines ehemaligen Lehrers einfach hinwegsetzte, seine Ehefrau Ottavia verstiess und Poppea heiratete. Um das allerdings tun zu können, musste Seneca mundtot gemacht werden; Nerone hat ihn zum Selbstmord gezwungen.
Gibt es überhaupt eine positive Figur in diesem Stück?
Vielleicht Drusilla. Sie liebt Ottone wirklich und ist sogar bereit, ihr Leben für ihn zu opfern. Aber sie ist wirklich die einzige! Nerones Ehefrau Ottavia ist zwar zu bemitleiden, weil Nerone sie mit Poppea betrügt; aber sie ist auch diejenige, die Ottone den Auftrag zum Mord an Poppea gibt. Ottone wiederum ist der unglückliche ehemalige Liebhaber Poppeas, der Nerone weichen muss; aber er ist bereit, Poppea zu töten, was ihn auch zu einer mindestens ambivalenten Figur macht.
Zu Beginn der Oper streiten die drei Götter Fortuna, Virtù und Amor, also das Glück, die Tugend und die Liebe, darüber, wer die meiste Macht über die Menschen hat; Amor wird diesen Wettstreit am Schluss des Stückes gewonnen haben. Aber ist es wirklich die Liebe, die hier siegt?
Wenn es ein Stück über die Liebe wäre, würde es vielleicht Nerone e Poppea heissen, aber nicht L’incoronazione di Poppea! Das Publikum zur Zeit Monteverdis wusste, dass Nerone seine schwangere Frau Poppea später ermordet hat, und konnte das «Happy End» relativieren. Natürlich fühlen sich Nerone und Poppea voneinander angezogen. Aber entscheidend ist, wie Poppea ihren Körper einsetzt, um Macht zu erreichen, wie Sex als Mittel eingesetzt wird, um im kapitalistischen System zu triumphieren. Ich kenne viele Politiker in Spanien, die ihre Körper eingesetzt haben, um Karriere zu machen, die keinerlei Moral haben, die andere Menschen nicht respektieren, unehrlich sind und demagogisch agieren. Und diese Politiker gibt es nicht nur in Spanien. Da muss man gar keine Namen nennen.
Amor stand ja zur Zeit Monteverdis auch nicht unbedingt für die reine Liebe, sondern vielmehr für die Lust, die Begierde.
Ja, das ist in der Musik deutlich zu hören, sie ist sehr verführerisch und erotisch. Monteverdi bewertet aber Erotik nicht per se negativ. Es bleibt immer ambivalent. Das gefällt mir.
Wer sind die drei Götter Amor, Fortuna und Virtù in deiner Inszenierung?
Sie sind für mich Kinder. Kinder können heute sehr despotisch sein, weil wir sie zu sehr verwöhnen – sie sind unsere Götter! Diese drei kleinen Götter spielen in unserer Inszenierung mit den Menschen und mit sich selbst.
Kommen wir noch einmal auf das Bühnenbild zurück: Es ist ja nicht einfach ein Laufsteg, sondern ein Laufsteg, der eine elliptische Form hat und sehr nah am Publikum steht; das Orchester sitzt in der Mitte dieser Ellipse.
Die Ellipse, die ja auch an eine Arena erinnert, zeigt uns unterschiedliche Perspektiven der Figuren und der Realität, sie macht die Figuren mehrdimensional. Das finde ich sehr interessant. Der Kreis ist für mich zudem der Raum einer Frau, weil er das Zyklische impliziert. Und natürlich ist es, wie schon gesagt, ein Ort, an dem alle Figuren vollkommen ausgestellt sind. Es gibt keine Privatheit in diesem Raum, keine Geheimnisse. Es ist, als wären die Figuren andauernd auf Facebook, Instagram oder Twitter.
Dazu gibt es Live-Kameras, die die Figuren ständig filmen.
Es ist wie eine freiwillige 24StundenÜberwachung. Und die Figuren lieben es, sich ständig selbst auf einer Leinwand zu sehen. Es ist die permanente Selbstdarstellung. Das ist übrigens gar kein so neues Phänomen. Als ich in den 90erJahren in Bogotà bei einem Festival gearbeitet habe, wurde die Festivaldirektorin Tag und Nacht von einer Kamera verfolgt, die sie bei allem filmte, was sie tat, bei jeder noch so unwichtigen, alltäglichen Tätigkeit.
Während der Proben hast du Monteverdis Poppea häufig mit den Dramen von Shakespeare verglichen.
Der Plot der Poppea hat alle Zutaten eines guten ShakespeareDramas: Sex and Crime, Politik und Poesie. Wenn ich von Shakespeare spreche, denke ich natürlich auch an seinen vielzitierten Satz «All the world’s a stage, And all the men and women merely players». Wir könnten diesen Satz ersetzen mit «All the world’s a catwalk …» – die ganze Welt ist ein Laufsteg. Alle spielen ununterbrochen eine Rolle. Und wenn man sich daran gewöhnt hat – in der Politik ebenso wie in der Modewelt –, ständig eine Rolle zu spielen, verliert man irgendwann das Gefühl dafür, wo die Rolle aufhört und das «echte» Leben beginnt.
Mit Nero und Poppea haben Monteverdi und sein Librettist erstmals in der Geschichte der Oper historische Figuren auf die Bühne gebracht. Ist es für die Vorbereitung deiner Inszenierung wichtig gewesen, diesen historischen Kontext zu kennen?
Natürlich war es wichtig für mich zu wissen, was für ein Mensch Nero gewesen ist, wie grausam er sein konnte, wie verrückt er war, dass er sowohl mit Frauen als auch mit Männern Sex hatte, dass er unglaubliche Gelage veranstaltet hat, für die seine Untertanen bezahlen mussten. Aber auch der Kontext, in dem Monteverdi diese Oper geschrieben hat, war wichtig für mich: Poppea entstand für die Karnevalssaison in Venedig zu einer Zeit, als Venedig wirtschaftlich und kulturell eine der wichtigsten Städte der Welt war. Monteverdi und sein Librettist benutzten die historischen Figuren, um etwas über ihre Gegenwart auszusagen. Diese Gegenwart muss von einer zynischen, vollkommen amoralischen Gesellschaft voller Intrigen geprägt gewesen sein. Um das zu erreichen, was sie wollen, gehen Nerone und Poppea über Leichen. Viel Hoffnung auf ein humaneres Leben gibt es in dieser dekadenten Gesellschaft nicht. Hoffnung gibt es nur in der Musik.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay
Schaut! Mich! An!
Die Figuren in Claudio Monteverdis frühbarocker Oper «L’incoronazione di Poppea» sind getrieben von Eitelkeit und einer Egomanie, die Parallelen zu der Selbstsucht aufweist, die uns heute aus den sozialen Netzwerken des Internets entgegenblickt. Der Medientheoretiker Ramón Reichert beleuchtet die Hintergründe der allgegenwärtigen modernen Selfie-Kultur.
Dieser Artikel erschien im Juni 2018.
Wir leben in einer Zeit, in der egozentrische Selbstdarsteller, Power-User und Influencer mittels Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter und Snapchat immer mehr Einfluss auf soziale Rollenmodelle, Identitätsskripte und politische Denkweisen nehmen. Selfies gelten heute als ein zentrales Kulturmuster der digitalen Gesellschaft. Die sogenannte Selfie-Generation hat eine neue Macht sozialer Inszenierung hervorgebracht, in welcher der Exhibitionismus des Privaten und Intimen als etwas Selbstverständliches und Alltägliches gelten. Die Selbstverständlichkeit, mit der Selfies heute bei jeder Gelegenheit gemacht werden, stellen neue Herausforderungen für die Gegenwartsgesellschaft dar. Mittlerweile haben sich frag würdige Genres herausgebildet, wie z.B. War-Selfies, Holocaust-Selfies oder Funeral-Selfies. Selfies zeigen oft Gesichter und vermitteln Emotionen. Daher wird das Selfie auch von politischen Aktivisten genutzt, um affektgeladene Inhalte zu transportieren. So zeigen einschlägige Studien und öffentliche Debatten, die «Holocaust-Selfies» oder «War-Selfies» thematisieren, dass die auf Instagram, Facebook und Twitter geteilten Selfies nicht einfach nur private Nutzungsräume erweitern, sondern nachhaltig in kollektive Erfahrungs- und Erinnerungsräume eingreifen.
Was unterscheidet Selfies eigentlich von früheren fotografischen Selbstporträts? Der Kunstkritiker Jerry Saltz meint, dass sich in Selfies ein neues «visuelles Genre» manifestiert, das sich von allen anderen historischen Formen des Selbstporträts unterscheidet: «Abgesehen von den formalen Unterschiedlichkeiten zwischen den beiden Formen – der Rahmung und der Technik – ist das traditionelle fotografische Selbstporträt deutlich weniger spontan und zwanglos als das Selfie.» Unter Selfies verstehen wir Formen der visuellen Selbstthematisierung, mit der sich eine Person oder auch mehrere Personen (als «Gruppenselfie») zum Thema der Aufnahme machen. Dabei entstehen Selfies meist mit einer Digitalkamera oder einem Smartphone von eigener Hand und können auf Online-Netzwerken mittels Hashtagging (ein mit der Markierung # versehenes Schlagwort), Abonnement-Strukturen und Follower-Netzwerken eine grössere Öffentlichkeit erreichen. Die hohe Verbreitungsdichte der Smartphones und ihrer mobilen Vernetzung mittels Apps hat dazu geführt, dass kommunikative Praktiken der Selbstthematisierung stark an Bedeutung gewinnen konnten. In Verknüpfung mit den bildgebenden Aufzeichnungs- und Speichermedien spielen Bilder in der alltäglichen Kommunikation eine zentrale Rolle. Soziale Medien üben dabei grossen institutionellen und normativen Druck auf die beteiligten Akteure aus, andauernd Selfies zu teilen. Unter diesem Druck gehen Smartphone-Nutzer oft absurde Risiken ein, um ein besonders spektakuläres Selfie zu schiessen – und der ein oder andere hat dabei sogar schon sein Leben verloren.
Mit den Selfies rückt sich zwar jeder Einzelne ins Bildzentrum; als sozial geteilte Bilder müssen sich diese Selfies jedoch auch bestimmten Rollenerwartungen, Körpernormen und Schönheitsidealen unterordnen. Dadurch gehören sie zu den kollektiv geteilten Leitbildern der Gegenwartsgesellschaft, mit welchen der Einzelne versucht, Anerkennung zu erreichen und Gruppenzugehörigkeit herzustellen.
In der heutigen digitalen Gesellschaft haben sich neue Imperative für unser individuelles Rollenverhalten herausgebildet. Der neoliberale Imperativ des unternehmerischen Selbst schuf das neue Rollenbild eines sich optimierenden Subjekts. Dieses Subjekt ist über die sozialen Netzwerke einem andauernden Feedback ausgesetzt und versucht, sich selbst möglichst optimal darzustellen, um sozial anerkannt zu werden. Selfies gelten daher als neue Währung auf dem neoliberalen Aufmerksamkeitsmarkt hyperindividueller Selbstdarsteller. Zudem ist die Ära der Post Privacy beherrscht vom Imperativ, sein (wahres) Gesicht zu zeigen, um dabei seine Authentizität unter Beweis zu stellen. Selfies verlagern dialogische face-to-face-Interaktionen ins Social Web und imitieren dabei Formen der Kommunikation. Obwohl sie auf eine «Tyrannei der Intimität» (Richard Sennett) abzielen, tangieren sie die Grenzen des Mediums, denn sie können den Blick des Betrachters nicht erwidern. Dennoch sind Selfies grundsätzlich als Kommunikationsmittel zu verstehen. Denn wer bestimmte Stile und Codes der Selbstdarstellung beherrscht, möchte anerkannt werden, Einfluss ausüben und zu einer Gruppe dazugehören.
Im Unterschied zu früheren Speicher-, Verarbeitungs- und Verbreitungstechnologien sind Selfies heute vor allem eines: Kommunikationsmedien. Als Medien obsessiver Echtzeit-Kommunikation versetzen sie die beteiligten Nutzer von Smartphones und Sozialen Medien in einen permanenten Zwang zur selbstbezüglichen Standortbestimmung und biografischen Bilanzierung. Diese Arbeit am eigenen Image bleibt fragmentarisch und unabgeschlossen – ihre dialektische Nervosität oszilliert zwischen den fotografischen Verstellungskünsten eines angepassten Opportunismus und einer Arbeit am Selbst, die innerhalb der Anerkennungsspirale der Like-Economy nie aufhören darf.
Wie die australischen Kommunikationstheoretiker Jean Burgess und Sonja Vivienne betont haben, liegt die Bedeutung der Selfies in der digitalen Gesellschaft vor allem darin, dass sie so obsessiv geteilt werden. Das Neue an Selfies ist, dass die Übertragung von Bildern instantan möglich sein kann, sie sind quasi in Echtzeit im öffentlichen Raum verbreitbar. Die rasante Verbreitung von digitalen Selbstbildern erweitert private Nutzungsräume und sorgt für eine bisher ungekannte Vermischung von Privatheit und Öffentlichkeit. Auch der Kunsthistoriker Geoffrey Batchen weist auf den kommunikativen Aspekt der visuellen Selbstthematisierung hin. Das Selfie ist in diesem Sinne weniger Medium der Repräsentation als Medium der Transaktion. Es etabliert eine ökonomische Beziehung zwischen unter-schiedlichen Akteuren und stellt ein Tauschobjekt zur Stabilisierung einer Tauschbeziehung dar.
Selfies können heute überall aufgenommen, umgehend bearbeitet und verbreitet werden. Selfies können damit als ein Paradigma einer technologischen Beschleunigung von Bildern angesehen werden. Die technologischen Mittel und die Voraussetzungen zur leichten Verbreitung werden oft als eine Steigerung von Autonomie- und Authentizitätschancen wahrgenommen. Ist diese scheinbare Demokratisierung der Lebenswelt aber nicht einer Ökonomisierung des Lebens unterworfen? Und wenn ja, welche Konsequenzen hat diese für die Lebensführung und das Selbstverständnis des Einzelnen?
Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass die technischen Infrastrukturen einer andauernden Echtzeit-Kommunikation und maximierten Verbreitung massiv in unsere lebensweltlichen Beziehungen eingreifen. Sie verändern die Raum- und Zeiterfahrung unserer Selbstwahrnehmung, die wir als beschleunigt und flüchtig erfahren. Wer heute seine Identitätsentwürfe und Rollenrepertoires kontrollieren möchte, muss bereit sein, dies in einer erhöhten technologischen und sozialen Beschleunigung zu tun. Die technologische Beschleunigung sorgt dafür, dass wir andauernd Bilder machen können und andauernd über Bilder verfügen können. Wir können auch andauernd Bilder reproduzieren, weiterleiten, mit neuen Inhalten verbinden und in der Öffentlichkeit verbreiten. Die soziale Beschleunigung der Identitätsentwürfe lässt sich daran ablesen, dass Selfies nicht auf eine feststehende, stabile Identität verweisen, sondern mit Selbstbildern als einem «Probehandeln» experimentieren. Damit verkleinert sich für die Selfie-Generation die Gegenwartserfahrung; das Selfie steht für das Momenthafte, Situative, Spontane. Das Selfie entspringt aus der Situation, die das Selbst überformt und für das Selbst keine klar erkennbare Handlungsorientierung bereithält. Dieses Fehlen einer stabilen Handlungsorientierung ist nicht nur sozial, sondern auch technologisch begründet, denn Selfies können unverzüglich übertragen werden, aus dem Moment spontan erfahrener Lebenswirklichkeit in die Welt der sozialen Netzwerke.
Werden Selfies sozial geteilt, dann werden sie einer Quantifizierungslogik unterworfen, denn sie werden innerhalb der sozialen Netze bewertet: Selfies sind heute untrennbar verbunden mit Feedbacksystemen, Leistungsvergleichen, Qualitätsrankings, flexiblen Prozesssteuerungen, Selbsterfahrungskatalysatoren oder Zufriedenheitsmessungen. Dies führt dazu, dass Selfies von einem andauernden Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitsverlust bedroht sind. Diese Bedrohung durch eine rein passive Wahrnehmung, d.h. eine nicht messbare Aufmerksamkeit, führt dazu, dass Selfies andauernd unter Wahrnehmungsdruck stehen; sie sind dadurch nicht nur in eine Beschleunigungsspirale, sondern auch in eine Steigerungsdynamik eingebunden. Beides prägt das Bild handeln aller Beteiligten: Die Produzenten der Selfies versuchen nicht nur, Bilder so zu gestalten, dass sie auf den Bildermärkten erfolgsversprechend sind, sondern sie etablieren auch Gabebeziehungen mit anderen Nutzern, um mit dem Aufbau von Gabe-Gegengabe-Beziehungen («Likes für Likes») eine planbare und verlässliche Aufmerksamkeitszukunft herzustellen.
Die Verbreitungslogik der Selfies folgt also der wettbewerbsförmigen Organisation der spätmodernen Gesellschaft, in der der Einzelne andauernd um Status und Anerkennung kämpfen muss. Die mit den Bildinhalten eng verknüpften Verfahren des Feedbacks und der Evaluation schreiben eine Wettbewerbslogik in die Bilder ein, die letztlich zu einer konkurrenzförmigen Dynamisierung sämtlicher Bildpraktiken führt und einen Steigerungszwang von mehr gelebter Selbstverwirklichung nach sich zieht. Die konkurrenzförmige Verbreitung von Selfies beeinflusst die individuellen Autonomie- und Authentizitätsentwürfe, die nicht ein für alle Mal gegeben und feststehend, sondern fluide und temporär erscheinen und immer wieder neu unter Beweis gestellt werden müssen.
In diesem Sinne gehören auch die Gesichtsrepräsentationen der Selfies zu den neuen Leitbildern der Gegenwartsgesellschaft. Sie sind nicht nur Ausdruck persönlicher Selbstdarstellung, sondern verkörpern als visuelles Kollektivmedium das Selbstverständnis von Gesellschaften. Sie sind also immer auch mehr als nur private und intime Selbstentblössungen, sie sind ein Spiegel von sozialem Wandel und kulturellen Entwicklungen.
Ramón Reichert ist Kultur- und Medientheoretiker.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Drei Fragen an Andreas Homoki

Dieser Artiekl erschien im Juni 2018.
Herr Homoki, am 24. Juni hat Claudio Monteverdis L’incoronazione di Poppea Premiere. Nach welchen Kriterien haben Sie das künstlerische Team für dieses Werk ausgewählt?
Die Frage klingt so, als ob man auf der Suche nach einer Besetzung eine konkrete Jobbeschreibung im Kopf hätte, aber so funktioniert es ja nicht. Wenn man einem Team einen Titel anvertraut, ist das immer auch eine intuitive Entscheidung. Ich bin überzeugt, dass eine frühe Oper wie Poppea in ihrer offenen Form und ihrer Rollenvielfalt unserem Regisseur Calixto Bieito sehr entgegenkommt. Eine seiner Stärken liegt darin, mit dem zu arbeiten, was charakterstarke Sänger in eine Produktion einbringen. Er entwirft keine Figurenkonzepte am Reissbrett, sondern bringt die Sänger dazu, mit ihren spezifischen Möglichkeiten das darzustellen, worum es geht. Und ich denke, dass das mit Monteverdi ideal zusammengeht, weil dessen Gesangsstil noch eng an die Sprache angelehnt ist, eine grosse Natürlichkeit in der Diktion erfordert und die Musik deshalb per se ganz nahe an den Darstellern dran ist. Aber natürlich liegen Bieito auch die Themen Macht, Erotik, Eitelkeit und Amoral, um die es in der Oper geht. An unserem Dirigenten Ottavio Dantone wiederum schätze ich, dass er auf der einen Seite sehr gewissenhaft mit den historischen Quellen arbeitet, aber auf der anderen Seite der Musik Freiheit gibt. Das Spekulative, das der Beschäftigung mit der Alten Musik immer innewohnt, kann ja auch zu ideologischer Verhärtung und Manierismus führen. Ottavio aber nimmt die Informationen aus der Entstehungszeit der Werke ernst und setzt sie um in lebendige Musik für heute! Darum muss es meiner Meinung nach im Umgang mit Alter Musik immer gehen.
In seiner Inszenierung von B. A. Zimmermanns Soldaten hatte Bieito das riesige Orchester auf der Bühne platziert. Geht es jetzt auch wieder in eine ähnliche Richtung?
Calixto und seine Bühnenbildnerin Rebecca Ringst hatten für Poppea die Idee, um das Orchesterensemble herum zu spielen auf einer Art Laufsteg als Plattform der Eitelkeiten und der Selbstverliebtheit. MonteverdiOpern sind ja in ihrem Charakter sehr intim und kammermusikalisch, und das Bühnenbild trägt dem Rechnung. Es schafft Nähe zum Zuschauer, aber auch Nähe zwischen den Sängern und den Musikern. Das Konzept war jedoch mit einigen technischen Probleme verbunden, denn von den oberen Rängen ist der Orchestergraben in unserem Haus nicht auf allen Plätzen einsehbar, wir mussten Ersatzplätze schaffen. Das Poppea-Team hat deshalb eine Zuschauertribüne auf die Bühne gebaut. Wir werden also eine sehr ungewöhnliche Verschränkung von Musikern, Sängern und Publikum erleben, zumal Calixto wieder sehr stark mit LiveVideo arbeitet.
Poppea ist die letzte Premiere dieser Spielzeit. Können Sie schon ein Résumé der Saison wagen?
Ich finde, sie fügt sich sehr schön in das Gesamtbild unserer Arbeit ein. Man hat – hoffentlich! – wieder die Seriosität und die Sorgfalt gespürt, mit der wir jede Premiere vorbereiten. In ihrer stilistischen Vielseitigkeit sticht die Saison für mich allerdings besonders hervor. Die Abfolge der Neuproduktionen war extrem kontrastreich, von Jewgeni Onegin bis Mahagonny, von Madama Butterfly bis Idomeneo, von der HolligerUraufführung über einen grosskalibrigen Verdi zurück zu den Anfängen der Oper. Hinzu kommen die grossartigen Sachen, die im Ballett gelaufen sind. Ich bin stolz darauf, dass das Haus dazu in der Lage ist, eine derartige stilsitische Bandbreite mit grösster Kompetenz auf die Bühne zu bringen. Das ist alles andere als selbstverständlich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Ein Tag mit dem Selfie-Stick
Julie Fuchs, Deanna Breiwick, Delphine Galou und Nahuel Di Pierro haben einen Tag lang vor, während und nach den Proben im Juni 2018 zu «L'incoronazione di Poppea» ihren Alltag als Sänger*in mit einem Selfie-Stick dokumentiert.
Portrait

Dieser Artikel erschien im Juni 2018.
Eigentlich war alles ganz anders geplant. David Hansen wollte im Juni und Juli ein paar Konzerte singen und die rare Freizeit zwischen den Konzerten bei seiner Frau und seiner fast zweijährigen Tochter zuhause in Oslo verbringen. Deshalb fiel ihm die Entscheidung nicht leicht, als das Telefon klingelte und das Opernhaus Zürich ihn fragte, ob er für seinen erkrankten Kollegen Valer Sabadus einspringen könnte, der die Rolle des Nerone in L’incoronazione di Poppea hätte singen sollen.
Dass David Hansen zusagte, kurz nach Probenbeginn nach Zürich zu kommen und die Rolle zu übernehmen, hat auch etwas mit Calixto Bieito zu tun: David hat einige Inszenierungen von Bieito in Oslo gesehen und von vielen SängerFreunden gehört, dass er eine Chance, mit diesem Regisseur zu arbeiten, unbedingt wahrnehmen müsse. Und natürlich hat auch die Rolle selbst Davids Entscheidung begünstigt: Nerone sei seine Lieblingspartie, sagt er, hier in Zürich ist es bereits das vierte Mal, dass er diese Partie singt. Rollen wie Händels Giulio Cesare langweilten ihn eher, obwohl die Musik natürlich grossartig sei; aber «perfekte, heroische Charaktere» findet er im Theater unglaubwürdig. Da ist Monteverdis Nerone schon ein ganz anderes Kaliber. Diesen verrückten, grausamen römischen Kaiser auf der Bühne zu verkörpern, ist für David eine grossartige Herausforderung. «Nerone kann mit Poppea äusserst zärtlich sein – und im nächsten Moment unglaublich böse. Diese Unberechenbarkeit, die vielen unterschiedlichen, extremen Dimensionen der Figur – das interessiert mich!»
Mit dem historischen Nero hat sich David Hansen intensiv beschäftigt – und nicht schlecht gestaunt, als er herausfand, dass Nero nicht nur als 12 oder 13Jähriger mit seiner Mutter Agrippina geschlafen, sondern diese später auch noch ermordet hat. Besonders fasziniert hat ihn Neros Selbstmord: Als der Kaiser damit rechnen musste, demnächst umgebracht zu werden und keinen anderen Ausweg mehr sah, nahm er ein Messer und stach sich selbst ins Auge. Eine Figur wie geschaffen für die Bühne, meint David: «Weshalb gehen wir in die Oper? Wegen der fantastischen Musik, klar. Aber auch wegen der Geschichten, die hier erzählt werden. Poppea ist eine der besten Geschichten des gesamten Opernrepertoires. Noch dazu beruht sie auf Tatsachen! Wir wollen doch auf der Bühne nicht das sehen, was wir aus dem alltäglichen Leben ohnehin schon kennen – wir wollen Extreme sehen, Menschen, die Grenzen überschreiten.» Nero sei, so meint David Hansen, nicht einfach nur aus sich selbst heraus so grausam gewesen; auch die Umstände hätten ihn zu dem gemacht, der er war. «Ich hätte nicht Nero sein wollen – aber ihn auf der Bühne darzustellen, finde ich grossartig!»
Für das Opernhaus war es jedenfalls ein grosses Glück, dass David Hansen sich entschieden hat, die Partie kurzfristig zu übernehmen. Er beherrscht nicht nur die virtuose, koloraturenreiche und extrem hoch liegende Partie wie kaum ein anderer, er hat auf der Bühne auch genau die Energie, die man für diese Figur braucht. Kaum in Zürich angekommen, stürzte er sich in die Proben – und rutschte gleich in seiner ersten Szene vor Poppea auf dem Bauch eine Treppe hinunter. «You gave me the best entrance I’ve ever had», sagte er daraufhin zu Calixto Bieito – Du hast mir den besten Auftritt gegeben, den ich je hatte. Alles wirkt vollkommen selbstverständlich und natürlich, wenn er es spielt – egal, ob es eine erotische Szene mit Poppea ist oder ein Wutausbruch gegen Seneca. Oder die Liebesszene mit Lucano – «no problem». Schliesslich hat auch der historische Nero sowohl Frauen als auch Männer geliebt. Die grösste Herausforderung für ihn sei es, so sagt David, sich seine Kraft gut einzuteilen. Denn Nero ist sehr oft sehr wütend – und muss entsprechend laut singen. David hat genau diesen kraftvollen, in der Oper oft «Peng» genannten Ansatz in der Stimme, den er für diese Wutausbrüche braucht. Die Kunst ist es, so ökonomisch damit umzugehen, dass am Schluss der Oper im berühmten Duett mit Poppea, «Pur ti miro», auf das alle MonteverdiKenner warten, die Stimme noch schön klingt.
Wie gefällt ihm nun die Arbeit mit Calixto Bieito, haben seine Kollegen ihm zu viel versprochen? Nein, die Proben machten ihm grossen Spass, sagt David. «Das Besondere ist, dass Calixto die Rollen mit uns Sängern gemeinsam entwickelt. Er kommt nicht mit einer festen Vorstellung von einer Rolle, in die wir unbedingt hineinpassen müssen. Jeder und jede von uns hat ja etwas anderes anzubieten. Und Calixtos grosse Qualität ist es, aus jedem von uns das Beste herauszuholen. Wenn wir alle an das glauben, was wir tun, und uns zu 100 Prozent damit identifizieren, weil wir es selbst mit entwickelt haben, wird die Show funktionieren.»
Ottavio Dantone kennt und schätzt David Hansen schon aus einer anderen Zusammenarbeit, dem Messiah in Australien, Davids Heimatland. «Für das italienische Repertoire ist Ottavio einfach perfekt», sagt er. «Er nimmt ein fantastisches Tempo für das Schlussduett: Es fliesst und ist trotzdem sexy, und es entspricht zudem noch dem Tempo im ersten Duett von Nerone und Poppea. Die Beziehung der beiden hat sich im Vergleich zum Beginn des Stückes natürlich geändert; trotzdem gefällt es mir sehr, wenn wir mit dem SchlussDuett einen Bogen zum Anfang schlagen.»
Vielleicht klingt diese merkwürdige hohe Stimmlage, in der Nerone singt, bei David Hansen auch deshalb so natürlich, weil er bereits mit 15 Jahren entdeckte, dass er ein Countertenor ist. Genauer gesagt, die Eltern seiner Freunde haben das entdeckt, die waren nämlich Opernsänger. Davids Sprechstimme hat sich durch den Stimmbruch verändert, die Singstimme blieb jedoch genauso hoch wie im Kinderchor. Durch diese Entdeckung habe sich sein Leben radikal verändert, erzählt David Hansen; Musik hat zwar schon immer eine wichtige Rolle in seinem Leben gespielt – er spielte auch Geige, Bratsche und Klavier –, aber sein Hauptinteresse als Teenager galt doch eher dem Surfen und den Mädchen. War es da nicht ein bisschen seltsam, plötzlich Countertenor zu sein und intensiv Gesangsunterricht zu nehmen? Ganz und gar nicht, meint David; er habe immer schon sehr viel mehr Bratschenwitze gehört als dumme Sprüche über seine hohe Singstimme.
Nach Oslo kam er wegen seiner Frau, sie ist Norwegerin und SoloHarfenistin im Orchester der Oper. Aber eine Beziehung zum Norden Europas gab es in der Familie schon vorher: Davids Vater ist als Däne nach Australien ausgewandert, wie der Name Hansen schon ahnen lässt. Ein grosses Vorbild sei für ihn die schwedische Mezzosopranistin Malena Ernmann, die vor einigen Jahren hier in Zürich als Ruggiero zu hören war. Vorbild ist sie für ihn nicht nur als Künstlerin, sondern auch und vor allem als Mensch: «In diesem Business kann der Hunger nach Berühmtheit das ganze Leben bestimmen. Bei Malena ist das anders, sie ist sehr bescheiden. Privat ist sie ein Familienmensch, doch sobald sie die Bühne betritt, ist sie ein Bühnentier.»
Auch für David ist die Familie ein wichtiger Teil seines Lebens. Deshalb hatte er ja auch gezögert, den Nerone in Zürich anzunehmen. Denn nach dem Sommer kommen acht lange Monate, in denen er nur unterwegs sein und von einem Opernhaus zum anderen reisen wird. Er muss diese Zeit ausnutzen, meint er; nicht wegen des Geldes oder fürs Prestige, sondern weil er nicht weiss, wie lange er diese extrem hohen Rollen noch singen kann. «Es gibt nicht viele hohe Countertenöre, die länger als bis Mitte Vierzig diese Rollen singen; mit zunehmendem Alter senkt sich die Stimme. Allerdings sitzt meine Stimme noch eine Quint höher als die Stimmen der meisten anderen Countertenöre; vielleicht habe ich also Glück und kann den Nerone noch etwas länger singen.» Wir hoffen es sehr.
Text von Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Gespräch

Dieser Artikel erschien im Juni 2018.
Ottavio Dantone, Sie haben lange Zeit darauf verzichtet, Monteverdi zu dirigieren; erst vor zwei Jahren mit einer Aufführung des Orfeo in Lausanne sind Sie wieder zu diesem Komponisten zurückgekehrt. Was war der Grund dafür?
Als ich vor 15 Jahren an verschiedenen italienischen Theatern alle drei MonteverdiOpern einstudierte, war ich sehr unzufrieden mit dem Resultat. So sehr, dass ich nie wieder Monteverdi machen wollte. Ich empfand es damals als sehr schwierig, den Sängerinnen und Sängern zu vermitteln, was die Essenz der Musik Monteverdis ist: das recitar cantando nämlich, das «singende Sprechen» oder «sprechende Singen», das sowohl auf dem Rhythmus des Sprechtheaters basiert als auch auf dem Rhythmus der Musik. Meiner Meinung nach geht der Rhythmus, den Monteverdi für die Gesangsstimmen geschrieben hat, auf den Rhythmus der gesprochenen Sprache im Sprechtheater der damaligen Zeit zurück. Dieser Rhythmus ist zwar in den Noten ausgeschrieben; das recitar cantando sollte – innerhalb gewisser rhythmischer Grenzen – sehr frei wirken. Das scheint ganz einfach zu sein. Aber es gelang keinem der Sängerinnen und Sänger, mit denen ich damals zu tun hatte. Entweder war es zu frei, oder es war zu sehr das, was in den Noten stand. Inzwischen habe ich viel mehr Erfahrung sowohl mit der Musik des Barock als auch in der Arbeit mit Sängern und dachte, vielleicht gelingt es mir nun besser, zu vermitteln, worum es geht. Meine eigene Interpretation interessiert mich dabei übrigens überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist, die Emotionen zu erzeugen, die für eine lebendige Aufführung nötig sind.
Wenn man als Dirigent eine Neuproduktion von Monteverdis Poppea vorbereitet, gilt es zunächst, einige grundlegende Entscheidungen zu treffen, vor allem die, welche Fassung man für die Aufführung verwenden möchte: Das Originalmanuskript der Oper ist verschollen, es existieren nur zwei Abschriften, die sich jedoch stark voneinander unterscheiden. Wie sind Sie vorgegangen?
Das Manuskript aus Neapel scheint eine Bearbeitung des Manuskripts aus Venedig zu sein, das wiederum eine Abschrift des Originals ist. Für mich liegt die Wahrheit in der Mitte. Zu Monteverdis Zeit war es normal, dass Kopien oder Abschriften Unterschiede aufwiesen gegenüber dem Originalmanuskript. Man hat die Partitur an die Gegebenheiten der jeweiligen Aufführung angepasst – sei es, weil man andere Sängerinnen und Sänger zur Verfügung hatte, sei es, weil die Orchesterbesetzung eine andere war oder man an einem anderen Ort einen anderen musikalischen Stil bevorzugte. So sind die Ritornelle für Orchester im Manuskript aus Neapel vierstimmig, im Manuskript aus Venedig aber nur dreistimmig. In beiden Versionen haben die Ritornelle die gleiche harmonische Basis, nur die Instrumentierung ist anders. Für mich besteht die musikwissenschaftliche Arbeit nicht darin, auszuwählen, welches Manuskript das richtige ist. Das ist nicht die Musikwissenschaft. Denn ebendiese Musikwissenschaft sagt ja, dass kein gültiges Manuskript existiert. Im 17. Jahrhundert, aber auch im 18. und bis ins 19. Jahrhundert unterschieden sich verschiedene Aufführungen des selben Stückes stark voneinander. Ich habe mich entschieden, eine Fassung zu spielen, die vom venezianischen Manuskript ausgeht – mit den Änderungen, die für unsere Besetzung notwendig sind. So verwenden wir zum Beispiel die vierstimmigen Ritornelle aus Neapel, denn hier am Opernhaus Zürich haben wir das volle Orchester zur Verfügung, mit allen Streichern und Bläsern.
Man dachte also zu Monteverdis Zeit theaterpraktisch?
Ja, und entsprechend besteht für mich die philologische Arbeit darin, den richtigen Ausdruck, die richtige Sprache für unsere Aufführung zu finden. Die Basis dafür ist nicht irgendein Original, das es sowieso nicht gibt, sondern der Versuch, zu verstehen, wie Monteverdi und seine Zeitgenossen gedacht haben, auf rhetorischer und auf psychologischer Ebene, und wie Emotionen erzeugt wurden.
Auch in Bezug auf die Instrumente, die Monteverdi für seine Poppea verwendet hat, gibt es keine gesicherten Informationen, Sie müssen also als Dirigent selbst entscheiden, wie das Orchester zusammengesetzt ist.
In seiner Orfeo-Partitur von 1607 listet Monteverdi alle Instrumente auf, die er damals verwendet hat. Das war übrigens eine grosse Ausnahme; zu Beginn des 17. Jahrhunderts schrieb niemand die Instrumentation aus, in den Noten findet sich normalerweise lediglich der Basso continuo. Die Instrumentation des Orfeo kann uns als Inspiration dienen – es ist aber keine Wahrheit, an die man sich sklavisch halten müsste. Wir wissen dadurch immerhin, dass Monteverdi viele «mystische» Instrumente wie Cornetti, Trombe, Posaunen, Harfen, Flöten, Clavicembali, Theorben verwendet hat – also eine sehr reiche Instrumentation bevorzugte. Die Zusammensetzung des Orchesters hing von der Grösse des Saales ab und vom Platz, der für das Orchester zur Verfügungstand (das übrigens niemals im Graben sass, sondern immer auf der Bühne) und natürlich von den Klangfarben, die man erzeugen wollte. Für Poppea habe ich entschieden, keine Posaunen zu benutzen, denn diese wurden normalerweise für Situationen verwendet, die in der Unterwelt spielten. Aber ich habe versucht, möglichst viele verschiedene Klangfarben zur Verfügung zu haben. In unserem Orchester gibt es Cornetti, Violinen und Flöten, und im Basso continuo Harfe, Theorbe, Laute, Gitarre, zwei Cembai, Orgel, Viola da gamba und Violone, also ein Kontrabass mit fünf Saiten. Damit habe ich die Möglichkeit, jede theatralische Situation musikalisch zu kommentieren.
Verwenden Sie für die Begleitung der Figuren jeweils unterschiedliche Instrumente?
In einer komischen oder grotesken Situation verwende ich das Dulcian, einen Vorgänger des Fagotts. Wenn ich dagegen Seneca begleite, verwende ich eher die Orgel und den Kontrabass. Wenn Helligkeit und Weichheit gefragt sind – zum Beispiel für Amore –, spielen Harfe und vielleicht eher die Laute statt der Theorbe, die viel tiefer klingt. Wenn ich Rhythmus und Swing möchte, spielt die Gitarre. Es geht dabei nie um meinen persönlichen Geschmack, sondern darum, die ursprüngliche Idee des Stückes wiederherzustellen. Ich kann jede Entscheidung, die ich in Bezug auf die Instrumentation getroffen habe, in jedem einzelnen Takt genau begründen. Ich bediene mich einer wissenschaftlichen Herangehensweise, um grösstmögliche Natürlichkeit, grösstmögliche Freiheit zu erreichen.
Mit welchen Instrumenten begleiten Sie den verrückten Kaiser Nero?
Das ist ganz von der jeweiligen theatralen Situation abhängig. Es gibt Momente, in denen Nero zwar verrückt, aber zärtlich ist. Dann wird er auch entsprechend mit zarten Instrumenten begleitet. Wenn dagegen seine Verrücktheit im Vordergrund steht, wird auch die Auswahl der Instrumente entsprechend ausfallen. So ist es bei allen Figuren des Stücks, es ist immer abhängig von der Bühne, von der Situation.
Die musikalische Interpretation ist also in diesem Fall eine sehr kreative Arbeit?
Ja, wobei ein Teil dieser Arbeit immer spekulativ bleibt.
Neben der Instrumentation ist auch die Besetzung der Singstimmen nicht einfach zu entscheiden; Nero zum Beispiel wird in manchen Aufführungen von einer Frau oder sogar von einem Tenor gesungen; bei uns ist es David Hansen, ein Countertenor, der sehr hoch singen muss.
Wir wissen, dass zu Monteverdis Zeit die Kastraten die am häufigsten verwendeten Sänger waren. Heute gibt es keine Kastraten mehr, das ist das Hauptproblem, wenn wir diese Musik aufführen wollen. Es gibt natürlich KastratenRollen, die von Männerstimmen gesungen werden könnten. Nero gehört nicht dazu. Ihn mit einem Tenor zu besetzen, ginge vollkommen an der Idee Monteverdis vorbei. Denn der musikdramatische Grund dafür, dass er so hoch singt, liegt in der Figur, die etwas Verrücktes, Hysterisches hat. Diese Rolle liegt sehr hoch, das ist sehr anstrengend für einen Countertenor – aber genau um diesen angespannten, angestrengten Effekt geht es! Ottone dagegen singt bei uns eine Frau, Delphine Galou, denn diese Rolle wiederum liegt für einen Countertenor sehr tief, für einen Contralto dagegen genau richtig – obwohl die Figur natürlich ein Mann sein müsste. Aber ein Contralto, also eine sehr tiefe Frauenstimme – diese Stimmlage ist übrigens sehr selten – hat immer etwas Androgynes. Man muss dazu auch sagen, dass es in der Zeit Monteverdis durchaus üblich war, dass Frauen Männerrollen sangen und umgekehrt. Das Spiel mit der Ambiguität war sehr beliebt. Johann Adolph Hasse hat eine Oper komponiert, Marc Antonio e Cleopatra, in der es nur zwei Figuren gibt; Marc Antonio wurde von einer Frau gesungen, Cleopatra von einem Mann! In Poppea sind die beiden Ammen, Arnalta und Nutrice, auch Männer, allerdings keine Kastraten, sondern sogenannte HautContres, also sehr hohe Tenöre. Unsere Besetzung weist eine sehr grosse Vielfalt an Timbres auf; diese starken Kontraste sind natürlich bereits im Stück selbst angelegt.
Poppea ist ja 1642/43 nicht für ein höfisches Theater komponiert worden, sondern für das erste öffentliche Theater in Venedig; die Oper musste sich also gut verkaufen. Hat dieser Umstand Monteverdis Art und Weise zu komponieren beeinflusst?
Das glaube ich nicht. Monteverdis Stil ist grundsätzlich sehr theatralisch. Man weiss ja übrigens heute, dass das Stück gar nicht zur Gänze von Monteverdi geschrieben wurde. Es ist ein Pasticcio, wahrscheinlich von mehreren Autoren. Aber wer auch immer es komponiert hat, war ein Genie in Bezug auf Musikdramatik. Es gibt frühere Opern, die für höfische Theater komponiert wurden und in gewisser Weise musikalisch raffinierter sind. Orfeo und Poppea unterscheiden sich stark – Poppea ist sehr viel ex pressiver, man könnte sogar sagen, extrovertierter angelegt. Allerdings liegen zwischen Orfeo und Poppea auch 30 Jahre. Opern von Monteverdi aus der Zeit zwischen den beiden Werken sind – abgesehen von Il ritorno d’Ulisse in patria – nicht erhalten. Natürlich hat sich Monteverdis Art zu komponieren in diesen 30 Jahren weiterentwickelt, auch das Theater insgesamt hat sich weiterent wickelt, und Monteverdi hat mit der Zeit gelernt, die Herzen aller Zuschauer zu erreichen, nicht nur diejenigen mit einer musikalischen Bildung. In Poppea gibt es ja keinerlei allegorische Figuren, in denen sich ein Herrscher hätte spiegeln müssen; es ist eine pseudohistorische Geschichte über Liebe, Erotik, Verrat und Tod, die für jeden verständlich ist. Sowohl in Poppea als auch in Ulisse spürt man sehr stark, dass der visuelle, theatralische, dramatische Aspekt immer mitgedacht wurde. Es ist sehr beeindruckend, dass gleich eine der ersten Opern überhaupt dramaturgisch und theatralisch so gut funktioniert.
Besonders bemerkenswert an dieser Geschichte ist, dass sie keine Moral hat – Poppea geht im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen, wird am Ende aber mit der Krone belohnt …
Am Ende siegt die Liebe. Die Oper erzählt nicht, dass Poppea später von Nero ermordet wurde. Das damalige Publikum wusste das natürlich. Aber es war normal, historische Fakten für die Oper so zu verändern, dass ein «lieto fine», ein Happy End, möglich wurde; das war einfach die Konvention. In der Oper wird der Ehebruch Neros und schliesslich die Trennung von seiner Frau Ottavia verhandelt; ausserdem geht es um Verrat; Neros Lehrer, der Philosoph Seneca, wird zum Selbstmord gezwungen; es wird gesagt, dass der Herrscher ein Dieb ist. Das ist alles ziemlich krass, regelrecht zynisch. Es zeigt die Realität so, wie sie zu Monteverdis Zeit in Italien anzutreffen war. Diese Amoralität ist das Überraschendste an diesem Libretto …
… und kommt uns heute unglaublich modern vor. Welches sind die faszinierendsten Momente in «Poppea»?
Da gibt es mehrere. Zunächst der erste Auftritt von Poppea und Nerone, der unglaublich erotisch ist. Die Partie der Poppea liegt hier für eine Sopranstimme sehr tief, es ist eigentlich mehr ein Hauch gemeint als Gesang. Man spürt in der Musik, dass hier zwei Menschen auf der Bühne stehen, die direkt aus dem Bett kommen. Überhaupt ist Poppea eine sehr erotische Figur. Ihre erste Szene wird auch dadurch noch wirkungsvoller, dass sie in heftigem Kontrast steht zur vorhergehenden Szene mit Ottone, ihrem ehemaligen Liebhaber, der noch immer in sie verliebt ist und vor ihrem Balkon voller Sehnsucht auf sie wartet; er muss schliesslich erkennen, dass Nero gerade bei ihr ist. Auch eine Szene Ottones finde ich sehr poetisch: Er plant später im Stück, Poppea zu ermorden, und sagt an dieser Stelle: Ich werde verbannt sein, aber im Paradies. Dazu erklingt eine fantastische Musik. Auch der Tod Senecas ist sehr berührend. Und das letzte Duett von Poppea und Nero, mit dem die Oper endet, ist ein regelrechter Pop-Song. Es ist für mich wie ein Lied von den Beatles, geschrieben für ein grosses Publikum. Ein bisschen auch wie die Filmmusik von Ennio Morricone – absolut perfekt in ihrer Einfachheit.
Ausgerechnet dieses wundervolle Duett allerdings stammt gar nicht von Monteverdi …
… nein, das hat wohl Benedetto Ferrari geschrieben. Für eine Musik wie diese braucht man kein Genie zu sein. Es gibt Millionen ähnlicher Stücke aus der Zeit – eine einfache Ciaccona, die auf einem Basso ostinato beruht. Faszinierend sind die Harmonien, die durch die ausgehaltenen Noten von Poppea und Nerone entstehen und eine unglaubliche Spannung erzeugen. Dass die Oper mit einem so zarten Duett und nicht mit einem fröhlichen Chor oder einer tänzerischen Sinfonie aufhört, ist übrigens für die Zeit sehr ungewöhnlich und äusserst wirkungsvoll.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
«Sex & Crime & schöne Musik:
Das bietet Monteverdis L’incoronazione di Poppea. Am Zürcher Opernhaus kommen noch entfesselte Sänger dazu und ein Regisseur, der sie einzusetzen weiss.»
Tages-Anzeiger zur Premiere von «L'incoronazione di Poppea»
Volker Hagedorn trifft ...

Claudio Monteverdi
Ich bin ein paar Minuten zu früh. Draussen auf ihn warten? Oder drinnen schon Plätze sichern? Und wenn die Bottega del caffè schon voll ist, wie alle Stühle davor auf dem Campo dei Frari? Die Mai-Sonne knallt auf den Platz, die Touristenströme sind schütterer geworden, man sucht den Schatten. Oder den Markusplatz, nicht diese Ecke des Viertels San Polo. Nochmal auf den Zettel gucken, die Fragen! Idiotische Fragen, es war kaum Zeit zum Vorbereiten. Aber bei diesem Mann kämen sich wahrscheinlich selbst die Musikologen schlecht vorbereitet vor, die seine Musik erforscht haben.
Also rein! Lasciate ogni speranza… Alle Tische besetzt, keiner mit ihm. Bravo. «Professore!» Meint der mich? Ein Mann um die sechzig am Tischchen beim Fenster, rundlich, gemütlich, schelmisches Gesicht, offenes Hemd in Pink, ungewöhnlicher Bart: unter der Nase bis zu den Backen schwingend, überm Kinn ein schmaler Knebelbart, wie, nun ja, im früheren 17. Jahrhundert. Ich trete näher, er nennt meinen Namen, stellt sich vor: «Francesco Busenello, Avvocato, Rechtsanwalt, in Ihrer Sprache. Ich habe sie ein wenig studiert. Als ich Zeit hatte. Sehr viel Zeit …» Er lächelt verschmitzt. «Eccellenza!», sage ich, endlich ist der Groschen gefallen, «es ist mir eine Ehre, den Dichter…» Er hebt abwehrend die Hände. «Heute bin ich Ihr Übersetzer.»
Der Maestro lasse sich gern Zeit, immer noch, nach all den Jahren, «man musste ihn ständig zum Komponieren anhalten und die fertigen Teile aus den Händen reissen, und nach dem Mittagessen wollte er seine Ruhe haben …» Der Advokat, der Dichter, der Librettist kichert, dass ihm der Bauch wackelt. «Er ist immer noch so. Dabei hat er es nicht weit bis hier. Buona cioccolata!» Er hebt die von Sahne gekrönte Tasse zum Mund. «Rido, mentre mi porti un sì bel dono.» Oh je, das ist jetzt der Test. Das ist … Seneca? Er lächelt spitzbübisch. «Nun, was ich ihn sagen lasse. Lachend empfange ich solch edle Gabe … in Wirklichkeit trank er das Gift später, wir haben aus sieben Jahren einen Tag gemacht!» Er kichert wieder, ich schaue zum Tresen, man holt sich die Getränke wohl selbst; der Barista schaut zum Eingang und macht ein sonderbares Gesicht, als komme überraschend Staatsbesuch. Ein hochgewachsener älterer Herr in einem eleganten hellen Sommeranzug ist es, und während sein Anzug eher ans Jahr 1900 erinnert, ist der Bart … Busenello springt auf und strahlt. «Maestro!» Er reicht Monteverdi gerade bis zur Brust. Der beugt sich lächelnd herab und umarmt den Freund. Inzwischen bin ich auch aufgestanden. Die Leute im Café schauen herüber. Sie kennen ihn nicht, aber diese Erscheinung! Diese Matte von grauem Bart!
Normaler Händedruck, fest. Ich weiss nicht, wie man sich 1643 zu begrüssen hatte, aber die späteren Sitten scheinen ihn nicht zu irritieren, er bewegt sich so gelassen, als wäre er Stammgast. Als er sitzt, erscheint der Barista am Tisch, es geht also doch. Zwei Cappuccini. Ich habe ein Vakuum im Kopf, aber Busenello plaudert drauflos, ich verstehe «viola da brazzo», während er auf mich weist. Der Komponist blickt mich an und fragt, das verstehe ich, wer mein Instrument gebaut habe. Baritonal klingt er. «Es ist eine Kopie nach Gasparo da Salò», sage ich. «Da Salò! Egli era prodigioso», sagt er anerkennend. Er muss es ja wissen, er hat in Mantua als Bratscher angefangen, in der Kapelle der Familie Gonzaga.
Aber wir wollen ja nicht über Mantua reden. Wie viele Bratschen hat er bei Poppea eingesetzt? Drei? «Wo denken Sie hin?», antwortet Busenello an des Meisters Stelle. «Das Theater der Familie Grimano in Venedig war kein Hoftheater. Es war zuerst sogar nur eine Bretterbude. Piccola orchestra, o no?» Ihm würde es auch mit zwei Bratschen gefallen, meint Monteverdi, aber er erinnere sich nicht genau. «Ich war sehr krank nach einer langen Reise, soprafatto da una stravagante debolezza di forze, ich konnte auch vieles gar nicht selbst komponieren, wie Sie wissen.» «Pur ti miro», das Schluss-Duett aus Poppea? «Das hat Ferrari gemacht, sehr gut. Sehr modern.» Seine braunen Augen funkeln, und Busenello blickt plötzlich finster drein: «Aber der Text!» Zum ersten Mal höre ich Monteverdi lachen, er packt den Librettisten an der Schulter und redet begütigend. Der zieht ein uraltes Bändchen aus dem Jackett, blättert von hinten: «Hier, so habe ich es geschrieben, mit Venus und Amor am Schluss, wie es sich gehört.» So hat er selbst es 1656 drucken lassen in Delle hore ociose (Aus müssigen Stunden), fünf Libretti, davon vier für Cavalli. Hat Cavalli auch etwas zur Poppea beigetragen? «Die erste Sinfonia, und noch mehr…» Er betrachtet nachdenklich eine junge Frau, die ihm im Vorbeigehen zulächelt. «Anna Renzi…», sagt er. «Anna Renzi war auch so schön. Unsere Ottavia.» «Poppea sang besser» meint Busenello, «wegen Anna di Valerio wollten sie das Stück in Paris haben!»
«Da hätte die Truppe noch viel verdienen können. Hunderttausende von Scudi …» Was musste man denn bezahlen, im Grimani? «Oh, nicht viel», sagt Busenello, «vielleicht einen halben Scudo. Vier Lire. Soviel wie für eine puttana, eine Strassendirne. Das konnte jeder bezahlen.» Monteverdi runzelt die Stirn und rechnet ihm etwas vor. «Also gut, nicht jeder. Ein Arbeiter bekam vier Lire am Tag. Keiner von denen hat das für einen bolettino ausgegeben. Das Haus war trotzdem voll. Voll mit cortigiane!» Er lacht, und der Meister korrigiert: «Cortigiane oneste.» «Ja, natürlich. Die haben Poppea geliebt! Was ist sie denn anderes als eine Kurtisane!» Die Gemahlin von Ottone, dachte ich … Busenello zieht mit einem Finger sein rechtes Augenunterlid herab und blickt mich mitleidig an. «Sie werden doch bemerkt haben, dass Poppea sich gezielt nach oben schläft! Kaum ist sie mit Nero vom Laken gestiegen, stellt sie sich schon den königlichen Mantel vor, den sie tragen wird.» «Ma imaginario manto …», langsam und tief singt Monteverdi die Zeile und ergänzt nach kurzem Nachdenken: «Das könnte von mir sein.» Inzwischen verstehe ich ihn auch so. Aber Sie verurteilen Poppea nicht? «Niemanden. Die Gebräuche der Zeit, in der ich lebe …» «sind mir nicht fremd», vollendet Busenello das Zitat lächelnd. «Korruption bis ins Bett, politische Morde, Regierungen, die viele berauben, um die Taschen weniger zu füllen – lange her, nicht wahr?» Und Venedig sei ja fast harmlos gewesen, damals. «Jetzt macht die Geldgier die ganze Stadt kaputt. Diese Riesenschiffe!» «Man hätte weder sie noch die Brücke zum Land bauen sollen», sagt der Komponist. «Aber Ihr Markusdom steht noch, Maestro.» Er streicht sich ein Flöckchen Milchschaum vom Bart. «Haben Sie gehört, was da ge spielt wird, gesungen? Und hier gegenüber, die Scuola di San Rocco? «Schon besser. Nur hat uns auch San Rocco nicht helfen können, der Beschützer vor der Pest. Sie wissen, mein Freund Striggio …» Alessandro Striggio, Librettist des Orfeo, war eines von 45 000 Opfern hier, Sommer 1630. Sind Sie deswegen Priester geworden, im Jahr danach? «Auch deswegen.» Busenello blickt mich warnend an. Als wenn es mir in den Sinn käme, nach den Pfründen eines Geistlichen zu fragen. Er brauchte immer Geld für seine Söhne. Ich wage nicht zu fragen, ob er auch die mitunter trifft, wie den munteren Advokaten «Il tempo tutto frange», sagt der Meister unvermittelt, «die Zeit zerbricht alles. Heute lacht man, und dann, morgen, weint man.» Er blickt auf; die junge Dame von vorhin hat sich unserem Tisch genähert, leise spricht sie mit Busenello und zeigt auf ihr Smartphone. «Sie meint, Sie sähen einem berühmten Komponisten ähnlich! Nein, bitte, signora, kein Foto.»
Sie würde darauf nur einen deutschen Touristen mit drei leeren Tassen vor sich sehen. Wir stehen auf. «Seltsam, dass sie ihn erkannt hat! Normalerweise kann er sich in Italien frei bewegen. Nur nördlich der Alpen wird es schwierig», Busenello kichert wieder. «Sie spielen zu viel Monteverdi da oben!»
Claudio Monteverdi gibt eigentlich nie Interviews. Was daran liegt, dass der italienische Komponist schon 374 Jahre tot ist. Volker Hagedorn hat den Schöpfer von «L’incoronazione di Poppea» aber trotzdem in einem Café in Venedig getroffen samt seinem Librettisten Francesco Busenello. Wie kann das sein? Es muss an der Fantasie unseres Kolumnisten liegen und an der Tatsache, dass dieser neben seiner Journalistenprofession auch noch aktiver Musiker, nämlich Bratscher, ist.
Text von Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Dieser Artikel erschiem im Juni 2018.
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Ich komme aus dem kleinen Dorf in Südfrankreich, wo ich lebe. Dort habe ich gezwungenermassen ein paar freie Tage verbracht: Die Staatsoper Hamburg hat mein Rollendebüt als Pamina abgesagt, weil ich schwanger bin! Davor hatte ich eine sehr volle Saison mit Giunia in Madrid, Nannetta, Comtesse Adèle und Morgana in Paris.
Auf was freuen Sie sich in der «Poppea»-Produktion?
Ich freue mich auf meine erste Zusammenarbeit mit Calixto Bieito, noch dazu mit einer so starken Figur – Poppea ist eine Frau, die vor nichts Angst hat und ihre Sehnsüchte und Begierden auslebt. Diese Rolle ist ganz anders und viel dunkler als alle, die ich bisher gemacht habe, das finde ich toll. Auch auf die Arbeit mit Ottavio Dantone an Monteverdis fantastischer Musik freue ich mich; er liebt diese Musik und weiss genau, wie man sie am besten präsentiert.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Meine 12 Jahre als Geigerin haben mir die Liebe zur Musik beigebracht, aber auch Perfektion und Ausdauer. Im Schauspielunterricht habe ich gelernt, wie viel Vergnügen es macht, auf der Bühne zu stehen, und welche Kraft Theater haben kann. Als Mitglied eines europäischen Jugendchores durfte ich Europa entdecken und ein sehr vielfältiges Repertoire singen.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
Das Buch, das ich mit 14 Jahren angefangen habe zu schreiben. Alle anderen kann ich wieder kaufen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Heute ist es vielleicht Orfeo Chamàn von L’Arpeggiata und Christina Pluhar, morgen wird es etwas anderes sein.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Den Olivenbaum in meinem Garten.
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Vielleicht mit Rossini, das würde sicher Spass machen – ausserdem würde er sicher leckere Gerichte kochen. Mozart, weil ich ein Fan von ihm bin. Simone de Beauvoir, um mich von ihr inspirieren zu lassen, oder Picasso... Aber noch lieber würde ich eigentlich mit meinen Künstler-Freunden essen gehen; wir alle reisen so viel. So hätten wir endlich ein bisschen Zeit für einander und könnten gemeinsam über das verrückte Leben lachen, das wir führen.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Weil jeder Moment einzigartig ist, weil Musik überall sein kann, und weil es fast Sommer ist hier in Zürich!
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 60, Juni 2018.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
L'incoronazione di Poppea
Synopsis
L'incoronazione di Poppea
Prolog
Fortuna und Virtù streiten darum, wer die grösste Macht hat. Amor mischt sich ein. Noch heute will er beweisen, dass er der Mächtigste von allen sei: «Ihr werdet zugeben müssen, dass sich die Welt auf einen Wink von mir verändert.»
Erster Akt
Von Sehnsucht getrieben, ist Ottone auf dem Weg zu Poppea. Doch er muss erkennen, dass Poppea schon Besuch hat – Nerone ist bei ihr. Dessen Bodyguards beschweren sich über ihren Chef; er kümmert sich nicht um seine Pflichten und hat nur Augen für Poppea, der er völlig verfallen zu sein scheint. Nerone verabschiedet sich von Poppea. Solange er von seiner Frau Ottavia noch nicht getrennt ist, muss ihre Beziehung geheim bleiben. Poppeas Berater warnt sie eindringlich davor, sich auf Nerone zu verlassen. Die Welt der Mächtigen sei gefährlich. Doch Poppea ist sich ihrer Sache sicher. Ottavia weiss längst, dass Nerone sie mit Poppea betrügt, und verflucht die Treulosigkeit ihres Mannes. Ihr Berater schlägt ihr vor, sich ebenfalls einen Liebhaber zu nehmen. Ottavia reagiert äusserst gereizt. Auch der Philosoph Seneca ist ihr keine Hilfe. Valletto entlarvt Senecas Reden als eitle Selbstdarstellung voll von Doppelmoral. Nerone teilt Seneca mit, dass er seinen Willen durchsetzen und Poppea zu seiner Frau machen wird. Jedem, der ihm widerspricht, wird er die Zunge herausreissen. Poppea weiss, dass Seneca ihrem Plan, Nerones Frau und Kaiserin zu werden, im Weg steht, und verleumdet ihn Nerone gegenüber. Ausser sich vor Wut befiehlt Nerone Seneca, sich umzubringen. Ottone wirft Poppea Untreue vor. Poppea hat nur Verachtung für ihn übrig. Voller Verzweiflung wünscht Ottone Poppea den Tod. Ottones ehemalige Geliebte Drusilla hält, trotz seiner Leidenschaft für Poppea, noch immer zu ihm. Ottone versucht, sie und sich selbst von seiner wiederer wachten Liebe zu überzeugen.
Zweiter Akt
Seneca erhält den Befehl, sich selbst zu töten. Valletto hat einen erotischen Tagtraum. Nerone wird fast wahnsinnig vor Freude über Senecas Tod und seine nun endlich bevorstehende Hochzeit mit Poppea. Ottavia fordert Ottone auf, Poppea zu töten; falls er dazu nicht bereit sei, werde sie ihn der versuchten Vergewaltigung beschuldigen. In seiner Verzweiflung erzählt Ottone Drusilla von dem Mordplan und bittet sie, ihm dafür ihre Kleider zu leihen. Drusilla ist sofort dazu bereit. Poppea ist glücklich über den Tod Senecas. Von plötzlicher Müdigkeit übermannt, legt sie sich schlafen. Als Drusilla verkleidet, will Ottone Poppea töten. Amor kann den Mord verhindern.
Dritter Akt
Drusilla glaubt sich am Ziel ihrer Wünsche und hofft auf eine glückliche Zukunft mit Ottone. Doch sie wird festgenommen und des Mordversuchs an Poppea angeklagt. Obwohl unschuldig, gesteht sie alles, um Ottone zu schützen. Nun droht ihr die Todesstrafe. Als Ottone sieht, dass die unschuldige Drusilla gequält wird, gibt er sich als der Schuldige zu erkennen: Auf Befehl Ottavias hat er in Drusillas Kleidern versucht, Poppea umzubringen. Nerone begnadigt Ottone, schickt ihn aber ins Exil. Drusilla darf ihn begleiten. Nun kann Nerone Ottavia endlich verstossen und aus Rom verbannen. Verzweifelt verlässt Ottavia die Stadt. Poppeas Berater malt sich seinen gesellschaftlichen Aufstieg in den schillerndsten Farben aus. Poppea und Nerone heiraten; Poppea wird Kaiserin.