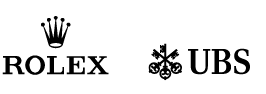Last Call
Musiktheater in drei Akten von Michael Pelzel (*1978)
Libretto von Dominik Riedo
Uraufführung
Dauer 1 Std. 20 Min. Keine Pause.
Die Studiobühne im dritten Untergeschoss des Opernhauses ist nur über 52 Treppenstufen erreichbar und somit für RollstuhlfahrerInnen nicht zugänglich.
Kompositionsauftrag von Opernhaus Zürich finanziert durch die 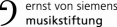
Mit freundlicher Unterstützung der Landis & Gyr Stiftung
Gut zu wissen
Gespräch

Michael, worum geht es in Last Call, dem Musiktheaterwerk, das du als Auftragswerk für das Opernhaus Zürich komponiert hast?
Ich habe den Stoff gemeinsam mit dem Schriftsteller Dominik Riedo entwickelt, er hat das Libretto geschrieben. Die Geschichte spielt in einer Zukunft, in der die Medien-Kommunikation der Menschen derart überhand genommen und sich verselbständigt hat, dass es zu einem Overkill gekommen ist. Nichts geht mehr. Die Menschen sind in ihrer Sprachfähigkeit völlig deformiert. Sie reden in einem merkwürdigem Fachchinesisch und absurden Jargons. Das ist die Ausgangssituation der Handlung. In Form einer grotesken Voting-Talkshow wird deshalb beschlossen, die Erde zu evakuieren, um die Kommunikationsfluten zu beruhigen. Die Menschheit wird in Raumschiffen auf einen anderen Planeten geflogen, aber ein Mann und eine Frau werden vergessen und bleiben als letzte Menschen auf der Erde zurück. In der grossen Stille nach dem Kommunikations-Wahnsinn kommen sie sich nahe.
Es gibt in dieser Oper einen verschrobenen Weltregierungschef, der sich Urguru nennt, einen schnellsprechenden Talkmaster namens Gottwitz, das schrille Partygirl Trendy-Sandy-Mandy und die vergleichsweise seriöse Professorin Frau Hahnemann. Schon an den Namen kann man erkennen, dass die Handlung eher karikaturhafte Züge hat.
Was mich an literarischen Stoffen immer fasziniert, ist eine Doppelbödigkeit, bei der man nicht mehr weiss, ob das Geschriebene ernst gemeint ist oder böse ironisch, und so etwas schwebte mir auch für meine Oper vor. Einer meiner Lieblingsschriftsteller ist der Schweizer Hermann Burger. Ich finde, er ist unerreicht darin, den Leser im Unklaren darüber zu lassen, ob etwas tragisch oder komisch ist, tiefgründig oder oberflächlich, skurril oder abgründig. Wenn ich mich in der Szene der zeitgenössischen Musik umschaue, stelle ich fest, dass sehr viele Werke für die Bühne geschrieben werden, die mit grossem Ernst die menschlichen Abgründe thematisieren. Die heissen dann «Koma» oder «Trauma», und da weiss ich schon beim Titel, dass es depressiv und traurig wird. Diese Themenwahl hat manchmal fast schon klischeehafte Züge in der zeitgenössischen Oper angenommen. Gerade bei weniger gut geschriebenen Werken führt das leicht in eine Oberflächlichkeit des Tiefgründigen. Das Abgründige und Tragisch-Dramatische der Stoffwahl kann in der Musik nicht eingelöst werden, weil der Komponist dafür gar nicht über die adäquaten musikalischen Mittel verfügt. Solche Stoffe könnte nur ein echtes Genie vertonen. In diese Tiefgründigkeitsfalle wollte ich mit meiner Oper nicht treten. Mich interessiert mehr das Tragikomische und das schräg Skurrile.
Der Regisseur deiner Uraufführung, der Videokünstler und Theatermacher Chris Kondek, nennt Last Call eine dystopische Science-Fiction-Comedy.
Das trifft es doch gar nicht schlecht. Ich hoffe, wir kriegen diesen Balanceakt zwischen Tragik und Komik hin, zwischen dem Ernst, der dem Stoff ja innewohnt, und der absurden Situation, zwischen Schein-Banalität und Hintersinn. Ich habe im Januar hier am Opernhaus György Ligetis Oper Le Grand Macabre gesehen. In diesem Stück wird genau das auf grossartige Weise eingelöst. Für mich ist Ligeti überhaupt ein grosses Vorbild. Die Kontraste, mit denen er arbeitet, die grellen Farben, die Gleichzeitigkeit verschiedener Metren, sein raffinierter Umgang mit Stilzitaten und -anklängen, es gibt vieles, das mich am Grand Macabre fasziniert.
Wie Ligeti bist du auch ein eigenwilliger Tüftler im Rhythmischen. Wo hat das bei dir seinen Ursprung?
Beispielsweise, indem ich irgendwann die Klavieretüden von Ligeti kennengelernt und studiert habe und sie in ihrem Formaufbau und ihrer Struktur für mich sehr inspirierend fand. Ausserdem habe ich vor einigen Jahren für drei Monate in Südafrika gelebt und dort afrikanische Instrumente zu spielen gelernt, sogenannte Akadindas und Amadindas, die mit unseren Marimbaphonen verwandt sind. Sie werden von zwei sich gegenüberstehenden Musikern in einem wahnsinnigen Tempo gespielt. Die löchrigen Rhythmen greifen wie Zahnräder ineinander. Diese spezielle Rhythmik hat mich extrem fasziniert. Die Patterns erwecken den Eindruck von Regelmässigkeit in der Grossform, sind aber asymmetrisch strukturiert. Es ist ein bisschen wie bei den Maschinen von Jean Tinguely. Die scheinen sich mit Regelmässigkeit zu bewegen, aber wenn man näher an sie herantritt, sind alle Bewegungen stotternd und asymmetrisch verkantet. Mit solchen «gelochten» Rhythmuspatterns arbeite ich auch, indem ich etwa an zwei Klavieren perforierte Quintolen und Sextolen übereinander spielen lasse.
Gibt es weitere Komponisten, die Vorbildcharakter für dich haben?
Einige Werke von Olivier Messiaen beeindrucken mich extrem, weil Messiaen etwas sehr Naives hat in seiner Art zu komponieren. In den strengsten, strukturkühlen Zeiten des Serialismus traute er sich, unverstellt naiv zu schreiben und wurde in der damaligen Avantgarde-Hochburg bei den legendären Darmstädter Ferienkursen dafür ausgelacht. Er hat ja teilweise gewagt, offene Dominantseptakkorde in der Begleitung zu verwenden und ihnen etwas sehr Feines, Leises und Elaboriertes hinzuzufügen. Bei Messiaen kommen verschiedene Stile zusammen, aber seine Musik wirkt interessanterweise gar nicht heterogen. Er schmilzt sie zu einem ganz eigenen Personalstil zusammen, das bewundere ich sehr. Auch seine Harmonik ist unglaublich eindrucksvoll.
Kannst du die Klangwelt, die du in Last Call entworfen hast, ein wenig beschreiben?
Im Vorspiel und im Monolog des Urguru in der ersten Szene etwa entwickle ich eine Klanglichkeit, die von Gongs, Plattenglocken, Vibraphon, Celesta und hohen Glöckchen geprägt ist – dunkel, düster, schwebend. Eine mysteriöse, lugubre Atmosphäre soll entstehen. Mir ging es dabei klanglich um ein Amalgam. Ich versuche auch Instrumente wie das Klavier oder Streicher einem gongähnlichen Klangidiom anzugleichen. Es ist ein bisschen wie in der Fusionsküche: Mehrere Aromen sollen sich zu einer Metaklangfarbe verbinden. Es folgt eine ironische, musicalhafte, exzentrische, farbige Talkshowszene. Ein Jingle, der an die Melodie der Sendung mit der Maus angelehnt ist, kommt darin vor; zwei Klaviere, die um einen Sechstelton verstimmt sind und durch gegenläufige Dynamik feine Glissandobewegungen erzeugen, dazu Schlagzeug und Singstimmen, die manchmal wie das amerikanische Jazz-Vokalensemble Manhattan Transfer klingen. Der zweite Akt ist dann ein Sturm in Form eines Bildergewitters. Chris Kondek spricht immer von einem Elektrosturm. In der Musik ist die Szene extrem sparsam nur mit rhythmischen Patterns skizziert, also eher ein Anti-Sturm. Aber die parallelen Video-Bilder erzeugen Momente von Unheimlichkeit und Bedrohlichkeit. Der dritte Akt ist dann wieder sehr elaboriert und feingliedrig, schwerelos, irreal. Hier kommt es, wenn man so will, zu einer Art Liebesgeschichte. Aber mit Worten ist das alles schwer zu beschreiben, man muss es hören und sehen.
Last Call ist das erste Werk, das du für das Musiktheater geschrieben hast. Wie ist es dir im Entstehungsprozess damit ergangen?
Es ist mit Abstand das längste Stück, das ich bisher geschrieben habe. Das war schon eine besondere Erfahrung und in vielerlei Hinsicht ein Abenteuer. Man arbeitet mehr als ein Jahr an einer Komposition, ist gezwungen, immer dranzubleiben wie beim Schreiben eines Romans, und am Ende kommt man als ein anderer heraus, als der man hineingegangen ist. Wenn man ein Ensemble- oder Orchesterstück komponiert, das nicht länger als zwanzig Minuten dauert, kann man das Werk beim Schreiben überblicken und kontrollieren. Bei einer Oper von eineinhalb Stunden steckt man als Komponist irgendwann so mittendrin, das man sich sagt: Ich gebe die übergeordneten Überlegungen auf und lasse es jetzt einfach laufen. Man kann die Motivzusammenhänge, Proportionsüberlegungen und all das nicht mehr bewusst und bis ins Letzte kalkulieren. Man muss es einfach machen, und das Beziehungsgeflecht muss sich intuitiv einstellen. Werke für das Musiktheater vertragen einen grösseren Anteil an heterogenem Material als Instrumentalwerke, und man muss als Komponist viel mehr mit Kontrasten arbeiten. Es gibt zeitgenössische Opern, die wie fein durchgearbeitete Ensemblewerke mit hinzugefügten Sängern daherkommen. Ihnen hört man fünfzehn Minuten lang fasziniert zu, aber sie tragen nicht über einen ganzen Abend hinweg. Genau diesen Fehler wollte ich nicht machen. Theatralische Musik fordert einfach starke, kontrastreiche kompositorische Mittel.
Wenn du sagst, man müsse den Kompositionsprozess irgendwann einfach laufen lassen, gerätst du dann nicht in einen Widerspruch zu deinem vergleichsweise strengen Formbewusstsein?
Ich erachte die Verantwortung für die Form und die Architektur eines Werkes als etwas ganz Wichtiges und versuche ihr gerecht zu werden. Da stehe ich sehr in der europäischen Komponiertradition. Ich finde, es braucht ein Beziehungsnetz, das in der Musik erkennbar wird. Man muss eine Art Normalzustand kreieren, um dann davon abweichen zu können, und das ist bei neuer Musik gar nicht so einfach. Aber es gibt ein interessantes Zitat des Musikwissenschaftlers Carl Dahlhaus, in dem er sinngemäss sagt, schon viele Komponisten seien an dem Ehrgeiz zerbrochen, in einer Oper alles aufeinander beziehen zu wollen. Bei einem solchen Anspruch dreht man als Komponist natürlich durch. Die bessere Strategie ist, die Dinge gut zu planen und verwandtschaftlich zu organisieren und sich dann auch mal dem Fluss des Werkes zu überlassen.
Du bist ein international vernetzter Komponist, hast viele Kompositionsaufträge und mit den wichtigen Ensembles für zeitgenössische Musik wie dem Klangforum Wien und dem Ensemble Modern zusammengearbeitet. Aber deine musikalische Heimat liegt nach wie vor in der Schweiz, am oberen Ende des Zürichsees, wo du bis heute eine Organistenstelle bekleidest. Wie kam es dazu?
Ich habe während meines Musikstudiums in Wädenswil Orgel gespielt, irgendwann wurde eine Stelle frei, und die habe ich dann angenommen. Das war gegen Ende meines Orgelstudiums vor ungefähr fünfzehn Jahren. Die Stelle habe ich heute noch.
Was gehört dort zu deinen Aufgaben?
Es ist eine ganz normale Organistenstelle. Sonntägliche Gottesdienste, Abendgebetsliturgien, Beerdigungen – dass ganze Programm. Ich mache das übrigens sehr gerne. Denn ich spüre, dass man den Menschen an den sogenannten Lebensübergängen wie Taufe, Hochzeit oder Beerdigungen mit Musik etwas ganz Wichtiges gibt. Es geht nicht um Virtuosität und dass jeder Ton perfekt sitzt, sondern um ganz andere essenzielle Dinge. Manchmal ist es in der Kirche so still wie in keinem Konzert, und es entsteht eine ganz besondere Stimmung.
Als Komponist ist man eigentlich ein unabhängiger, exterritorialer Künstler, und du spielst sonntags in der Kirche die Orgel. Profitierst du davon, dass du gleichzeitig Komponist und Organist bist?
Auf jeden Fall. Wir sprechen ja hier über Musiktheater. Der Gottesdienst kann ja auch theatralisch sein, vor allem der katholische. Da gibt es Ministranten, Weihrauch, Prozessionen, das alles ist fast ein bisschen opernhaft. Und ich liebe das Improvisierte an meinem Organistenberuf. Als Kirchenmusiker kommt es vor, dass du drei Minuten Zeit hast, um dich auf eine Aufgabe vorzubereiten. Dann heisst es: Schlüssel umdrehen, Orgel an, los geht’s, während das Komponieren ja ein sehr langsamer Prozess ist.
Bist du in einer katholischen Gemeinde aufgewachsen?
Ja, die katholische Kirche in Jona ist meine Heimatkirche. Meine Mutter war da immer sehr engagiert. Aber ich bin natürlich nicht nur mit der Kirchenmusik gross geworden, das Klavierrepertoire war für mich ebenso wichtig.
Wann bist du von deiner Organistenlaufbahn in Richtung Komposition abgebogen?
Ich habe immer schon parallel ein bisschen komponiert. Das hat mit fünfzehn angefangen, mit neunzehn habe ich dann am Gymnasium gemeinsam mit einem Lehrer ein Musical geschrieben über einen Stoff von Stephen King. Das wurde auch aufgeführt, und ich habe es dirigiert. Das war lustig. Danach bin ich an die Musikhochschule in Luzern gegangen, habe Orgel und Klavier studiert. Da hatte ich den Komponisten Dieter Ammann als Tonsatzlehrer und bin durch ihn zum Komponieren gekommen.
Spielt die Orgel auch eine Rolle in der Art, wie du komponierst?
Eigentlich nein. Vielleicht manchmal beim Denken in Mixturen ein bisschen. Aber es gibt Leute, die mir sagen, meine Musik klinge wie Orgel. Wahrscheinlich sagen die das nur, weil sie wissen, dass ich Orgel spiele.
Das Gespräch führte Claus Spahn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 70, Juni 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Chris Kondek
Ein Gasbehälter im Stil der holländischen Neorenaissance, kreisrund, unten steinerne Bögen, oben Eisenrippen. Hinter Bäumen ist er verborgen und gar nicht so leicht zu finden, trotz seiner Grösse. Längst ist aus dieser Industrieruine ein Kulturzentrum im Westen von Amsterdam geworden: Probe, Zutritt nur für Eingeweihte. Chris Kondek führt mich im Halbdunkel rasch zu einem Sitz und macht mich leise auf Stockhausens berühmteste Interpretin aufmerksam.
«Kathinka Pasveer ist die in der Mitte, die Anweisungen gibt. So, ich muss zurück ins control center.» Er huscht an seinen Platz in der Reihe mit den vielen Laptops, Meister jener Bilder, die auf riesigen LED-Screens über der Bühne leuchten. Das gewaltige Rondell aus dem 19. Jahrhundert ist wie geschaffen für das Wahnsinnsprojekt, für das Chris Kondek die Videos gestaltet, ehe er zur nächsten Produktion nach Zürich kommt. Alle sieben Tage aus Stockhausens Heptalogie Licht, komprimiert auf siebzehn Stunden. Eine unfassbare Menge Arbeit, auch für den wohl erfahrensten und namhaftesten Video-Designer im Theaterbereich. «Wir arbeiten wahnsinnig schnell, vieles passiert in den Pausen. Hier wird noch etwas für einen Anschluss, dort für einen Lichtwechsel gebraucht, kannst du es grün oder schneller machen? Es ist wie Improvisieren auf einem Instrument, aber du musst schon viel Zeug parat haben, um das zu mixen.» Wobei das nicht irgendein Zeug ist.
Gerade beim Musiktheater, wo Zeitabläufe in der Partitur festgelegt sind und anders inszeniert und geprobt wird als im Sprechtheater, muss die Konzeption vor her gemacht werden. «Eine Idee dabei war in diesem Fall Max Ernst, den Stockhausen sehr liebte. Also habe ich die Collagetechnik von Ernst mit meiner verbunden, Bilder, die ein bisschen komplizierter sind, verschiedene Levels in sich haben, so wie mittelalterliche Bilder, die hinter dem Dargestellten voller Symbole sind.» Wir unter halten uns in der Probenpause im Vorzelt. Chris zersäbelt mit dem Holzmesser heisshungrig ein Schnitzel, ein mittelgrosser, schlanker Typ mit Brille und Keine-Zeit-zum-Rasieren-Bart, sehr jungenhaft für einen Endfünfziger, und mit der rasanten, lockeren Sprechart der New Yorker.
Er wurde an der US-Ostküste gross, in New York und Boston, von wo der Sohn eines Musicalregisseurs nach dem College ins kanadische Montreal zog: «Drei Jahre lang low budget horror movies, als zweiter Kameraassistent. Ich mochte das wirklich!» Er lacht. Danach wollte er in New York Karriere beim Film machen, landete aber, weil ihm das zu langsam ging, in der Wooster Group, einem kleinen Experimentaltheater. «Ich war Techniker, kümmerte mich um das Licht und sollte rauskriegen, wie dieses Videozeug funktioniert. Was wir jetzt machen, war damals unmöglich. Crossfade, Überblenden von zwei Videos, dafür hätten wir Geräte für zwölftausend Dollars gebraucht. Heute machen Kinder das auf ihren Phones!» Er hat sich als Künstler gemeinsam mit der Technik entwickelt. Alles, was er, learning by doing, entdeckte, kam gleich auf die Bühne. Seine Projektionen hatten eine Helligkeit von neunhundert Lumen, «das ging nur bei totaler Dunkelheit, heute würde man keine Show unter 20.000 machen. Das ist ein Sprung wie von der Kerze zur Gasbeleuchtung. Und jedes Bild, das ich brauchte, war schwer zu finden. Jetzt tippe ich ein paar Suchwörter, und da ist es.» Er sucht dabei bevorzugt nach alten Dokumentarfilmen. «Ich brauche mindestens dreissig Sekunden lange takes für meine Arbeit. Heute wird alle drei Sekunden geschnitten, da wird gar nichts mehr angeschaut.» Einer seiner Funde ist der Kölner Karneval um 1960, schwarzweiss, eine Kapelle mit Narrenkappen spielt, und der Kontrast, die Verbindung zur Musik des Rheinländers Stockhausen ist abgründig. Und was ist mit diesem roten Kreuz, das auf allen vier Screens von oben kommt, in der Mitte anhält und genau in der Sekunde, da zwei Klarinettisten einen tiefen Liegeklang erreichen, weiter sinkt? «Das passierte in der Probe. Glücklicher Zufall. Für den Moment fehlte noch etwas. Videos haben eine Art von Energie, die sich mit der Musik verbindet, sogar wenn sie scheinbar gegen die Musik gehen. Eins-zu-eins-Übersetzungen funktionieren sowieso nicht. Feuer zum Beispiel ist im Video nicht heiss und bedrohlich, sondern kalt. Du musst überlegen, wie kriege ich diese Energie zustande.» Er greift nach dem Glas vor sich. «Schon wenn es darum geht, wie Wasser in ein Glas gefüllt wird, ist es ein Unterschied, ob von hier oder von hier gefilmt wird. Das Bild muss das Gefühl davon transportieren, nicht es abbilden. Darum geht es andauernd: Wie kann man etwas nicht so aussehen lassen, wie es aussieht. The feeling of an object.»
1999 zog Chris nach Berlin, «for love». Ich wollte nur zwei Jahre bleiben. Aber die Theater waren sehr interessiert an Videoexperimenten, es gab Geld vom Senat, man sagte, der Typ kommt aus New York, der weiss, was läuft. Auf einmal machte das Leben mehr Spass, ich hatte eine grössere Wohnung und viel mehr Arbeit. In New York muss man sich abstrampeln, um einen Job zu kriegen! In Berlin war alles weniger stressig.» Ersten Berliner Produktionen folgte Alibi von Meg Stuart am Schauspielhaus Zürich, «mein Durchbruch in Europa», er entwarf eigene, schräge Performances für das Berliner HAU, über die er in Kontakt mit Sebastian Baumgarten kam. Für dessen Operninszenierungen hat er zahlreiche Videodesigns gemacht, etliche in Zürich, das umstrittenste in Bayreuth: Der Röntgenfilm atmender Lungen zum Tannhäuser-Vorspiel liess die Premierengäste nach Luft schnappen.
Aber auch das verband sich mit der Musik. «Ich sehe mich nicht als Videokünstler, sondern als einen, der im Theater arbeitet. Wie die Anschlüsse gehen, wie Dinge erscheinen und verschwinden, der Rhythmus. Ich mache nie narrative movies, damit saugt man die ganze Energie aus dem Saal. Es darf nicht so sein, dass die Zuschauer keine Minute verpassen wollen. Das Video kann rapide wechseln von atmosphärischer Ergänzung zu Infos, es transportiert Erinnerungen … Also arbeite ich mit loops, Lichtwechseln, Geschwindigkeiten.» Hat sich seine Ästhetik geändert mit den Jahren? «Ich versuche weniger junk zu machen und Bilder mit mehr Kraft. Mit Intensität. Ich erinnere mich an einen Moment bei Peter Brook, ein Schauspieler sass nur da, drei, vier Minuten. Dann …» Chris hebt den Zeigefinger seiner rechten Hand und lässt ihn wieder sinken. «Alle fokussierten sich darauf. So viel Energie in dieser winzigen Geste!»
So etwas inspiriert ihn, und Malerei, nicht so sehr die Videokunst in Museen und Ausstellungen. «Meistens quasidokumentarische Videos der Künstler selbst, während sie irgendwas tun, schlecht gefilmt, schlecht beleuchtet, vielleicht weil das in einem bestimmten Kontext als persönlicher Ausdruck akzeptiert wird», sagt er mit verhaltenem Spott. «Bei einem guten Maler frage ich mich, wie bringt der es fertig, eine Person auf die Art auf den Stuhl zu setzen mit dem Licht? Nichts passiert, aber du fragst dich dauernd, was denkt die? Aufregend.»
Sein Denken in Bildern will er auch als Regisseur der Zürcher Uraufführung von Last Call einsetzen – bei der das Video-Design mal nicht von ihm kommt, sondern von Ruth Stofer. «Sie tut mir jetzt schon leid», sagt er und parodiert gedämpft schreiend einen Regietyrannen: «No, no, not good enough!» Dabei hasst er solche Typen. Und er freut sich auf die apokalyptische Groteske, in der die Elektronik so aus der Kontrolle gerät, dass die Menschen von der Erde fliehen. Nur ein Mann und eine Frau bleiben … «Nahe Zukunft, ein bisschen wie heute, aber eine Drehung weiter.» Ein Stück zur Weltverbesserung? «Nein, unterhaltsam! Vielleicht können wir damit ein bisschen Spass in unsere letzten Tage bringen …» Er lacht leise, dann verschwindet er wieder im magischen Halbdunkel des Kolosseums.
Text von Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 70, Juni 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hinter dem Vorhang
Annette Schönmüller, Ruben Drole und Dirigent Jonathan Stockhammer über die Arbeit an «Last Call»
Meine Rolle
Eine Uraufführung ist für alle Beteiligten immer eine besondere Herausforderung. Niemand weiss, wie das Stück klingen wird, und natürlich gibt es auch keine Aufnahme, die man sich zur Vorbereitung anhören könnte. Alle sind auf der Suche... Sich darauf einzulassen, braucht Mut. Dass man den Komponisten nach seinen Intentionen und Klangvorstellungen fragen kann, ist dabei eine grosse Chance, die auch mal zur wechselseitigen Belastungsprobe im Ringen um die ideale Umsetzung ausarten kann. Von Michael Pelzel kannte ich schon einige Stücke, die ich im österreichischen Rundfunk im Radio gehört hatte und die mich wegen der Farbigkeit, die er mit wenigen Instrumenten herstellen kann, sehr beeindruckt haben.
Auf eine Uraufführung bereite ich mich zunächst stumm vor. Wenn ich die Noten bekomme – wenn ich sie denn bekomme, denn manchmal kommen die Noten erst, während man schon probt –, dann lese ich erst mal den Text und die Noten und versuche, eine rhythmische Orientierung zu bekommen. Manchmal dauert es zwei Wochen, bis ich den ersten Ton singe. Am liebsten schaue ich dabei in die Partitur, denn oft sind Klänge in der neuen Musik im Klavierauszug gar nicht darstellbar, und manchmal ist es sogar gefährlich, sich auf den Klavierauszug zu verlassen, weil im Orchester plötzlich alles ganz anders klingt und man die Linien, von denen man dachte, dass sie helfen würden, plötzlich gar nicht mehr hört. Besonders gern mag ich handschriftliche Partituren; wenn ich sie lese, kann ich nachvollziehen, wie der Komponist oder die Komponistin gearbeitet hat. Dass ich neben Gesang auch Orgel und Dirigieren studiert habe, hilft mir dabei.
Last Call ist für mich von Ligetis Grand Macabre inspiriert: Hier wie dort geht es um den drohenden Weltuntergang. Meine Figur heisst im ersten Akt Frau Hahnemann und ist das Abziehbild einer MöchtegernIntellektuellen, die – zusammen mit anderen Kandidaten – in einer Talkshow ihren Vorschlag zur Rettung der Welt präsentiert. Ihr Vorschlag wird dann gewählt: Die Menschheit soll auf den Planeten Elpisonia gebracht werden, damit die zugemüllte Erde sich erholen kann. Im dritten Teil heisst die Figur Sulamit und hat – ebenso wie Johnny – das Raumschiff nach Elpisonia verpasst. Nun sind sie zu zweit auf der Erde zurückgeblieben und müssen nach dem Kommunikations-Overkill des ersten Teils erst wieder neu lernen, miteinan der zu sprechen. Fast kommen mir diese beiden vor wie Adam und Eva; ihre Äusserungen haben etwas Vorsprachliches. Wir sind noch mitten im Prozess, wir müssen erst herausfinden, wie und wer diese beiden eigentlich sind. Werden sie ein Liebespaar? Oder sind sie eher wie Geschwister? Oder wie zwei Seiten desselben Menschen?
Spezialistin für zeitgenössische Musik zu sein, war nicht unbedingt mein Ziel; es hat sich so ergeben. Zunächst war ich nicht sicher, ob ich Schauspielerin werden sollte, bin dann aber doch Sängerin geworden und habe szenisch besonders herausfordernde Rollen gesucht. So bin ich bei der neuen Musik gelandet. Und weil ich damit erfolgreich war, wurde ich schnell in eine Schublade gesteckt. Nun habe ich mich in der zeitgenössischen Musik etabliert und kann von hier aus das romantische Repertoire erobern.
Was ist Schönheit im Gesang? Diese Frage beschäftigt mich sehr. Als Sängerin muss ich natürlich den Schönklang beherrschen. Aber das ist für mich nur eine Option unter vielen. Ich würde mir mehr Farben wünschen in der Oper, mehr Mut zum stimmlichen Risiko!
Foto von Lena Kern.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 70, Juni 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Pressestimmen
«Schrill mit schillernden Zwischentönen: Michael Pelzels Endzeit-Kammeroper Last Call lässt auf noch Grösseres hoffen.»
SRF Kultur vom 1. Juli 2019«Mal brodelt es in der Tiefe, mal schweben Klangbläschen nach oben. Es gongt und dröhnt, es fiept und tröpfelt.»
Tages-Anzeiger vom 29. Juni 2019
Fragebogen

Jonathan Stockhammer
Jonathan Stockhammer stammt aus Los Angeles. Neben Orchestern wie dem Ensemble Modern, dem Collegium Novum Zürich und dem Ensemble Resonanz dirigierte er viele Ur- und Erstaufführungen wie zuletzt «Koma» von Georg Friedrich Haas. Seine CD «Greggery Peccary & Other Persuasions» mit Werken von Frank Zappa, gespielt vom Ensemble Modern, wurde mit einem ECHO Klassik ausgezeichnet.
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Vom Uetliberg, aus Thalwil, vom Adlispass, vom Zürichsee und dem Rigiblick... Immer, wenn ich in Zürich arbeite, finde ich es unglaublich schön hier, ich liebe das Gefühl von Freiheit, das ich hier habe, und tauche voll in diese Welt ein. Professionell gesehen komme ich aus der Welt des Collegium Novum hier in Zürich, das ich häufig dirigiere; gerade haben wir ein Konzert mit Werken von Mischa Käser, Michael Jarrell, Vito Žuraj und Aurealiano Cattaneo gegeben.
Worauf freuen Sie sich in der Uraufführung des Musiktheaters Last Call am meisten?
Darauf, dass es zum weit entfernten Planeten Elpisonia geht... Nein im Ernst, ich finde unser Ensemble schauspielerisch und sängerisch grossartig, und auch menschlich ist es toll mit ihnen. Das, was zurzeit in unseren Proben entsteht, ist etwas, das niemand voraussagen kann – weder ich, noch der Komponist Michael Pelzel. Jedes Mal kommt etwas Neues.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Da war zum einen der Solo-Trompeter vom Los Angeles Philharmonic Orchestra, Thomas Stevens, der mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und mir viele Dinge über das Dirigieren, aber auch über die Komposition und Konstruktion von Musik erklärt hat. Ich denke immer noch oft an ihn. Ein anderes wichtiges Erlebnis war der Moment, als ich 1994 zum ersten Mal nach Europa kam, um in Italien einen Sprachkurs zu machen. Damals habe ich mich in eine Schweizerin verliebt und ging mit ihr nach St. Gallen. Wenn es diesen Kontakt nicht gegeben hätte, wäre ich als Amerikaner vielleicht nie nach Europa gekommen. Nun fühle ich mich extrem zuhause in Europa, so wohl privat als auch professionell.
Welches Buch würden Sie niemals weggeben?
Ada or Ardor, also Ada oder Das Verlangen von Vladimir Nabokov. Aber es gibt so viele Bücher, die ich sehr liebe, da ist es schwer, nur eines auszuwählen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Miles Davis, Porgy and Bess.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Meinen Salamander. Das ist ein spezieller Ofen mit sehr starker Oberhitze. Ein fantastisches Gerät zum Grillen oder Toasten.
Mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin würden Sie gerne einmal essen gehen?
O, da gäbe es viele... Mit Meryl Streep vielleicht. Ich würde gern mit ihr über Schauspielerei und Literatur sprechen.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Weil es so vieles zu erleben gibt auf der Welt; weil man seine Richtung immer verändern kann, egal, ob es die künstlerische Richtung ist oder die Lebensrichtung oder die Denkrichtung; und weil es Farben und Musik gibt
Foto von Marco Borggreve.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 70, Juni 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Last Call
Synopsis
Last Call
Irgendwann in der Zukunft. Die Maschinen gehorchen den Menschen nicht mehr, die Medienkommunikation hat sich verselbständigt. Der mediale Overkill droht – die Urchips rebellieren, die Multimegabitwelle ist drauf und dran, alle und alles mitzureissen. Wenn nicht bald etwas geschieht, wird die Menschheit keine Zukunft mehr haben.
In einer Art Talkshow stellen deshalb vier Kandidaten ihre Visionen zur Rettung der Welt vor. Das Publikum soll abstimmen: Der Vorschlag, der die meisten Stimmen erhält, wird umgesetzt. Der Conferencier Harald Gottwitz präsentiert die KandidatInnen: Dr. Karitzoklex, der dafür plädiert, die Erde einzunebeln und die Erdrotation aufzuhalten; Frau Professor Hahnemann, die vorschlägt, die Menschheit mittels Dehydrierung und Desaltierung auf den erdähnlichen Planeten Elpisonia zu evakuieren, bis die Erde sich von den Kommunikationsfluten erholt hat; der Aktivist Tarantino Muff, der glaubt, nur der «Anthropofugismus total» könne die Erde retten – was bedeutet, dass die Menschheit vernichtet und die Erde den Pflanzen und Tieren überlassen wird; und schliesslich die Influencerin Trendy-Sandy-Mandy, die die Welt mit einer super Party im All retten will.
Noch bevor die Talkshow zuende ist, bricht die befürchtete Multimegabitwelle herein. Alles droht in Chaos und Tumult unterzugehen. Hektisch werden die Raumschiffe in Richtung Elpisonia bestiegen.
Doch ein Mann – Johnny – und eine Frau – Sulamit – werden versehentlich zurückgelassen. Sie sind nun die letzten Menschen auf der Erde. Werden sie zu einer neuen – alten – Art der Kommunikation zurückfinden? Werden sie bleiben? Wie werden sie auf der verlassenen Erde überhaupt überleben können? Oder wird eins der Raumschiffe umkehren und sie nach Elpisonia holen?