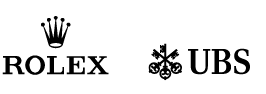Iphigénie en Tauride
Tragédie en quatre actes von Christoph Willibald Gluck (1714-1787)
Libretto von Nicolas-François Guillard
nach der gleichnamigen Tragödie von Claude Guimond de La Touche
In französischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 1 Std. 45 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Gespräch

Andreas, vor einigen Jahren hast du an der Oper in Genf Christoph Willibald Glucks Orphée et Euridice inszeniert, nun folgt Iphigénie en Tauride am Opernhaus Zürich. Was für eine Beziehung hast du zu diesem Komponisten, der in der Musikgeschichte häufiger für seine berühmte Opernreform erwähnt wird als für seine Werke selbst?
Ich würde Gluck als einen eher unaufgeregt komponierenden Musiker beschreiben, der unglaublich souverän Geschichten erzählt und dabei den Zuständen seiner Figuren sehr viel Raum gibt. Die Handlung steht oft eher still, aber häufig geht es auch gar nicht so sehr um die äussere Handlung, sondern viel mehr um die Innenwelten der Figuren. Es gibt in Glucks Opern keine Milieuschilderungen, die Stücke spielen an einem nicht genau festgelegten Ort, was mir als Regisseur eine grosse Freiheit gibt, Bildmetaphern zu finden. Mir gefällt auch das sehr ausgewogene Verhältnis zwischen dramatischen und kontemplativen Momenten. Das ist für mich das Wesen der Klassik: das Ebenmass, der Verzicht auf übermässige barocke Ornamentierung, die Einfachheit.
Genau das war ja auch Glucks erklärtes Ziel: die schematischen Strukturen der italienischen Metastasio-Opern zu überwinden und – im Verein mit den französischen Enzyklopädisten, allen voran Diderot und Rousseau – im Paris der 1770er Jahre zu einer neuen Form der Oper zu finden, die von Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit des Ausdrucks geprägt ist. Das ist ihm also gelungen?
Ja, absolut. Man spürt bei Gluck sehr viel Empathie für seine Figuren, er zeichnet sie mit einer grossen Menschenliebe. Diese Menschen sind geprägt durch eine Empfindsamkeit, die natürlich für diese Zeit typisch ist – sie verhalten sich sehr nobel, verzichten zugunsten des anderen...
Hat uns diese Empfindsamkeit, dieses Verzichtenwollen heute überhaupt noch etwas zu sagen? Das sind nicht unbedingt Eigenschaften, die unsere Zeit charakterisieren...
Umso mehr müssen wir sie einfordern und auf dem Theater zeigen!
Anders gefragt: Was ist für dich das Moderne an diesem Stück?
Das Thema ist zeitlos! Es geht um eine Familie, konkret die exemplarische Familientragödie des Altertums – die Familie von Agamemnon und Klytämnestra. Diese Familie ist gefangen in einem Kreislauf von Mord und Rache, der damit beginnt, dass Agamemnon gezwungen wird, seine eigene Tochter Iphigenie zu opfern. Erst am Ende dieses Stückes wird der Fluch gelöst. Die Familie sollte eigentlich ja eine glückliche Keimzelle der Gesellschaft sein, das Familienleben wird – auch in der Werbung – oft als Idylle dargestellt; aber das Leben zerrt an den Menschen, die Wirklichkeit sieht häufig anders aus. Familienkonflikte können zu starken Reibungen und im schlimmsten Fall sogar zu Mord und Totschlag führen. Gerade wenn in einer patriarchalen Gesellschaft mächtige Väter beteiligt sind, wie in unserem Fall Agamemnon, der König von Mykene ist und Feldherr im Krieg gegen Troja.
Also geht es hier neben dem familieninternen Konflikt auch um den Konflikt zwischen der Familie und der Gesellschaft?
Ja, und dieser Konflikt kommt im Altertum immer wieder vor. Er hat mit der Entstehung der Polis zu tun, also mit der Entstehung von Strukturen, die es notwendig machen, dass Menschen aufgrund des gesellschaftlichen Fortschritts in immer grösseren Gemeinschaften zusammenleben, weil der Familienclan als Ordnungsprinzip nicht mehr ausreicht. So entsteht dieses Motiv – auch in der Bibel mit der Geschichte von Abraham und Isaak – des kindlichen Opfers für den Gott oder die Göttin, wobei ich Gott ganz allgemein verstehe als ein Bild für etwas, das über die eigene Existenz hinausgeht. Agamemnon kann seiner Funktion und seiner Verantwortung als Heerführer nur gerecht werden, wenn er seine Tochter Iphigenie opfert. Damit tut er sich zunächst schwer, und letztlich ist es die Tochter selbst, die den Konflikt löst, indem sie sagt, ich verstehe das Problem und bin bereit, in den Tod zu gehen. Agamemnon tötet daraufhin Iphigenie und besteht damit die Prüfung im Sinne der Gottheit.
Aber die Opferung Iphigenies führt innerhalb dieser Familie zu einem schweren Trauma...
Dieses Trauma ist mit dem Fluch des Tantalos beschrieben. Weil dieser Schuld auf sich geladen hat, haben die Götter verfügt, dass jeder seiner Nachkommen ein Mitglied der eigenen Familie umbringt. Dieser Fluch führt in der Folge dazu, dass die Mutter Klytämnestra ihren Ehemann Agamemnon tötet und selbst wiederum von ihrem Sohn Orest umgebracht wird. Soweit die Vorgeschichte. In der Oper selbst wird Orest seiner Schwester Iphigénie wiederbegegnen, die von der Göttin Diana gerettet wurde; sie ist jetzt Priesterin des Diana-Tempels und wird von Thoas, dem Gewaltherrscher auf Tauris, gezwungen, jeden Fremden, der hier landet, umzubringen. Die Geschwister erkennen sich zunächst nicht, weil sie seit ihrer Kindheit getrennt waren; erst im letzten Moment, als Iphigénie im Begriff ist, das grausame Opferritual auszuführen, erfährt sie, dass es ihr Bruder Orest ist, den sie im Begriff ist zu töten, und verweigert das Opfer.
Der Iphigenie-Stoff ist häufig bearbeitet worden, unter anderem auch von Johann Wolfgang von Goethe; Iphigenie wird hier zum Denkmal der alle Gewalt überwindenden Humanität stilisiert. Wie hat Gluck sie charakterisiert?
Iphigénie ist natürlich auch bei Gluck eine ausgesprochen humanistische Figur, aber sie ist zugleich auch sehr leidenschaftlich; wir sind ja schliesslich in der Oper! Das Stück beginnt mit einem Sturm im Orchester, und wir werden als Zuschauer direkt mit dem Seelenzustand Iphigénies konfrontiert; in der anschliessenden Arie sagt sie selbst: Der Sturm auf dem Meer ist vorüber, aber nicht der Sturm in meinem Inneren. Es geht also von Anfang an um Iphigénies Inneres. Mozart hat das übrigens wenige Jahre später in Idomeneo aufgegriffen, dort singt Idomeneo in seiner Arie: Zwar bin ich dem Sturm entkommen, doch ich habe den Sturm bzw. das Meer in mir. Iphigénie kann sehr leidenschaftlich sein, aber auch sehr elegisch. Sie verfügt über eine grosse emotionale Bandbreite und ist eine Frau aus Fleisch und Blut, wie übrigens alle Figuren in dieser Oper. Alles andere wäre auch uninteressant auf der Bühne.
Diana hatte also Mitleid mit Iphigénie und hat sie gerettet; zu Beginn der Oper lebt Iphigénie bereits seit 15 Jahren als Priesterin der Diana auf Tauris. Was ist dieses Tauris für ein Ort?
Zunächst mal ist es ein Ort, der sowohl geografisch als auch kulturell sehr weit von Iphigénies griechischer Heimat entfernt ist. Und auf gewisse Weise scheint es ein Ort zu sein, der Menschen anzieht, die traumatisiert sind, ein Ort, an dem Traumatisierte aufeinandertreffen. Dieser Ort, der von Gewalt und Barbarei beherrscht wird, ist für meinen Ausstatter Michael Levine und mich kein wirklicher Ort, sondern eine Art Unterwelt oder ein Fegefeuer. Iphigénie ist ja für ihre Familie tot, denn niemand weiss, dass sie gerettet wurde. Ihr Bruder Orest ist dem Tode nahe, denn die Rachegöttinnen verfolgen und quälen ihn; er trägt eine grosse Todessehnsucht in sich. Die Bühne, die wir entwickelt haben, vermeidet konkrete Örtlichkeiten. Im Zentrum des Stückes stehen für uns die Geschwister Iphigénie und Orest, dazu kommt der Freund des Orest, Pylades, der nicht zur Familie gehört. Alle Figuren sind dem Gewaltherrscher Thoas ausgesetzt. Die beiden Hauptfiguren durchleben an diesem Ort immer wieder albtraumhaft ihr Trauma; deshalb erschien uns Thoas als eine Art verzerrter, übersteigerter Reflex Agamemnons, der seine Tochter umgebracht hat und von dem Trauma dieser Tat allmählich seelisch zugrunde gerichtet wurde. Am Schluss der Oper erscheint die Göttin Diana; deren Vergebung löst den Fluch schliesslich auf. Dies steht für uns für die Vergebung, die Orest von seiner toten Mutter Klytämnestra nie wird erhalten können und die er daher umso mehr ersehnt. Die Figuren Agamemnon-Thoas und Klytämnestra- Diana werden sich in unserer Inszenierung so ineinander spiegeln, dass der Eindruck entsteht, das Personal des Stückes bestünde letztlich nur aus diesen vier Figuren: den beiden Kindern und ihren Eltern.
Interessant ist ja, dass in dieser Oper keine konventionelle Liebesgeschichte vorkommt; neben der Geschwisterliebe gibt es allerdings noch die sehr besondere Freundesliebe zwischen Orest und Pylades.
Die Beziehung zwischen Orest und Pylades ist unglaublich liebevoll gezeichnet, fast homoerotisch; auf jeden Fall geht sie weit über eine normale Männerfreundschaft hinaus. Dass es in dem Stück keine konventionelle Liebesbeziehung gibt, dient der Klarheit und ist nur konsequent. Zu den Hauptfiguren kommt dann noch der Chor, den wir aber auch als Spiegelungen oder Vervielfachungen einerseits von Iphigénie, andererseits von Thoas sehen; der Chor wird ja die meiste Zeit über in Männerchor und Frauenchor getrennt eingesetzt, es wird nie eine gemischte Gesellschaft gezeigt. Wir fokussieren die Geschichte auf die Familie in einem klaustrophobischen, tunnelartigen Raum, der nur ab und zu aufbricht und grelles Licht einlässt; innen ist es beklemmend, aber aussen ist es möglicherweise noch bedrohlicher. Es gibt eigentlich keinen Ausweg aus dieser albtraumhaften Innenwelt.
Wie siehst du dann den Schluss des Stückes – immerhin vergibt ja Diana Orest seine Schuld und schickt ihn als König zurück nach Mykene?
Ja, es gibt dieses «lieto fine», der Fluch wird gelöst und die Figuren entkommen ihrem Gefängnis. Wie erfolgreich sie ihr weiteres Leben nach all den seelischen Beschädigungen meistern werden, bleibt natürlich dahingestellt, aber wir werden hier nicht versuchen, eine Antwort zu geben.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Bild von Frank Blaser.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Pressestimmen
«Schöner kann man über Mord nicht singen. Glucks Iphigénie en Tauride begeistert am Zürcher Opernhaus: [auch] dank [...] Andreas Homokis radikal reduzierter Regie.»
Tages-Anzeiger vom 3. Februar 2020«Es ist eine Iphigénie, die nahegeht»
SRF Tagesschau vom 1. Februar 2020
Gespräch
Frau Bronfen, Glucks Oper Iphigénie en Tauride geht zurück auf ein Drama von Euripides, das wiederum eine Geschichte aus der griechischen Mythologie aufnimmt. Diese Geschichten wurden zunächst mündlich überliefert und dann um 800 vor Christus erstmals von Homer aufgeschrieben. Lässt sich heute noch sagen, wo diese Geschichten ihren Ursprung hatten? Wurden sie mit einer bestimmten Intention erzählt?
Um es mit dem Philosophen Hans Blumenberg zu sagen: Man erzählt sich Geschichten, um die Furcht zu bannen. Die griechischen Mythen beziehen sich auf die Religion in der Antike, in der man sich Götter vorgestellt hat, die sehr viel menschlicher waren, als wir das aus der judäo-christlichen Religion kennen. Der Familienstreit der antiken Götter spiegelt den Streit der Menschen auf der Erde, die göttlichen Geschlechterverhältnisse spiegeln das Geschlechterverhältnis unter den Menschen, und das Verhältnis von Herrscher und Beherrschtem spiegelt eben diese Verhältnisse unter den Menschen. Wir sehen also in den mythischen Geschichten, wie überhöhte Figuren das erfahren, was die Menschen in den Familien, in grösseren, die Gemeinschaft betreffenden Einheiten oder im Kampf zwischen Nationen durchleben. Die mythologischen Geschichten bieten im doppelten Sinn Lösungen, weil innerhalb des antiken Denkens die Idee des Schicksals ganz entscheidend ist – die Menschen sind nicht selbst verantwortlich für das, was sie tun. Sie können Entscheidungen gar nicht selbst treffen, sondern müssen erst das Orakel befragen. Die Verantwortung wird also an eine höhere Instanz abgegeben. Zudem spielen die Mythen Probleme durch und zeigen häufig Lösungen, die es in der Realität nicht gibt, eben durch das Eingreifen der Götter. Das ist übrigens auch die Analogie, die man zwischen den alten Mythen und unseren heutigen fiktionalen Erzählungen ziehen kann, sei es im Theater, im Kino oder eben in der Oper: Es wird an einem anderen Schauplatz ein Problem dargestellt...
...und wir als Publikum erkennen uns in diesem Problem wieder...
...wissen dabei aber immer, dass es überhöhte Geschichten sind, die tragische oder positive Lösungen durchspielen – und nicht die Realität.
In der heutigen Realität wäre es ja auch eher unwahrscheinlich, dass meine Tochter von meinem Mann geopfert wird, damit er in den Krieg ziehen kann, wie es in der Vorgeschichte von Iphigénie en Tauride geschieht.
Da bin ich mir nicht so sicher! Ich schaue im Moment gerade die Fernsehserie Succession, darin geht es um den sehr mächtigen Besitzer eines Medienkonzerns und um die Frage, wer sein Nachfolger werden soll. Hier werden auch Kinder geopfert, indem das eine Kind gegenüber dem anderen bevorzugt wird, oder indem ein Kind gezwungen wird, den Konzern zu übernehmen, statt die eigenen Träume zu leben.
Warum muss es denn innerhalb des Iphigenien-Mythos die Tochter sein, die geopfert wird und nicht der Sohn?
Banal gesagt: Den Sohn opfert man besser nicht, denn den braucht man ja als Krieger an seiner Seite. Die Tochter kann man eher entbehren. Töchter sind in der Antike und bis weit ins 19., ja bis ins frühe 20. Jahrhundert Teil des Tauschmaterials zwischen Männern. Wenn Töchter gegen ihren Willen verheiratet werden, um ein Machtbündnis zwischen Männern zu festigen, ist das auch eine Opferung oder sogar eine Form von Tod. Bei Iphigenie ist es ein Tausch zwischen dem Vater und einer Gottheit, bei dem die Tochter statt ins Ehebett auf den Altar kommt. Die Tochter ist der Besitz des Vaters, über den er seine Macht etablieren kann.
Geht es auch darum, die eigene Familie gegenüber der Gemeinschaft und dem grossen Ganzen zurückzustellen?
Kulturgeschichtlich sind es die Frauen, also die Mütter und Gattinnen, die auf den partikularen Interessen beharren. Durch das Opfer beweist Agamemnon, dass er aus der Position des Vaters und Ehemanns in die Position des Generals übergetreten ist, und dieses Opfer hält das Heer zusammen. Denken wir an die Geschichte von Lucrezia, die vergewaltigt wird und dann Selbstmord begeht: Ihre Leiche wird benutzt, um die Männer zusammenzuschweissen, die später die römische Republik gründen. Über dem toten Frauenkörper kommen Männer zusammen, um eine von Tötungslust und Nationalismus geprägte Kampfeinheit zu bilden. Das hat eine lange Tradition.
Agamemnon war bereit, die eigene Tochter zu opfern; wie kann Iphigenie mit diesem Trauma weiterleben?
Iphigenie ist das Lieblingskind Agamemnons, seine älteste Tochter. Das ist also auch eine Liebes- und Vertrauensgeschichte. Gleichzeitig sieht sie, dass der Vater bereit ist, sie zu zerstören. Das bedeutet nicht nur eine Infragestellung des Verhältnisses der Tochter zum Vater, sondern auch einer jungen Frau zu einem älteren, von ihr geliebten Mann. Psychoanalytisch könnte man sagen, es geht hier – in sehr stark überhöhter Weise – um etwas, das alle Töchter erfahren müssen: Sie müssen sich von ihrem Vater, mit dem sie meist die wichtigere Beziehung haben als mit der Mutter, trennen. Man kann es also auch als eine notwendige Trennungsgeschichte verstehen. Die Tochter muss erkennen: Mein Vater ist nicht mein geliebtes Gegenstück, sondern er ist ein von mir abgetrenntes Wesen, das seine eigenen Interessen meinen Interessen gegenüber privilegiert. Das hat natürlich auch etwas mit dem Erwachsenwerden zu tun.
Dann wäre also die Opferung der Iphigenie durch ihren Vater ein Bild für einen natürlichen Vorgang und gar nicht so grausam, wie sie auf den ersten Blick erscheint? Oder ist dieser «natürliche» Vorgang umgekehrt im Grunde ein sehr grausamer?
Wenn man den Mythos als Familiengeschichte liest, wird deutlich, wie grausam dieser natürliche Vorgang ist. Diese Trennung kann von den Kindern durchaus als eine Form von Opferung verstanden werden. Denn sie begreifen, dass sie dem Vater nicht absolut vertrauen können, nicht von ihm geschützt werden, Zutrauen und Liebe nicht mehr an ihm festmachen können. Erwachsenwerden heisst, zu verstehen: Der Vater ist kein Übermensch, der Vater ist sowohl gut als auch böse, er wird mich nie schützen können. Tod und Opferung sind in der Mythologie Chiffren. Man darf das nicht immer wörtlich nehmen und muss es übersetzen: Es geht um Begeisterung, Hingabe, Abtrennung, Lust. Diese Geschichten lassen sich sehr zeitgenössisch lesen.
Glucks Iphigénie en Tauride hat Ereignisse zum Thema, die lange nach der Opferungsszene stattfinden, denn Iphigénie wurde auf dem Opferaltar im letzten Moment von der Göttin Diana gerettet und lebt nun seit 15 Jahren als Priesterin der Diana auf Tauris. Dort sieht sie im Traum die Gewalt, die ihre Familie in der Zwischenzeit zerstört hat. Ihr Bruder Orest wird – ebenfalls im Traum – von den Eumeniden verfolgt, den Rachegöttinnen, die ihm den Mord an seiner Mutter Klytämnestra vorwerfen. Welche Rolle spielen Träume in dieser Geschichte?
Innerhalb der Antike ist Wachen und Träumen nicht so strikt voneinander getrennt wie bei uns. Oft geht es dabei um Prophezeiungen, in denen die Götter mit den Menschen sprechen. Bei Gluck geht es darum, dass wir in unseren Träumen unsere Ängste, unsere positiven oder negativen Erwartungen oder unsere Schuld durchspielen, Dinge, die wir so direkt nicht ausdrücken können. Es ist wie eine Geschichte, die man sich selbst erzählt, es kommen Dinge zum Ausdruck, die wir im Licht des Tages nicht zulassen würden. Es ist chiffrierte Fantasiearbeit, Theater im Theater oder auch ein inneres Theater, das sowohl die Theatersituation reflektiert als auch die Theatralität unseres Seins in der Welt. Wir beobachten uns hier selbst.
Interessant ist, dass die Grenzen zwischen Realität, Traum, Erinnerung, Fantasie in Glucks Oper sehr fliessend zu sein scheinen.
Für mich ist auch der Krieg letztlich eine Fantasie. Es hat etwas geradezu Rauschhaftes, wenn die Männer als eine Einheit gegen Troja ziehen, und es hat auch etwas Rauschhaftes oder Traumartiges, wenn der Vater die Tochter nicht mehr als Tochter sieht und bereit ist, sie für diesen Krieg zu opfern.
Neben den Träumen ist auch die Todessehnsucht der Hauptfiguren auffallend. Iphigénie möchte lieber sterben, als weiter auf Tauris Menschen zu opfern. Orest wird so sehr von seiner Schuld gequält, dass er den Tod herbeisehnt, und Pylades, Orests Freund, möchte lieber selbst geopfert werden, als seinen Freund dem Tod zu überlassen. Selbstmord scheint aber für keine dieser Figuren eine Option zu sein.
Zur Zeit Glucks beginnt sich zu zeigen, dass in der bürgerlichen Familie etwas nicht stimmt: Es geht nicht nur um das Verhältnis zwischen Gatte und Gattin, sondern auch um das zwischen Eltern und Kindern und zuweilen auch Schwestern und Brüdern. Die Todessehnsucht der verschiedenen Figuren kann man sehen als Erlösungsfantasie aus der Unmöglichkeit heraus, sich zurechtzufinden in einem System, in dem mir so vieles vorgeschrieben und in dem mein Begehren nicht mit meinen Pflichten zu vereinbaren ist. Damit wird diese Todessehnsucht auch zu einer Kritik an der Familieneinheit: Diese bürgerliche Familie, die stark von der Aufklärung, von einem paternalen, rationalen Denken und von ebensolchen Gesetzen getrieben ist, hat etwas Zerstörerisches. Ich denke da immer an den Streit zwischen der Königin der Nacht und Sarastro in der Zauberflöte: Er setzt mit absoluter Brutalität auf Aufklärung, während sie noch dem magischen Denken verhaftet ist. Dieser Streit zwischen den Eltern frisst die Kinder auf. Deren Todessehnsucht wird dreissig Jahre nach Gluck in der Romantik bei Novalis, Kleist und anderen ihre grosse Blütezeit haben.
Der Fluch der Familienmorde, von dem Agamemnons Geschlecht nicht loskommt, wird durch die Göttin Diana gelöst. Es sind also wiederum nicht die Menschen, die eigenverantwortlich Entscheidungen treffen, sondern die Götter müssen eingreifen, um eine Lösung herbeizuführen.
1779, als Glucks Oper entstanden ist, konnte man noch akzeptieren, dass nur die Götter in der Lage sind, eine Lösung herbeizuführen. Zehn Jahre später, nach der französischen Revolution, wird man sich dann nicht mehr vorstellen können, dass die Menschen zu keiner eigenen Entscheidung fähig sein sollen – dann häufen sich übrigens auch die Selbstmorde oder Liebestodfantasien wie etwa in Wagners Tristan und Isolde. Zur Zeit Glucks gibt es für die Erkenntnis des Unbehagens an der bürgerlichen Familie und an den bürgerlichen Gesetzen mit all ihren Zwängen nur auf der Ebene der Götter eine Lösung. Umgekehrt könnte man auch sagen, das Eingreifen der Göttin ist wie die letzte Feier des noch nicht mündigen individuellen Subjekts. Das absolut mündige individuelle Subjekt gipfelt im revolutionären Subjekt, das dann später in Frankreich den König umbringt. Hier wird eine Art Umbruchphase markiert.
Eine solche Umbruchphase scheint sich auch in dieser Oper zu spiegeln: Iphigénie trifft selbständig die Entscheidung, einen der beiden Gefangenen frei zu lassen. Dann geht sie noch einen Schritt weiter und entscheidet – als sie erkennt, dass der zweite Gefangene ihr Bruder ist –, diesen auf keinen Fall zu opfern. Sie ist also durchaus zu einer selbstbestimmten Handlung fähig. Die Göttin Diana erscheint erst, als die wichtigste Entscheidung bereits getroffen ist, sie ist also strenggenommen gar keine Dea ex machina mehr.
Hier treffen zwei Denksysteme aufeinander, und es ist interessant, dass es die Frau ist, also das weibliche Subjekt, das auf ihrer Handlungsbefähigung insistiert und im Gegensatz zu ihrem Vater die Göttin herausfordert.
Die Figur Iphigénie ist in dem Moment, in dem sie geopfert werden soll – also noch in der Vorgeschichte der Oper – dem Willen der Götter und dem Willen ihres Vaters ausgeliefert, entwickelt sich aber im Laufe der Oper zu einer aktiven, selbst handelnden Figur.
Dass die Göttin am Schluss noch einmal auftritt, das wirkt wie eine Konzession an die Konvention, von der man aus heutiger Perspektive sagen könnte, dass sie sogar als Konvention ausgestellt wird. Die Dea ex machina wird dekonstruiert und bleibt ein leerer Gestus. Die Tochter erhält die Handlungsbefähigung und durchbricht den Kreislauf der Gewalt.
Und die Göttin erkennt die Handlungsfreiheit Iphigénies an und verzeiht.
Am Anfang und am Ende der Geschichte steht die Göttin, aber die wandelt sich und insistiert nicht mehr auf dieser auf Gewalt basierenden Wiederholungsschleife von «Frauenraub fordert Krieg fordert Frauenopfer fordert noch mehr Krieg». Sie insistiert deshalb nicht, weil sie in einer Tochter etwas sieht, was ihr ein anderes Modell vorgibt. Das würde ich potenziell feministisch nennen.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Essay
In der Familiengeschichte des Atridengeschlechts, dem auch Iphigenie entstammt, ist viel Blut geflossen. Begonnen hat die endlose Kette der Gewalt mit Tantalos, dem Urahn der Familie: Er wollte die Allwissenheit der Götter auf die Probe stellen und setzte ihnen seinen eigenen Sohn zum Mahl vor. Die Götter durchschauten ihn und verbannten Tantalos zur Strafe in die tiefsten Tiefen der Unterwelt, wo er seither unvorstellbaren Qualen ausgesetzt ist, den sprichwörtlichen Tantalosqualen. Die Götter verfluchten zudem seine Nachkommen: Jeder seiner Nachfahren solle bis in alle Ewigkeit ein Familienmitglied töten und immer weiter Schuld auf sich laden.
Als eines Tages der Aufbruch des Heeres in den trojanischen Krieg kurz bevorstand, versammelte sich das griechische Heer in Aulis. Der Heeresführer Agamemnon ging auf die Jagd und tötete dabei eine Hirschkuh. Diese war der Göttin Artemis jedoch heilig, und Agamemnon wurde von ihr mit Windstille bestraft. Daraufhin befragten die Griechen einen Seher. Dessen Vision zeigte, dass Agamemnon seine Tochter Iphigenie der Göttin Artemis opfern müsse; zum Wohle seines Heeres war Agamemnon dazu auch bereit. Doch die Göttin verspürte Mitleid mit dem Mädchen, und kurz bevor das Messer des Vaters Iphigenie traf, rettete sie diese und brachte sie nach Tauris. Vor Agamem non aber lag nun eine Hirschkuh, und er glaubte, die Tochter für immer verloren zu haben.
Der Fluch des Tantalos hatte also in Agamemnons Familie ein neues Opfer gefordert. Weitere sollten folgen: Klytämnestra, Agamemnons Frau, verzieh ihrem Mann die Opferung der Tochter nie und ermordete ihn. Um den Tod seines Vaters zu rächen, brachte Orest seine Mutter Klytämnestra um. Seitdem wird Orest von grausamen Rachegöttinnen verfolgt. Um sich von seiner quälenden Schuld zu befreien, befragt Orest das Orakel Apollos. Dieses rät ihm, er solle auf der Insel Tauris die Statue der Artemis holen und nach Athen bringen.
Auf Tauris, wo das barbarische Volk der Taurier unter der Herrschaft des Königs Thoas lebt, muss Iphigenie seit ihrer Rettung durch Artemis der Göttin alle dort Gestrandeten opfern. Der König hatte nämlich die Vision, dass ein Fremder ihn eines Tages umbringen werde.
Kaum auf der Insel eingetroffen, werden Orest und sein Freund Pylades sogleich entdeckt und als Opfer zum Tempel geführt. Die Priesterin Iphigenie erfährt, dass Orest aus ihrer Heimatstadt kommt, und fragt ihn sogleich nach Agamemnons Familie, ohne zu wissen, dass es ihr Bruder ist, der vor ihr steht. Sie bittet ihn, zurück zu segeln und ihrer Familie einen Brief zu überbringen. Doch Orest fleht Iphigenie an, Pylades zu schicken, denn sein Freund verdiene den Tod viel weniger als er selbst. Um sicherzugehen, dass die Botschaft ankommt, erzählt die Priesterin den Griechen, was in dem Brief steht: «Iphigenie lebt.» Da erkennt Orest seine Schwester.
Nun plant Iphigenie die Flucht: Sie berichtet dem König Thoas von den blutigen Taten der beiden Griechen. Sie seien unrein und müssten im Meer gereinigt werden. So auch die Statue, da Orest diese berührt habe. Thoas bleibt zurück, weil er das heilige Ritual nicht stören will, und die Fliehenden haben genug Zeit, um das griechische Schiff zu erreichen. Doch der Wind treibt sie zurück, und Thoas erfährt von dem Verrat. Bevor die Taurier den Strand erreichen, erscheint die Göttin Athene. Unter ihrem Schutz soll die Statue der Artemis nach Athen gebracht werden. Ausserdem befreit sie Orest von seiner Schuld. Thoas akzeptiert das Urteil der Göttin und lässt die Griechen mit der Statue fortsegeln.
Glucks Oper «Iphigénie en Tauride» weicht vom Mythos ab. Pylades segelt mit dem Brief nicht zurück nach Griechenland, sondern versteckt sich auf der Insel, um seinen Freund zu retten. Iphigénie bricht die Opferung ab, als sie ihren Bruder Orest erkennt. Wütend eilt Thoas zum Tempel, doch bevor er die Geschwister umbringen kann, stürmt Pylades hinein und tötet den König. Ein Krieg bricht aus. Da erscheint die Göttin Diana (griechisch Artemis), schlichtet den Streit und befreit Orest von seiner Schuld. Dieser soll bis zu seinem Tod als König über Mykene herrschen, und Iphigénie wird als Priesterin in Athen leben.
Text von Laura Minder.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
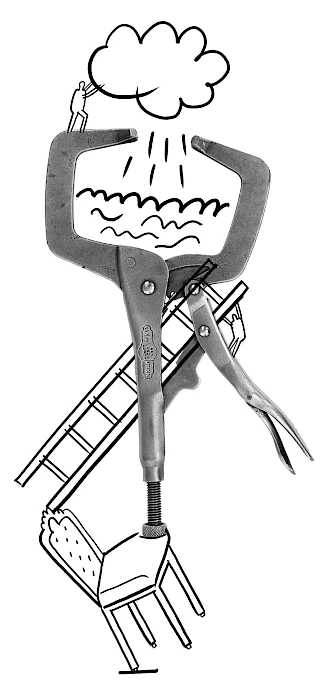
Risse im Bühnenbild
Das Bühnenbild unserer Neuproduktion Iphigénie en Tauride wird in den Rezensionen zumeist als schlichter schwarzer Raum beschrieben – doch das ist nur der erste Eindruck, beim genaueren Hinblicken erweist er sich nämlich bald als spektakulär. Es ist ein schwarzer, perspektivisch sich verjüngender Raum, ohne Ein- und Ausgänge, eine Art Höhle, Höllenschlund oder Abgrund. Keine Naht, nichts ist erkennbar. Und dennoch können in diesem Raum plötzlich Figuren aus dem Nichts erscheinen...
Das Bühnenbild unserer Neuproduktion Iphigénie en Tauride wird in den Rezensionen zumeist als schlichter schwarzer Raum beschrieben – doch das ist nur der erste Eindruck, beim genaueren Hinblicken erweist er sich nämlich bald als spektakulär. Es ist ein schwarzer, perspektivisch sich verjüngender Raum, ohne Ein- und Ausgänge, eine Art Höhle, Höllenschlund oder Abgrund. Keine Naht, nichts ist erkennbar. Und dennoch können in diesem Raum plötzlich Figuren aus dem Nichts erscheinen: Auf einmal öffnet sich ein gleissend weisser Riss, der immer weiter aufgeht, bis Gestalten durch ihn hineindringen können. Sekunden später ist der Riss wieder weg. Nahtlos geschlossen. Pechschwarzes Dunkel. Nur die Gesichter eines Chores zeichnen sich gespensterhaft im tiefen Schwarz ab. Im grossen Finale bricht dann sogar Tageslicht durch unzählige Risse in den Raum und löst ihn nahezu auf, bevor er sich am Ende wieder in den schwarzen Schlund des Nichts verwandelt.
Wir haben dieses magisch wirkende Bühnenbild aus neun fahrbaren Wagen zusammengesetzt, die hintereinander auf einer nach hinten ansteigenden Schräge stehen. Jeder Wagen hat einen Boden, eine Decke und zwei Seitenwände. Der vorderste ist 14 m breit und 9 m hoch, steht direkt hinter der Bühnenöffnung, verjüngt sich aber nach hinten. Die Wände, der Boden und die Decke vom zweiten bis zum letzten Wagen sind so passgenau gefertigt, dass sie nahtlos an den jeweils vorderen Wagen anschliessen und immer kleiner werden: Von vorne gesehen erhält man den Blick in einen liegenden viereckigen Trichter. Der hinterste Wagen bildet den Abschluss und ist nicht einmal mehr 2m breit und hoch. Er ist mit aufklappbaren Seitenwänden ausgestattet, durch welche die Darstellenden unbemerkt im vollkommenen Dunkel verschwinden oder auftauchen können. Die Kanten jedes einzelnen Wagens sind nicht gerade gebaut, sondern wie Bruchkanten zackig geschnitten. Sie passen jeweils zentimetergenau in den nächsten Wagen, so dass man sie aus dem Zuschauerraum nicht wahrnehmen kann.
Um nun Risse im Bühnenbild entstehen zu lassen, müssen wir diese Wagen auseinanderfahren. Dazu haben wir an der Rückseite jedes Wagens Seile angebracht, mit denen wir den Wagen die Schräge hochziehen können. Wenn wir nun z.B. die fünf letzten Wagen hochziehen, entsteht ein Schlitz zwischen dem vierten und fünften Wagen. Zum Schliessen lockern wir die Seile, und die Wagen rollen von allein die Schräge hinunter, bis sie aneinanderstossen und geschlossen sind. Wenn zwischen allen Wagen Risse entstehen sollen, ziehen wir jeden Wagen auf eine ganz bestimmte Position in einer genau definierten Geschwindigkeit. Gut sichtbar werden die Risse, wenn wir von aussen mit sehr hellen Scheinwerfern in den Raum hineinleuchten.
Die Seile wären gefährliche Stolperfallen auf der Bühne. Wir haben sie deswegen ganz unten an den Wagen befestigt und in Nuten im Boden eingelassen.
Da die vorderen grossen Portale fast eine Tonne wiegen und teilweise der ganze Chor mitfährt, können wir natürlich nicht von Hand an den Seilen ziehen: Die Seile werden am Ende der Schräge mit einer Rolle nach oben umgelenkt und sind an unsere Zuganlage angeschlossen. Diese kann computergesteuert und lautlos alles perfekt auf die gewünschten Positionen fahren. Mit welchem genialen Trick wir es schaffen, in diesem «schlichten» Raum nur die Gesichter von über 60 Personen anzuleuchten – und sonst nichts –, ist ein eigenes Kapitel wert und vielleicht einmal an dieser Stelle nachzulesen.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel erschien im MAG 76, Februar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die geniale Stelle
«Aber Meister, was ist das? Hier scheint Euch etwas Menschliches widerfahren zu sein. Wenn Orest von der Ruhe singt, die in sein Herz zurückkehrt, wie könnt Ihr das Orchester eine so unruhige Begleitung spielen lassen?» – «Er lügt! Er hat seine Mutter ermordet. Wie könnte er Ruhe finden?»
Der sich hier so leidenschaftlich verteidigt, ist Christoph Willibald Gluck, der gerade einem erlesenen Kreis von Musikkennern Teile aus seiner neuen Oper vorgespielt hat. Dieses Gespräch, das in nahezu allen Gluck-Biografien zitiert wird, mag so oder ähnlich abgelaufen sein, die Quellen geben verschiedene Varianten, aber selbst wenn es gar nicht stattgefunden haben sollte, wäre dies eine jener Erzählungen, von denen man sagt: «Wenn sie nicht wahr ist, ist sie gut erfunden.» Denn sie öffnet die Augen für das Originelle, das bis dahin im Wortsinne «Unerhörte» der besagten Stelle, an der sich Gluck als grosser Komponist und kühner Neuerer erweist.
Orest ist auf der Flucht vor seinem Gewissen und sucht rastlos nach dem Ort, wo er seiner Schuld ledig werden kann. So geriet er nach Tauris, wo ihm der Tod auf dem Altar der Diana droht und er auch noch seinen Freund Pylades mit in den Strudel der Vernichtung reisst. Als dieser anscheinend zum Tode geführt wird, gerät Orest in wilde Raserei, die in einem Zustand der Schwäche endet, den er für Frieden hält. Gluck gestaltet diesen Moment als ein Arioso, dessen Text von der zurückkehrenden, kaum noch erhofften Ruhe spricht, während die Singstimme mit ihren kleinen Tonschritten und ihrem oft langen Verharren auf einem Ton unmissverständlich hörbar macht, dass es sich um einen Schwächeanfall handelt. Das Orchester umgibt den Gesang mit einem Gewebe, das aus einem Tremolo der Bratschen und einer metrisch unruhigen Begleitung der anderen Streicher geformt ist, wobei die Bratschen fast durchgehend den Ton a spielen, während das Umfeld harmonisch bewegt ist, wodurch sich immer wieder scharfe Dissonanzen ergeben.
Eine solche Separation der Ebenen, vor allem ein derartig widersprüchliches Verhältnis zwischen dem Text und seiner Vertonung war seinerzeit vollkommen neu. Gluck hat sich damit eine Möglichkeit geschaffen, tief in die Seele seines unglücklichen Protagonisten einzudringen: in die Seele des Mörders, der seiner Schuld nicht ausweicht, sondern sie auf sich nimmt, der den wohlfeilen Ausweg des «ich habe nur auf Befehl gehandelt» verschmäht, weil er die Welt und sich von der Befleckung wirklich befreien will. Die hochkomplexe psychische Situation, die Gluck zu schildern hatte, liess ihn das Tor für künftige Entwicklungen der Musikdramatik weit aufstossen und eine Technik entwickeln, die über Mozart, Wagner und die «Nervenkontrapunktik» des Richard Strauss bis in unsere Zeit verbindlich geblieben ist. Und gleichzeitig verweist er mit dieser auffälligen Neuerung darauf, dass an diesem Punkt der Handlung der fundamentale ethische Gedanke der Tragödie erkennbar wird: Glucks Taurische Iphigenie ist die Erzählung von drei Menschen, die in der schlimmsten Bedrohung verzweifelt um die Bewahrung ihrer moralischen Integrität und ihrer Humanität ringen und schliesslich, darin zeigt sich Gluck als aufklärerischer Optimist, eine Veränderung der Weltordnung bewirken, so dass sie den Konflikt siegreich bestehen können.
Text von Werner Hintze.
Dieser Artikel erschien im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Iphigénie en Tauride
Synopsis
Iphigénie en Tauride
Vorgeschichte
Die griechischen Heere haben sich in Aulis versammelt, um in den Krieg gegen Troja zu ziehen. Doch der Wind bleibt aus, die Flotte sitzt im Hafen fest. Der Heerführer Agamemnon erfährt durch einen Seher, dass die Windstille durch den Zorn der Göttin Diana verursacht wurde, welche von ihm fordert, seine Tochter Iphigenie zu opfern. Tatsächlich lässt Agamemnon Iphigenie nach Aulis kommen und führt sie zur Schlachtbank. Doch im letzten Moment wird Iphigenie von der Göttin Diana gerettet; statt ihrer hat Agamemnon eine Hirschkuh getötet. Iphigenie bleibt verschwunden und wird für tot gehalten. Niemand weiss, dass sie seitdem als Priesterin der Diana auf Tauris lebt.
Erster Akt
Ein Unwetter tobt. Die Priesterinnen flehen die Götter an, sie von der blutigen Pflicht, Menschen zu opfern, zu entbinden. Auch als der Sturm sich legt, ist Iphigenie innerlich noch immer in Aufruhr. Sie hat in der Nacht von ihrer Familie geträumt: In diesem Traum wurde ihr Vater Agamemnon von seiner Frau Klytämnestra ermordet, die wiederum Iphigenie bedrängte, ihren Bruder Orest umzubringen.
Thoas, Herrscher auf Tauris und König der Skythen, fordert von Iphigenie neue Menschenopfer. Ein Orakel hat ihm verkündet, dass ihn eines Tages ein Fremder töten wird. Von Todesangst getrieben lässt er seither alle Fremden, die in Tauris stranden, umbringen. Auch zwei junge Griechen, die soeben an der Küste entdeckt wurden, will Thoas opfern lassen. Keiner ahnt, dass es sich bei ihnen um Iphigenies Bruder Orest und dessen Freund Pylades handelt.
Zweiter Akt
Orest wird von furchtbaren Schuldgefühlen gequält. Er hat seine Mutter getötet und fühlt sich nun verantwortlich dafür, dass sein einziger Freund mit ihm in den Tod gehen wird. Pylades hingegen findet Trost in der Vorstellung, gemeinsam mit Orest begraben zu werden.
Die Gefangenen werden getrennt. Alleingelassen, wird Orest im Schlaf von Rachegöttinnen, den Eumeniden, gepeinigt.
Er erschrickt vor einer Erscheinung seiner toten Mutter – diese stellt sich jedoch beim Erwachen als Iphigenie heraus, die gekommen ist, ihren Gefangenen nach seiner Herkunft zu befragen. Sie erfährt, dass dieser wie sie selbst aus Mykene stammt. Als sie ihn nach der Familie des Königs fragt, erfährt sie, dass Agamemnon von Klytämnestra erschlagen wurde und ihr Bruder diesen Gattenmord an seiner Mutter gerächt hat. Orest selbst sei tot; allein seine Schwester Elektra lebe noch in Mykene.
Verzweifelt sieht Iphigenie ihre Vorahnungen bestätigt: Ihre Familie ist ausgelöscht, und auch auf Orest kann sie nicht mehr hoffen.
Dritter Akt
Iphigenie beschliesst, gegen Thoas’ Willen zu verstossen und nur einen der beiden Gefangenen zu opfern; der andere soll nach Mykene eilen und ihrer Schwester Elektra einen Brief überbringen.
Iphigenie zögert lange und entscheidet sich schliesslich für Pylades als Opfer. Doch Orest sieht sich um die Erfüllung seines Todeswunsches und die Erlösung von seinen inneren Qualen betrogen. Er zwingt Iphigenie dazu, ihre Entscheidung zu revidieren. Sie übergibt Pylades den Brief an Elektra.
Allein geblieben schwört Pylades, seinen Freund zu retten.
Vierter Akt
Iphigenie graut vor der Ausführung des Opfers. Orest hingegen sieht in seinem Tod eine Befreiung. Iphigenies Mitleid rührt ihn.
In dem Moment, als sie im Begriff ist, Orest zu töten, beklagt dieser, den gleichen Opfertod erleiden zu müssen wie einst seine Schwester Iphigenie.
Die Geschwister erkennen sich. Thoas hat unterdessen von Iphigenies Verrat erfahren und fordert die sofortige Tötung des Opfers. Dass Orest Iphigenies Bruder ist, berührt ihn nicht. Als Thoas zum Messer greift und beide selbst töten will, erscheint der zurückgekehrte Pylades und ersticht ihn.
Aufruhr droht.
Da erscheint die Göttin Diana und verkündet den Willen der Götter: Orest sei von seinen Schuldgefühlen befreit und kehre gemeinsam mit Iphigenie nach Mykene zurück.