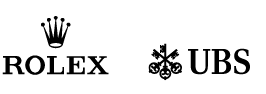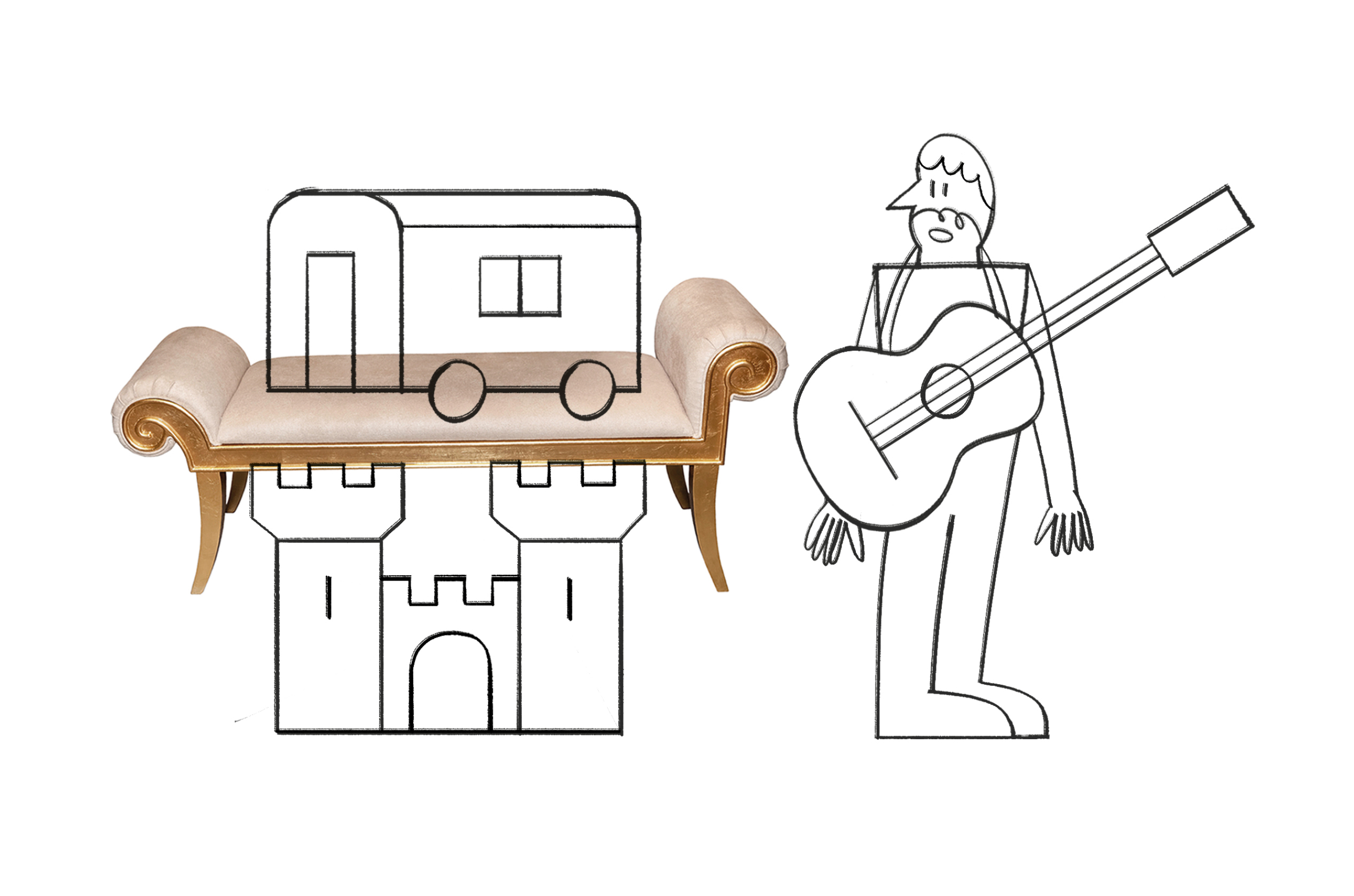Il trovatore
Dramma lirico in vier Teilen von Giuseppe Verdi (1813-1901)
Libretto von Salvatore Cammarano, fertiggestellt von Leone Emanuele Bardare,
nach «El trovador» von Antonio García Gutiérrez
In italienischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 2 Std. 45 Min. inkl. Pause nach ca. 1 Std. 15 Min. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Gut zu wissen
Pressestimmen
«[…] was für ein Wunder diese Aufführung geschafft hat: Sie hat dieses Werk nicht gebändigt, sondern zeigt seine Wucht, seine Widersprüche, seinen ganzen emotionalen Wahnsinn»
Tagesanzeiger, 25.10.2021«Das Herz und der Kopf aber, der das Geschehen ebenso befeuert wie im Zaum hält, ist Noseda.»
NZZ, 25.10.2021«Musikalisch ein Fest auf erstklassigem Niveau»
Deutschlandfunk, 25.10.2021«Kein Zweifel, da kommt einer nach Zürich, der gross denkt und etwas zeigen will.»
Kulturtipp, Nr.23/21«Um ein Haar hätte man mitgesungen»
FAZ, 27.10.21
Sommers Oper to go
«Lodernde Flammen schlagen zum Himmel auf… schon naht das Opfer!» Eine vermeintliche Hexe wird verbrannt - und die Rache für diese Bluttat zerstört auch das Leben der nächsten Generation. Erleben Sie die Kurzfassung der schauerlichen Story von «Il trovatore» von Salvatore Cammarano und Giuseppe Verdi bei «Sommers Oper to go».
Interview

Kreaturen, die aus der Hölle kommen
Die britische Regisseurin Adele Thomas inszeniert «Il trovatore», der am 24. Oktober 2021 Premiere hatte. Im Interview spricht sie über die Tiefgründigkeit der Figuren, warum zu Tragödien immer auch Komik gehört und was Verdis Oper mit den Schreckensbildern des Hieronymus Bosch zu tun hat.
Adele, dies ist deine erste Operninszenierung hier am Opernhaus Zürich. Wie war dein Weg bisher, welche Erfahrungen haben dich geprägt?
Die ersten zehn Jahre meiner Karriere habe ich im Schauspiel gearbeitet, aber das war nicht unbedingt das, wovon ich geträumt hatte. Als ich mit Anfang 20 zum ersten Mal Alban Bergs Wozzeck auf der Bühne sah, hat das alle meine Sinne geöffnet. Ich verstand, dass Oper das war, was ich immer machen wollte. Im Grunde habe ich aus allen meinen Schauspielinszenierungen Opern gemacht. Ich hatte immer Live-Musik dabei, manchmal DJs, oft auch einen Chor oder ein Alte-Musik-Ensemble.
Trotzdem hat es lange gedauert, bis man dir eine Oper angeboten hat. Warum?
In Grossbritannien gelte ich nicht als klassische Opernregisseurin. Vor allem, weil ich eine junge Frau bin. Dazu kommt, dass sich der Weg über Regieassistenzen für mich nicht richtig angefühlt hat. Ich bin eine schreckliche Assistentin! Und so dachte ich lange, dass ich niemals in der Oper arbeiten würde. Ich habe die Orestie von Aischylos am Globe Theatre inszeniert, als wäre es eine Oper, wenn ich schon nicht an einem Opernhaus arbeiten durfte… Daraufhin bekam ich dann die Chance, am Opernhaus in Belfast Così fan tutte zu inszenieren. Es folgte Georg Friedrich Händels Berenice am Royal Opera House; diese Inszenierung wurde für einen Laurence Olivier Award nominiert, und seitdem bekomme ich nur noch Angebote für Operninszenierungen.
Wie würdest du deine Theatersprache beschreiben?
Die Komödie ist für mich sehr wichtig. Ich bin überzeugt davon, dass die Natur des Menschen im Grunde komisch ist. Auch wenn Geschichten extrem tragisch sind…
… wie das im Trovatore zweifellos der Fall ist.
Es gibt in jeder tragischen Geschichte immer auch komische Elemente. Meine Theatersprache ist ausserdem sehr physisch, oft auch stilisiert. Ich arbeite eng mit der Choreografin Emma Woods zusammen. Aber es muss immer alles in den Emotionen verankert sein. Das Schönste ist für mich, wenn die Zuschauer hinterher sagen: Das ging aber schnell vorbei! Dann habe ich meinen Job gut gemacht. Ich denke immer an die Zuschauer, wenn ich inszeniere. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich nicht mit der Oper aufgewachsen bin, dass ich sie nicht einfach als selbstverständlich ansehe. Ich arbeite dafür, dass ich die Menschen erreiche und dass das, was sie sehen, in ihren Herzen ankommt.
Diese Inszenierung ist deine erste Begegnung mit Verdi. Was fasziniert dich an diesem Opernkomponisten?
Verdi ist ein fantastischer Dramatiker. Alles, was er möchte, und wovon er auch in seinen Briefen immer wieder schreibt, ist wirkungsvolles Musiktheater. Die Art und Weise, wie er durch die Musik die Geschichte erzählt, ist absolut faszinierend. Wenn man sich mit dem Trovatore beschäftigt, erfährt man natürlich erstmal, dass die Geschichte absolut unverständlich und lächerlich ist…
Denkst du das auch?
Nein, das denke ich nicht! Wir haben die Geschichte im 15. Jahrhundert angesiedelt, in einer fantastischgrotesken Welt, wie sie uns in den Bildern von Hieronymus Bosch begegnet. Der Plot des Trovatore passt gut in diese Welt, in der die Imagination der Menschen zuweilen eine wichtigere Rolle spielt als die Realität. Die Beziehungen zwischen den Figuren, die Situationen, denen sie ausgesetzt sind, ihre Emotionen – all das ist grossartig. Indem wir es nicht realistisch erzählen, wird es glaubwürdiger und – hoffentlich – auch verständlicher. Hier sind ganz eindeutig magische, übernatürliche Kräfte am Werk. Es gibt viel Aberglauben in diesem Stück und sehr tief sitzende Erinnerungen. Für mich könnten diese Figuren keine heutigen Menschen sein, sie gehören eindeutig in die Zeit des 15. Jahrhunderts. Klar, Verdis Musik ist die Musik des 19. Jahrhunderts. Aber wenn man das Drama liest, das der Oper zugrunde liegt, dann spürt man darin die Welt eines Robin Hood oder eines Henry V.
Es sind vor allem die wirkungsvollen Situationen und die extremen emotionalen Zustände der Figuren, die für Verdi im Zentrum stehen und an der sich seine Musik entzündet.
Absolut. Und meine Inszenierungsarbeit geht ganz stark von der Musik aus. Im Grunde ist Verdi sehr leicht zu inszenieren: Man weiss genau, in welchem Takt, in welcher Note jemandem das Herz bricht… Man kann sich vollkommen auf die Musik verlassen. In der britischen Theatertradition kommt die Interpretation immer aus dem Text – oder eben aus der Musik; es ist alles schon da, man muss nur tief genug graben. Diese archäologische Arbeit macht mir grossen Spass.
Wenn du es auf einen Punkt bringen müsstest: Worum geht es für dich im Trovatore?
Das Thema, das den grossen Bogen über das Stück spannt, ist Azucenas «mi vendica», ihr Schrei nach Rache. Es ist, als ob ein Fluch entfesselt wurde von jemandem, der diese Worte murmelt. Im weiteren Verlauf geht es um eine geradezu ekstatische Verbindung der Figuren zur Welt und zum Universum. Ekstase und Obsession treiben den Plot voran.
Auch das Geschichten-Erzählen spielt in der Handlung eine wichtige Rolle, vieles hängt davon ab, auf welche Weise eine Geschichte erzählt wird.
Es ist grossartig, dass das Stück Der Troubadour heisst, denn damit ist ja ein Geschichtenerzähler gemeint. Im Grunde hat jede Figur ihren Troubadour-Moment – einen Moment also, in dem sie oder er eine Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt. Zu Beginn erzählt Ferrando einer Gruppe von Männern seine Version der Geschichte aus der Vergangenheit, auf der die Oper beruht; später erzählt Azucena dieselbe Geschichte aus ihrer Perspektive – und ganz anders. Leonora wiederum erzählt, wie sie den Troubadour kennengelernt hat. Die Art und Weise, in der Geschichten weitergegeben werden, bestimmt das Handeln der Figuren.
Das Geschichten-Erzählen kann auch als Manipulation eingesetzt werden.
Ja, und dabei werden bewusst Dinge angesprochen, die leider nach wie vor existieren, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus zum Beispiel. So setzt man – wie Ferrando in der ersten Szene des Stückes – obsessive, gefährliche Kräfte in Gemeinschaften frei, die nicht mehr aufzuhalten sind.
Diese Fremdenfeindlichkeit richtet sich gegen Azucena, die im Stück als «Zigeunerin» bezeichnet wird.
Dass sie «Zigeunerin» genannt wird, weist darauf hin, dass es um eine Aussenseiterin, eine Randständige geht, deren Fremdheit Ängste auslöst. In der Zeit, in der das Stück spielt, gab es nachweislich in Spanien noch gar keine «Zigeuner». Ich erinnere mich an das Theaterstück Die Hexe von Edmonton aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Hauptfigur ist eine alte Frau, die von der Gemeinschaft als Hexe bezeichnet wird; und da nun einmal alle sie so sehen, beschliesst sie, auch eine Hexe zu werden, und geht einen Bund mit dem Teufel ein. Sie sagt den unglaublichen Satz: «Ich bin nur eine Grube, in die die Menschen ihren Dreck hineinwerfen.» Azucena ist ein bisschen wie diese Frau. Sie hat diesen Hintergrund der «Zigeuner», der Nicht-Sesshaften, und wird als gefährliche Hexe wahrgenommen. Sie ist sogar innerhalb der Gemeinschaft, der sie angehört, eine Aussenseiterin. Ihr gilt Verdis volle Sympathie – es geht ihm ja gerade darum, das Leiden dieser Aussenseiterin sichtbar zu machen.
Azucena ist die eigentliche Hauptfigur der Oper. Eine Zeit lang wollte Verdi sogar die Oper nach ihr benennen.
Für mich ist sie eine der faszinierendsten Figuren der gesamten Opernliteratur. Sie trägt ständig eine Maske und wechselt diese Masken fast mit jedem Satz, den sie sagt. Sie verbirgt immer etwas vor uns. Sie ist nicht fassbar und gleichzeitig extrem verletzlich. Viel ist darüber geschrieben worden, wie wild sie sei und wie stark, ihre Musik ist extrem spannungsvoll und explosiv. Und doch ist sie eben auch verletzlich. Wir wissen nie, woran wir sind mit ihr. Und vielleicht weiss sie das selbst auch nicht so genau; man hat jedenfalls den Eindruck, dass sie schon zu Beginn des Stückes langsam den Bezug zur Realität verliert. Sie versucht verzweifelt, die Kontrolle über ihr Leben zu behalten.
Und die Kontrolle über Manrico, der in dem Glauben aufgewachsen ist, ihr Sohn zu sein, der er aber in Wirklichkeit gar nicht ist.
Die Beziehung der beiden ist sehr komplex; sie sind voneinander abhängig und zerstören sich gleichzeitig gegenseitig. Manrico ist zwar der Troubadour, der Geschichten erzählt und singt, aber er ist auch ein Krieger, der mit den «Zigeunern» aufgewachsen ist. Mit der Liebe zu Leonora erlebt er zum ersten Mal ein Gefühl, das sich nicht auf seine Mutter bezieht. Seine Musik verändert sich ständig. Je nachdem, mit wem er gerade auf der Bühne ist, kann sie einen vollkommen anderen Charakter haben. Manrico ist nicht der aktive, selbstbewusste Held, den man vielleicht erwarten würde, sondern er ist so etwas wie ein Spiegel für die anderen Figuren, die sich in ihm erkennen. Er hat etwas sehr Unschuldiges.
Als er erfährt, dass er nicht der leibliche Sohn Azucenas ist, verliert er komplett den Boden unter den Füssen.
Im Grunde ist er von Beginn an in einem Krisenzustand, in dem er nicht wirklich weiss, wer er ist und wohin er gehört. Das verstärkt sich in dem Moment, in dem ihm Azucena erzählt, wie sie damals ihr eigenes Kind ins Feuer geworfen hat. Diese tiefe Unsicherheit, die Verletzlichkeit, die übrigens auch Graf Luna – Manricos Gegenspieler – empfindet, entspricht nicht dem traditionellen Bild von Männlichkeit.
Und wie würdest du Leonora charakterisieren?
Sie erinnert mich an Frauen, die Heilige sehen können oder religiöse Erscheinungen haben. Und sie hat selbst die rebellische Seite einer weiblichen Heiligen. Sie verhält sich nicht, wie eine Hofdame sich verhalten sollte. Sie hat etwas Wildes und damit auch eine Verbindung zum Ekstatischen, das ich sehr wichtig finde. Im 20. Jahrhundert wäre sie vielleicht ein Hippie gewesen.
Am Schluss ist sie bereit, ihr Leben für Manrico zu opfern.
Sie macht eine Entwicklung durch, wie man sie eigentlich vom Helden des Stückes erwarten würde. Wenn sie zum ersten Mal davon singt, dass sie bereit ist, für Manrico zu sterben, scheint sie wie ein Kind, das sich vorstellt, eine Heldin zu sein. Später dann wird das sehr real: Sie bringt dieses Opfer.
Ein Stück voll von Dunkelheit und Tod – wo findest du hier die komischen Elemente, von denen du vorhin sprachst?
Verdi war ein grosser Bewunderer von Shakespeare. Und diese komischen Elemente kommen ganz klar von Shakespeare, der gerade in den düstersten Momenten, den tragischen Höhepunkten den Clown auftreten lässt. Genauso wie das übrigens in vielen mittelalterlichen Stücken der Fall ist. So ist doch auch das Leben! Das Komische gehört ebenso dazu wie das Tragische.
Und es sind dann genau diese Kontraste, die scharfen Gegensätze, die die dramatische Wirkung ausmachen.
Als ich das erste Mal mit unserem Dirigenten Gianandrea Noseda gesprochen habe, sagte er zu mir: Was auch immer du vorhast mit deiner Inszenierung, akzentuiere die Kontraste in diesem Stück! Die Musik ändert sich von einem Moment zum anderen, sie kann vom schönsten Stillstand ins grösste Chaos umschlagen. Das ist in dieser Oper wirklich extrem.
Diese Premiere wird die erste Produktion sein, in der unser Chor endlich wieder in einer Neuinszenierung auf der Bühne steht. Wie ist die Arbeit mit dem Chor für dich? Ich liebe es, mit dem Chor zu arbeiten! Die Kraft, die entsteht, wenn so viele Menschen auf der Bühne singen und spielen, ist einfach unglaublich. An diesem Chor gefällt mir sehr, dass die Sängerinnen und Sänger bereit sind, wirkliche Charaktere auf die Bühne zu bringen, mit vielen wunderbaren Details. Man wird mindestens vier Augenpaare brauchen, um alles zu sehen!
Zum Chor kommen auch noch sechs Tänzer dazu…
Unser Tanzensemble wird nicht nur tanzen, sondern unterschiedlichste Charaktere darstellen und eine Dynamik in die Inszenierung bringen, die der Musik entspricht. Sie sind dämonische, nicht menschliche Kreaturen und repräsentieren die dunkle, zerstörerische Kraft, die aus der Hölle kommt – inspiriert von Gemälden von Hieronymus Bosch. Ich freue mich sehr über die Arbeit mit diesem fantastischen Ensemble!
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Hintergrund
Ein Begriff voller Widersprüche
In Giuseppe Verdis Oper «Il trovatore» spielt die «Zigeunerin» Azucena eine zentrale Rolle. Meint der Begriff der «Zigeunerin» nur eine romantische Opernkonvention, oder ist er diffamierend? Ein Gespräch aus dem Jahr 2021 mit der Schweizer Schriftstellerin Isabella Huser, die ein Buch mit dem Titel «Zigeuner» geschrieben hat.
Isabella Huser, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel «Zigeuner». In den letzten Monaten habe ich gelernt, dass man die Bezeichnung «Zigeuner» eigentlich gar nicht mehr verwenden sollte, weil sie diskriminierend ist. Warum haben Sie trotzdem diesen Titel gewählt?
Das Buch ist ein Roman und handelt von mir und meinen Leuten, von ihrer Geschichte in diesem Land seit napoleonischen Zeiten. Ich gehe der Geschichte meiner jenischen Vaterfamilie nach. Das Buch ist eine Auseinandersetzung mit dem Begriff und der Erfindung «Zigeuner». Für mich war es keine Frage, dass ich diese Fremdbezeichnung – in meinem Fall nunmehr auch Selbstbezeichnung – verwende. Manche meinen, wenn man ein Wort verbiete, sei damit auch die Problematik aus der Welt. Das ist sie nicht, es braucht die Auseinandersetzung. «Zigeuner» ist ein vielschichtiger Begriff, der historisch oft diffamierend verwendet wurde, nicht nur für Roma und nicht nur für Jenische. Er reicht viel weiter.
Wo kommt der Begriff her?
Die Forschung lässt die Frage offen. Eine viel zitierte These lautet, dass die ersten fremden reisenden Familienverbände, die in Europa angetroffen wurden, als Ägypter galten: «les Egyptiens», daher «gypsies», «Gitanos». Das ist aber nicht ganz schlüssig. Die Herkunft der Bezeichnung ist nicht geklärt. Das Interessante an dieser Geschichte: Die ersten fremden Reisenden wurden als Pilger betrachtet, Vertriebene aus Ägypten auf siebenjähriger Büsserreise. Diese Herkunftsgeschichte erzählt von einem Volk, das zur Wanderschaft verdammt ist.
Als Herkunftsort der Roma wird heute oft Indien genannt.
Stimmt, wobei es viele verschiedene Roma-Volksgruppen gibt. Die Jenischen wiederum haben von ihrer Abstammung her nichts mit den Roma zu tun.
Wo kommen die Jenischen her?
(Lacht.) Wenn man auf Jenische zu sprechen kommt, folgt stets die Frage nach dem Ort der Herkunft. Jenische leben in Süddeutschland, in der Schweiz, in Österreich, aber auch in Belgien und weiteren Regionen vor allem Westeuropas. Die hiesigen Jenischen sind schweizerischen Ursprungs wie andere Schweizerinnen und Schweizer auch. Meine Vorfahren stammen aus der Zentralschweiz, wie ich seit den Recherchen für meinen Roman weiss.
Ist denn der Begriff «Zigeuner» aus Ihrer Sicht gar nicht diskriminierend?
Doch, klar, immer dann, wenn das Wort als Fremdbezeichnung für eine Person oder eine Gruppe verwendet wird. Ich selbst nenne mich «Zigeunerin», weil ich, wie ich heute weiss, in einem sehr konkreten Sinn die Geschichte der Vorstellungswelten verkörpere, die diese Bezeichnung birgt. Ausserdem, weil ich mit einem gewissen Familiendünkel aufgewachsen bin. Mein Vater sagte stolz: «Wir sind Zigeuner!» Für mich ist das Wort weiterhin auch mit anderen Wertungen verbunden.
Wie sollen wir hier am Opernhaus also mit diesem Begriff umgehen – zum Beispiel in der Besetzungsliste, in der ja ein «Alter Zigeuner» vorkommt?
Ich würde die Bezeichnung in Anführungszeichen setzen. Damit ist die komplexe Frage, die Sie ansprechen, zwar nicht vom Tisch. Aber die Anführungszeichen sind ein Symbol für eine Bewusstmachung. Der Gebrauch des Wortes «Zigeuner» muss in der Kunst unbedingt weiterhin möglich sein. Sonst verlöre man diese Werke. Die darin gespiegelten romantisierenden und herabwürdigenden Bilder können ja nicht einfach durch andere ersetzt werden. Wodurch denn? Diese Werke machen uns vielmehr bewusst, durch welche Bilder wir geprägt sind.
Die «verführerische Zigeunerin» zum Beispiel, wie wir sie aus Bizets Carmen kennen. Welche Bilder hat man noch mit «Zigeunern» verbunden?
In der Kunst wird die «Zigeunerfigur» oft mit sinnlichen bis übersinnlichen Welten in Verbindung gebracht. «Zigeunerinnen» können wie Hexen zum Schaden anderer Magie einsetzen. «Zigeuner» sind aus der Gesellschaft Ausgestossene, üben aber auch eine grosse Faszination auf sie aus. Klaus-Michael Bogdal, der in seiner Studie Europa erfindet die Zigeuner die «Zigeunerbilder» anhand von Werken der Kunst erforscht, schreibt, dass «Zigeuner» etwas darstellen, zu dem man jederzeit selbst werden kann. Dann nämlich, wenn man von der sozialen Leiter fällt und den gesellschaftlichen Halt verliert. Man fürchtet sie und projiziert schlimmste Verbrechen auf «die Zigeuner»: Brunnen vergiften, Kinder entführen. Dies sind auch in der Kunst wiederkehrende Schreckensbilder.
In Il trovatore wurde die Mutter der Azucena, ebenfalls eine «Zigeunerin», als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt, weil sie angeblich das Kind des Grafen verhext hatte. Beiden, «Zigeunerin» und Hexe, werden magische Kräfte zugeschrieben, oft in Verbindung mit dem Teufel. Das Unfassbare, nicht Beherrschbare löst archaische Ängste aus. In der Kunst ist das Unfassbare in dieser Ausprägung oft weiblich. Hier dürften erotische Projektionen eine Rolle spielen.
Sie schildern in Ihrem Buch auch, dass «Zigeuner» in der Schweiz nicht immer gleich stark ausgegrenzt waren.
Die Geschichte der Jenischen in der Schweiz ist bislang erst bruchstückhaft erforscht. «Zigeuner» werden in der Geschichtsschreibung erst dann sichtbar, wenn sie mit der Macht zusammenstossen. Dies ist im 19. Jahrhundert, während die moderne Schweiz entsteht, wiederholt der Fall. Nach dem Ende der helvetischen Republik um 1800 und bis weit in die neue Eidgenossenschaft hinein werden viele jenische Familien aus ihren angestammten Orten vertrieben. Andere, die wie meine Ahnen als Händler reisende Berufe ausüben, haben Probleme, an Papiere zu kommen, Heimatscheine, Ehebewilligungen, Reisepässe. Für Jenische und andere sogenannte Heimatlose wurde alles restriktiver. Viele denken, «Zigeuner» reisen herum, ohne Ziel und Plan sozusagen. So ist es nicht und war es wohl nie. Reisende Jenische wie meine Händlerahnen hatten eine Handelsroute, man kannte seine Abnehmer, wusste, wo man unterkommen konnte. Im Frühling brach man auf, kam im Herbst mit neuer Ware in die Heimat zurück, wo man in der Regel auch überwinterte.
Also stimmt die Vorstellung, «Zigeuner» seien Heimatlose, die nirgendwo hin gehören, gar nicht…
Selbst die reisende Lebensweise sehe ich als Zuschreibung. Im Fall meiner jenischen Vorfahren ist bereits in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts dokumentiert, dass einige sich als reisende Händler verstanden, andere hingegen sich niederlassen wollten. Das wurde ihnen jedoch verwehrt. Es gibt allerdings auch Jenische, die keineswegs mit mir einverstanden sind, wenn ich sage, dass selbst die reisende Lebensweise eine Zuschreibung ist, die von einigen mithin – und dies trifft auch auf meine direkten Vorfahren zu – zu ihrem ureigenen Alltag und einem wichtigen Teil ihrer Kultur gemacht worden ist, keine Frage! Die Geschichte ist genauso komplex wie widersprüchlich.
Auch Ihre Familie war von der berüchtigten Aktion der Pro Juventute betroffen, die jenischen Familien in der Schweiz ihre Kinder zum Teil mit Gewalt weggenommen hat, um sie in Pflegefamilien oder Heimen unterzubringen.
Die Stiftung Pro Juventute hat zwischen 1926 und 1973 jenische Familien systematisch verfolgt, um ihnen die Kinder wegzunehmen. Dies mit behördlicher Unterstützung und mit der Begründung, dass sie – weil die Eltern «Vaganten» seien – vernachlässigt würden und nicht zur Schule gingen. Wenn wir an die Vorstellungen denken, «Zigeuner» würden Kinder stehlen, dann erscheinen uns diese als eine groteske Umkehrung der Realität! 1972 ist dann im Beobachter ein erster Artikel über diese programmatischen Kindswegnahmen erschienen. Es dauerte ein weiteres Jahr, bis das sogenannte Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse aufgelöst wurde. Ich selbst war damals 14 Jahre alt. Für mich war es ein Schock zu erkennen, dass die Verfolgung und die Flucht, von der mein Vater uns Kindern erzählt hatte, wahr sein musste. Ich hatte seine Erzählung nur für eine Geschichte gehalten – nicht möglich, nicht bei uns! Bei meinen Recherchen wurde bald klar, dass vor allem jenen Familien Kinder weggenommen wurden, die gar nicht fähig waren zu reisen. Meine Grosseltern – sie wohnten damals am rechten Zürichseeufer, mein Vater war gerade eingeschult worden – sind davongekommen, weil sie Musikanten waren. Sie konnten mit ihren sechs Kindern fliehen und reisend überleben. Sie flohen ins Tessin, fanden in Lugano eine Anstellung in einem Hotel, wo sie den Hotelgästen zum Nachmittagstee aufspielten. Nach zwei Jahren sind sie in die Deutschschweiz zurückgekehrt und bald mit ihrer Familienkapelle bekannt geworden, was ihnen einen gewissen Schutz bot.
Dabei haben sie allerdings keineswegs, wie es dem Klischee entsprechen würde, schnulzige «Zigeunerweisen» gespielt, sondern Schweizer Volksmusik.
Es gibt viele Umkehrungen in dieser Geschichte! Es begann in den 1920er Jahren im Zürcher Niederdorf, dass Städter sich Sennenkutten überstreiften und Volksmusik wie von der Alp spielten. Das Bild der traditionellen Schweizer Volksmusik war geschaffen. An der Entstehung der hiesigen Volksmusik, wie wir sie heute kennen, sind viele jenische Familien wie die meine beteiligt. Für meine Grosseltern wäre es gefährlich gewesen, sich nach ihrer Flucht wieder irgendwo anzumelden und die Kinder zur Schule zu schicken. Sie mussten also Vorurteile erfüllen, um wegzukommen – auf der anderen Seite haben sie sich als Bergler verkleidet und Schweizer Volksmusik komponiert. Die Kinder sollten nicht mehr Jenisch sprechen, und mein Vater hat in bestimmten jenischen Kreisen sogar verschwiegen, dass er Kinder hat, um uns nicht zu gefährden. Trotzdem waren wir zuhause stolz darauf, «Zigeuner» zu sein. Übrigens hatte auch ich als Kind die Vorstellung, dass «Zigeuner» reisen, ohne dass ich mich darüber gewundert hätte, dass das bei uns nicht so war.
Wenn Sie nun in die Oper gehen und Il trovatore anschauen, haben Sie dann Angst, dass da lauter Klischees auf der Bühne zu sehen sind?
Nein, die Bilder sind nun mal geprägt. Ich bin jedes Mal gespannt zu sehen, was heute eine Regisseurin daraus macht.
Kann man denn aus Ihrer Sicht einen «Zigeunerchor», in dem davon gesungen wird, wie schwer die Arbeit der fahrenden «Zigeuner» ist und dass nur das hübsche «Zigeunermädchen» einen zu dieser Arbeit motivieren kann, heute noch auf die Bühne bringen? Wie würden Sie damit umgehen?
Unbedingt sollen diese Darstellungen auf die Bühne gebracht werden! Wie? Ich bin keine Regisseurin. Die Stücke sollen leben. Wenn nicht, wäre das Geschichtsverleugnung. Es bringt nichts, so zu tun, als hätte es diese Klischees und Stereotype nie gegeben. Es hat sie gegeben, es sind Vorstellungen daraus erwachsen, und mit denen müssen wir uns heute auseinandersetzen.
Isabella Huser ist eine Schweizer Schriftstellerin, Übersetzerin und Filmproduzentin. 2008 erschien ihr erstes Buch «Das Benefizium des Ettore Camelli», 2021 folgte der Roman «Zigeuner». Beide Bücher sind im Bilgerverlag erschienen.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
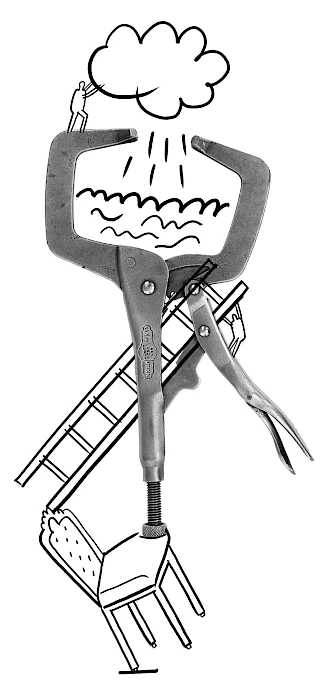
Von unten nach oben
Wenn Sie einmal eine Technische Direktorin oder einen Technischen Direktor ärgern möchten, dann denken Sie sich ein Bühnenbild aus, bei dem einfach alles von unten nach oben fährt. Ich bin mir sicher, dass sich unsere Regisseurin Adele Thomas und ihre Bühnenbildnerin Annemarie Woods das Bühnenbild zu Trovatore nicht ausgedacht haben, um mich zu ärgern – aber hier kommt sehr viel von unten: Personen, die aus dem Boden herausklettern, Zähne, Vorhänge und eine Treppe. Ja, Sie haben richtig gelesen, riesige Zähne. Aber wo liegt das Problem?
Wenn Personen aus Klappen aus dem Boden kommen sollen, dann muss der Boden von unten zugänglich sein. Das geht nur, wenn wir unseren Bühnenboden absenken und unter das Bühnenbild ein veritables «Kellergeschoss» einbauen. Das sieht das Publikum zwar nie – dafür sieht es aber die Klappen, die in der Decke des Kellergeschosses eingebaut sind. Natürlich sind in diesem Geschoss dann auch Leitern fest eingebaut, damit man von unten durch die Klappen auftreten kann. Klingt aufwändig, ist es auch. Und dann sollen im Bühnenbild über eine Breite von 16 Metern von unten die Fangzähne eines riesigen Gebisses auftauchen. Das lösen wir, indem wir in den Boden des «Kellergeschosses» über die ganze Breite einen Schlitz machen. In diesen Schlitz steckt die Bühnentechnik beim Aufbau die Zähne und befestigt diese unten an einem stabilen Träger. Nun sind die Zähne unsichtbar unter der Bühne.
Aber wie bringt man die Zähne nun aus dem Boden nach oben? Idee: Wir hängen den Träger an Seile und ziehen den einfach hoch. Moment: Dann sieht man ja die ganze Zeit die Seile. Das ist schlecht. Deswegen lassen wir alle Seile, die das Publikum sieht, weg und befestigen nur ganz aussen je ein Seil links und ein Seil rechts, mit dem man den Träger hochziehen kann. Und schon kommen die Zähne von unten aus dem Boden. An einem fast 16 m langen Träger ist das schon eine Herausforderung.
Da wir schon bei Herausforderungen sind: Hinter den Zähnen steht über die ganze Breite des Bühnenbildes eine Treppe, die nach hinten immer höher ansteigt. Der Mittelteil dieser Treppe muss hochfahren können, während Personen darauf stehen. Einfache Übung: Da wir ja ein Kellergeschoss haben, können wir in dieses Kellergeschoss nun auch noch eine grosse Maschine einbauen, die dieses Treppenstück um einen Meter anheben kann. Dabei müssen allerdings Führungen eingebaut werden, damit das Teil nicht wackelt. Schon ist aus der einfachen Übung eine schwere Aufgabe geworden.
Getoppt wird das alles vom Feuervorhang. Ein wunderschön bemalter Vorhang, der – Sie ahnen es – von unten aus dem Boden hochfahren muss. Mein Versuch, doch wenigstens diesen ganz einfach von oben mit unseren Zügen nach unten fahren zu lassen, scheiterte, denn schliesslich lodern Flammen von unten nach oben. Wir haben also einen weiteren Schlitz in den Boden gemacht, in dem der Vorhang bereit liegt. Um den Vorhang aus dem Schlitz zu bekommen, haben wir diesen an einen weiteren stabilen Träger gehängt und diesen genau so in den Schlitz gesteckt, dass die Oberkante mit dem Boden abschliesst. Dann haben wir ihn in Bodenfarbe angemalt. So sieht das Publikum noch nicht mal den Schlitz. Auch hier sind wieder zwei Seile links und rechts ausser Sicht, an denen der Träger mit dem Vorhang von unten aus dem Boden gezogen werden kann – und das, bis das Feuer die ganze Bühnenöffnung bedeckt. So wie es sein muss: Lodernd von unten nach oben.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 86, Oktober 2021.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Auf der Couch
Die Handlung von Il trovatore spielt zwar im ausgehenden Mittelalter mit Klöstern Burgen und Rittern. Aber die sozialen Spannungen des 19. Jahrhunderts kann in diesem Textbuch jeder sehen, der sie sehen will. Es geht um den Kampf zwischen dem Bürgertum und der nach Napoleons Niederlage erstarkten, in ein primitives, ja grausames Licht getauchten Feudalherrschaft.
Damit eine romantische Geschichte daraus wird, ist der Trovatore Manrico ein entführter Prinz, Ziehsohn einer Zigeunerhexe und Bruder des Fürsten von Aragon. Wie viele adoptierte Kinder, die nicht von Anfang an über ihre Vergangenheit aufgeklärt werden, fühlt sich Manrico zwischen Baum und Borke, ein Kämpfer der in Turnier und Duell den Adeligen nicht nur Paroli bietet, sondern edler im Gemüt ist als diese. Dieser Held hat sich selbst in seiner Kunst gefunden. Seine mächtigsten Verbündeten sind die Frauen sein ärgster Feind ist er selbst, denn die frühe Belastung des Selbstgefühls führt dazu, dass Eifersucht nicht verarbeitet werden kann. Wer heimatlos wurde, sucht in der Liebe das Absolute und handelt im Liebeszweifel impulsiv. Ein sprechendes Beispiel ist Othello.
Das romantische Skript ignoriert energisch die feudale Realität, in der die Dame des Herzens zwar in einen Liebeshimmel gehoben, aber keineswegs angefasst werden durfte. Die fahrenden Sänger des Mittelalters haben die romantische Liebe als spirituelle Minne erfunden, aber erst im 19. Jahrhundert dürfen sich beispielsweise Käthchen von Heilbronn und ihr Ritter in die Arme nehmen (und auch das nur, weil Käthchen des Kaisers uneheliche Tochter ist).
Im 19. Jahrhundert wird der triviale Liebes und Schicksalsroman populär. «Zigeunerinnen» entwickeln eine gerade zu teuflische Neigung, hochgeborene Kinder zu entführen. Diese wachsen zu rätselhafter Blüte, Tugend und Schönheit heran und fühlen sich dem fahrenden Volk gleichzeitig zugehörig und nicht zugehörig. Dann kommt, was kommen muss: eine Person «von Stand» mit Schloss und Titel verliebt sich in ein Geschöpf, dessen Wurzeln so gar nicht zur Blüte passen. Und ehe alles kaputt geht, wird dann doch die Grafenkrone in der Windel entdeckt, die eine reuige Ziehmutter aus der Truhe kramt.
Freud hat dieses Motiv als narzisstische Fantasie denunziert («Familienroman der Neurotiker»). Das Kind wünscht sich fürstliche Eltern, allzu gering erscheinen ihm Mutter und Vater. Aber die Deutung lässt sich ausweiten zu dem zentralen Motiv der Romantik: einer Antwort auf die Belastung des Selbstgefühls. Die Fantasie, in der Liebe festen Halt und Sicherheit zu finden, winkt als happy end, schenkt Hoffnung in unsicheren Zeiten, in denen das Ich höher gehoben, aber auch tiefer gestürzt werden kann als in traditioneller Enge. Was die gesellschaftliche Entwicklung unwiederbringlich zerstört hat, wird nachträglich als Paradies idealisiert.
So blickt das bürgerliche Ich, dem alle Möglichkeiten offenstehen, auch die, an den eigenen Ansprüchen zu scheitern, sehnsüchtig nach der Welt des Adels, in der man allein durch Geburt schon Prinz ist oder Prinzessin. Im 19. Jahrhundert wird nicht nur das fahrende Volk, etwa in Gestalt Carmens, zum Symbol riskanter Freiheit. Auch der Troubadour erscheint als ein Vorläufer des modernen Ich, selbst bewusst und stolz in seiner Kunst und doch angewiesen auf die Gnade einer Gesellschaft, die ihn in guten Zeiten rühmt und nährt, in schlechten aber im Stich lässt.
Text: Wolfgang Schmidbauer, Psychoanalytiker und Buchautor
Illustration: Anita Allemann