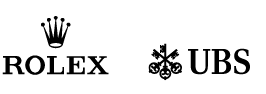Die Sache Makropulos
Oper in drei Akten von Leoš Janáček (1854-1928)
Libretto von Leoš Janáček nach der gleichnamigen Komödie von Karel Čapek
In tschechischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer 1 Std. 45 Min. Keine Pause. Werkeinführung jeweils 45 Min. vor Vorstellungsbeginn.
Einführungsmatinee am 8 Sep 2019.
Unterstützt von 
Gut zu wissen
Gespräch

Dima, nach Jenůfa im Jahr 2012 inszenierst du nun am Opernhaus Zürich zum zweiten Mal eine Oper von Leoš Janáček. Was fasziniert dich an diesem Komponisten?
Wenn es die erste Begegnung mit Janáček vor sieben Jahren in Zürich nicht gegeben hätte, gäbe es jetzt auch dieses zweite Mal nicht! Jenůfa hat mich – im positiven Sinne – geradezu verrückt gemacht. Die Welt der tschechischen Oper war mir vor der Arbeit an Jenůfa noch eher fremd, Janáček existierte nur ganz am Rande meines Opernkosmos’. Jenůfa zu machen, war die Idee von Andreas Homoki. Ich hatte zunächst Zweifel an der Musik und habe mich in dieser mährischen Dorfwelt überhaupt nicht wiedergefunden. Offenbar musste ich erst eine Bühnenwelt erfinden, vor deren Hintergrund ich diese Musik hören konnte. Diese Welt habe ich hier in Zürich gefunden, und dann hat sich plötzlich in meinem Kopf ein Schalter umgelegt, und mir war klar, wie ich an dieses Material herangehen musste. Diese Entdeckung hat alles verändert; Jenůfa ist seitdem eines meiner absoluten Lieblingsstücke. Es gibt darin musikalische Momente, die ich immer wieder höre, die mich bis heute verfolgen. Ich denke oft darüber nach, womit das zusammenhängt. Wahrscheinlich ist es vor allem der Rhythmus dieser Musik, dieses niemals aufhörende Pulsieren, das endlose Ostinato in Janáčeks Musik. Es ist ja bekannt, dass er ständig auf der Suche nach einer authentischen Sprachmelodie war. Da ich kein Tschechisch spreche, kann ich nicht wirklich beurteilen, inwiefern ihm das gelungen ist. Aber in Bezug darauf, wie hier die Zeit musikalisch organisiert und strukturiert ist, ist Jenůfa für mich eine der besten Opern überhaupt.
Wie ergeht es dir nun mit der Sache Makropulos? Hast du dich ebenso in diese Oper verliebt wie damals in Jenůfa?
Als ich angefangen habe, mich mit der Sache Makropulos zu beschäftigen, musste ich zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass das etwas vollkommen anderes ist. Das Stück schien mir ziemlich konstruiert, ich empfand es anfangs sogar als unorganisch, geradezu künstlich. Ich hatte eine zweite Jenůfa erwartet, und es war nicht ganz einfach, von dieser Erwartung wegzukommen. Makropulos ist viele Jahre später entstanden, Janáček war ein anderer Mensch, als er dieses Stück komponierte; Jenůfa höre ich hier gar nicht mehr. Mittlerweile habe ich einen Zugang zu Makropulos gefunden. Obwohl ich zugeben muss, dass ich bis jetzt noch nicht wirklich spüre, wie diese Musik funktioniert. Ich hoffe immer noch ein bisschen darauf, dass sich mir während der Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern ein Geheimnis erschliesst, das mir bisher noch verborgen geblieben ist. Dazu kommt, dass das Narrativ in Makropulos unglaublich dicht ist. Diese Oper ist vollgestopft mit Text. Die Schwierigkeit besteht für mich deshalb auch darin, den Raum dafür zu finden, dieser linearen Erzählung eine Dimension zu verleihen, die über den reinen Text hinausgeht. Das Finale allerdings finde ich absolut grossartig. Meine Liebe zu dieser Oper wächst, sozusagen, mit jeder Szene, mit der wir dem Schluss des Stückes näherkommen. Alles entwickelt sich auf den Schluss hin. Bei Jenůfa ist das anders. Da nimmt einen die Musik vom ersten Takt an gefangen.
Hast du dich auch mit dem Theaterstück des tschechischen Schriftstellers Karel Čapek beschäftigt, das die Vorlage für Janáčeks Oper war?
Wenn ich eine Operninszenierung vorbereite, lese und studiere ich alles, was ich über das Stück und den Komponisten finden kann. Das Theaterstück wird heute praktisch nirgends mehr aufgeführt, es erscheint uns veraltet. Geblieben ist die Oper, für die Janáček selbst das Libretto gemacht hat; dafür musste er das Theaterstück stark kürzen. Man spürt an einigen Stellen, dass etwas fehlt, dass da lose Enden sind. Im dritten Akt zum Beispiel heisst es einmal, man solle nun die Robe für den Richter bringen. Bei Čapek findet in diesem Moment ein richtiger Prozess statt gegen Emilia Marty. Den hat Janáček – zum Glück! – gestrichen, aber die Robe ist geblieben. Es gibt einige solcher Momente, das macht es nicht unbedingt einfacher. Einiges in der Oper bleibt rätselhaft, wenn man Čapek nicht kennt.
Inwiefern empfindest du das Stück von Čapek als veraltet?
Čapeks Stück ist eine den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts verhaftete Komödie, in der die wissenschaftlichfantastische Utopie von einem Elixier verhandelt wird, das ewiges Leben verspricht. Niemand wird das heute noch ernst nehmen. Es gibt in dem Stück allerdings einen durchaus interessanten Disput, den Janáček ebenfalls gestrichen hat: Als nämlich das Rezept für das Elixier wieder aufgetaucht ist, stellen die Figuren um Emilia Marty sich die Frage, wer ein solches Elixier denn bekommen soll – sollen alle ewig leben dürfen? Oder nur die Aristokratie? Am Schluss entscheidet Krista, die junge Sängerin, das Rezept für das Elixier zu verbrennen. So endet auch Janáčeks Oper.
Ist denn die Geschichte, wie sie in der Oper erzählt wird, weniger veraltet?
Ehrlich gesagt, finde ich es schon ein bisschen seltsam, heute eine Geschichte über eine Frau zu erzählen, die 300 Jahre alt ist. Für mich ist klar, dass niemand daran glauben wird, und es nur deshalb quasi blind zu akzeptieren, weil das eben das Werk ist, erscheint mir naiv. Ich denke, dass wir zu jeglichem Material eine kritische Haltung haben sollten; wir sollten Dingen, die uns unglaubwürdig vorkommen, erbarmungslos auf den Zahn fühlen. Schon als Kind habe ich zuhause alle Geräte auseinandergenommen, um herauszufinden, wie sie konstruiert sind. Zum Leidwesen meiner Eltern – denn nachher konnte ich sie nicht wieder zusammenbauen. Das Thema Unsterblichkeit kommt in der Oper zudem eher am Rande vor – erst ganz am Schluss des Stückes stellt sich heraus, dass Emilia Marty schon seit 337 Jahren lebt und durch das Elixier, dessen Rezept sie verzweifelt sucht, vollends unsterblich werden kann. Unsterblichkeit oder der Wunsch danach ist aber ein sehr komplexes Thema, das man nicht einfach im Vorbeigehen abhandeln kann. Umso mehr, als unsere Beziehung dazu heute noch viel komplizierter ist als zur Zeit Janáčeks.
Was bedeutet das für deine Konzeption? Oder anders gefragt: Wenn es nicht primär um Unsterblichkeit geht in diesem Stück, worum geht es dann?
Zunächst einmal finde ich, dass Kunst uns packen, uns emotional involvieren muss. Wir müssen uns mit den Figuren auf der Bühne identifizieren können, wir müssen mit ihnen mitleiden, sonst funktioniert Oper nicht. In Jenůfa hatten wir uns damals aus dem gleichen Grund entschieden, die Geschichte aus dem armen mährischen Dorf in unsere Gegenwart zu holen, damit wir als Zuschauer nicht das Gefühl haben: Diese Tragödie passiert irgendwo sehr weit weg von uns, und sie passiert diesen Menschen, weil sie in bestimmten sozialen Umständen leben, die mit uns nichts zu tun haben. In Die Sache Makropulos geht es für mich um eine Frau, die weiss, dass sie sterben muss, und versucht, etwas zu finden, das ihr Leben verlängern kann. Was kann heute das Leben einer Sterbenden verlängern? In unserer Inszenierung werden wir zu Beginn eine Frau sehen, die weiss, dass ihre Tage gezählt sind, und die überlegt, was sie mit der ihr verbleibenden Zeit anfangen will. Diese Frage, was psychologisch mit jemandem passiert, der weiss, dass er unheilbar krank ist und bald sterben wird, hat mich schon immer interessiert. Denn das ist vollkommen unberechenbar; niemand kann vorhersehen, wie er oder sie in einer solchen Situation reagieren würde. In unserer Sichtweise ist dieses Wissen um den bevorstehenden Tod die Motivation für alles, was folgt – für Emilias Verhalten ebenso wie für das Verhalten aller übrigen Figuren. Es geht um Krankheit, um das Sterben, um die Ausweglosigkeit und darum, wie die Hauptfigur Emilia Marty als eine heutige Frau mit dieser Situation umgeht. Dabei kommt es übrigens nicht so sehr darauf an, dass wir erfahren, wer diese Frau genau ist, was sie für Eigenschaften hat oder was für ein Leben sie bisher gelebt hat. Sie ist keine besondere Person. Im Gegenteil, mir ist sogar sehr wichtig, dass sie eher gewöhnlich ist und für jeden von uns stehen könnte. Entscheidend in unserem Zusammenhang ist vielmehr: Nimmt diese Emilia Marty ihre Situation an? Wenn ja, auf welche Art und Weise tut sie das? Gelingt es ihr, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen? Welche Beziehung hat sie zu ihrem eigenen Tod? In der Oper, wie sie normalerweise erzählt wird, gibt es eben dieses lebensverlängernde Elixier. Heute wissen wir aber, dass wir ein solches Elixier niemals haben werden, was auch immer die Wissenschaft für Anstrengungen unternimmt. Deshalb wird unsere Inszenierung die Geschichte ein bisschen anders erzählen. Doch dazu möchte ich noch nicht allzu viele Details verraten.
Am Schluss der Oper hat Emilia es endlich geschafft: Sie hält das Rezept für das Elixier, das sie verzweifelt und mit allen Mitteln versucht hat zurückzubekommen, in den Händen. Doch plötzlich will sie gar nicht mehr ewig leben und gibt das Rezept an Krista weiter, die es verbrennt. Versöhnt sich Emilia also mit ihrem Tod?
Sich damit zu versöhnen, dass man sterben muss, halte ich für sehr schwierig, wenn nicht sogar für unmöglich. Es gilt, eine Möglichkeit zu finden, mit dieser Unausweichlichkeit zu leben. In den letzten Szenen akzeptiert Emilia, dass sie sterben muss. Ob man da von Versöhnung mit dem Tod sprechen kann, weiss ich nicht. Das ganze Stück über kämpft sie gegen den Tod. Ich meine damit nicht den Tod als abstrakte Vorstellung, sondern ganz konkret ihren eigenen, direkt bevorstehenden Tod. Es gibt neben den bereits erwähnten noch weitere Momente in dieser Oper, die mir sehr unwahrscheinlich erscheinen: Zum Beispiel der junge Janek, der sich auf den ersten Blick in Emilia verliebt (wie übrigens fast alle Männer in diesem Stück) und sich nur wenige Stunden später ihretwegen das Leben nimmt. Daran glaube ich nicht. Umso schwieriger finde ich es, in diesem teilweise fast Vaudevilleartigen Sujet vom Tod zu erzählen.
Emilias Annäherung an den Tod verläuft ja in mehreren Etappen...
Ja, zunächst ist da der Schock, das Entsetzen über die Diagnose; dann folgt der Versuch, etwas dagegen zu unternehmen, der erfolglos bleibt. Im nächsten Moment würde sie am liebsten alles vergessen und so tun, als gäbe es diese Diagnose gar nicht; dann wiederum versucht sie, den Tod zu überlisten; und schliesslich will sie sicherstellen, dass der Tod – wenn er sich schon nicht verhindern lässt – doch wenigstens genauso eintritt, wie sie es möchte. Mir scheint, als sei der Tod die einzige Figur in diesem Stück, mit der Emilia wirklich in Kontakt tritt. Im Grunde ist Die Sache Makropulos eine Oper über die Beziehung von Emilia Marty zu ihrem Tod. Diese Beziehung gleicht einem Duell. Am Schluss des Stückes hört sie zwar auf zu kämpfen, findet aber für sich eine Möglichkeit, sich dabei als Siegerin zu fühlen. Sie wird aus ihrem Tod eine so grosse Attraktion machen, dass sie mit dem Gefühl sterben kann, sich dem Tod nicht unterworfen zu haben.
Das Gespräch führte Beate Breidenbach.
Foto von Doris Spiekermann-Klaas.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Pressestimmen
«Die Spielzeit am Opernhaus beginnt mit einer aufrüttelnden Premiere von Janáčeks Die Sache Makropulos. Evelyn Herlitzius brilliert darin als weiblicher Methusalem, der nach 337 Jahren endlich sterben will – ein visionärer Stoff.»
NZZ vom 23. September 2019«Wenn Evelyn Herlitzius sich ihrem Ende entgegensingt, hören sie nur noch zu, genauso gebannt und berührt wie das Publikum. Das ist Oper: Wenn selbst eine ganz und gar unwahrscheinliche Geschichte eine Figur nicht davon abhalten kann, wahr zu werden.»
Tages-Anzeiger vom 23. September 2019«Als Spielzeiteröffnung des Opernhauses Zürich ist diese Premiere eine Glückserfüllung.»
SWR2 Kultur aktuell vom 23. September 2019«Ein ganz grosser Abend für Janáček, für die Oper Zürich. Eine Sternstunde. Das Publikum war ausser sich vor Begeisterung.»
Deutschlandradio Kultur «Fazit» vom 23. September 2019«Ja, es sind solche Zürcher Premieren, in diesem schönen, intimen Opernhaus, die diesem eben den ersten Oper! Award für das beste Haus 2019 eingebracht haben.»
Brugs Klassiker (Die Welt) vom 23. September 2019
Essay

Leben heisst immer Er-Leben
Evelyn Herlitzius, eine der gefragtesten dramatischen Sopranistinnen, gibt die mysteriöse, seit 337 Jahren lebende Diva Emilia Marty in «Die Sache Makropulos». Ein Probenbesuch bei einer Sängerin, die in ihrer Rolle an der Last der Ewigkeit leidet, aber als Künstlerin den Moment lebt.
Die Tür der Probebühne öffnet sich, ein paar letzte Klaviertöne der Korrepetitorin kullern durch den offenen Spalt in die Cafeteria – Pause bei der Abendprobe zu Janáčeks Oper Die Sache Makropulos. In den Gesprächen der Sängerinnen und Sänger fallen immer wieder tschechische Satzfetzen auf, Aussprachediskussionen, in die sich mitunter Belustigung mit etwas Verzweiflung zu mischen scheint. Denn keiner der Akteure spricht selber Tschechisch, und in dieser wenig geläufigen Sprache wirklich idiomatisch zu singen, ist eine Herausforderung. Das bestätigt auch Evelyn Herlitzius, obwohl die Expertin für Strauss- und Wagnerpartien mit Janáček bestens vertraut ist: Die Küsterin in Jenůfa hat sie oft gesungen, auch die Titelrolle in Káťa Kabanová. Aber im Fall von Věc Makropulos ist es erst ihre zweite Produktion, zudem bringe die Musik hier ihre eigenen melodischen und rhythmischen Vertracktheiten mit sich, sagt sie. Kein Wunder bei diesem experimentierfreudigen Spätwerk, das als moderne Dialogoper den Figuren kaum je erlaubt, länger zusammenhängend zu singen.
Evelyn Herlitzius weist auf eine wenig kantable, aber inhaltlich sehr aufschlussreiche Stelle im ersten Akt hin: Da gebe es einen melodischen Aufschwung ins hohe As; eigentlich ein Augenblick von musikalischer Wärme, der allerdings laut Partitur «chladně», also «kalt» zu singen sei. Diese paradoxe Forderung an die sängerische Darstellung steigere das Beunruhigende der Stelle. Denn was hier musikalisch so schön aufblüht, sind die zynischen Worte der Hauptfigur Emilia Marty: «Nic! zhola nic»; nichts, gar nichts sei von Wert im Leben.
«Ja, das grosse Nichts, darum geht es doch insgesamt», meint Herlitzius fast vergnügt. Die Nachfrage, ob sie nun von Janáčeks Werk oder dem Leben an sich spreche, lässt sie mit einem weich lächelnden «Ja» offen – und verschwindet in eine kurzfristig angesetzte Zusatzprobe. Umständehalber sind die Probenpläne durcheinandergewirbelt worden, und die Nerven im Produktionsteam sind etwas angespannt. Aber davon lässt sich Evelyn Herlitzius wenig anmerken. Bald sitzt sie wieder auf der gepolsterten Fensterbank der Cafeteria, augenscheinlich entspannt. Anders als mit entspannter Beweglichkeit lässt sich auf der beineslangen orangen Sitzfläche auch gar nicht sitzen.
Zurück also zum Nihilismus von Janáčeks Hauptfigur, die vor lauter Daseinsekel alle moralischen Kategorien preisgegeben hat. «Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann: wenn alles egal ist», sagt Herlitzius. In der Oper gewinnt die Figur ihre Menschlichkeit erst zurück, als sie nach 337 Jahren auf ihr ewiges Leben verzichtet. Verleiht also das Ende dem Leben erst Sinn? Janáček und Karel Čapek, dem Verfasser der literarischen Vorlage, gehe es um das Bewusstsein dieser Endlichkeit, präzisiert Herlitzius und federt die oft gemachte, aber eigentlich reichlich simple Verquickung von «Tod» und «Lebenssinn» anhand der schwarzen Löcher im Weltall, die vermutlich sogar für Astronomen unvorstellbar seien, argumentativ weiter ab: «Wir können nicht mit Unendlichkeit umgehen.» Immer würden wir unwillkürlich nach einem «Dahinter» und einem «Danach» fragen. Lange überlegt sie und setzt dann hinzu, dass eine linear vergehende Zeit unserer menschlichen Denkungs-Art wohl eher entspreche als die Ewigkeit.
Nun lässt sich das Verfliessen der Zeit ja nicht bloss im Grossen, mit Blick aufs Ende bewusst machen, sondern auch im ganz Kleinen, im stetigen Wandel. «Ja, das ist faszinierend», fällt Herlitzius ein, «nichts gibt es ein zweites Mal. Keine Wolke, keine Schneeflocke gleicht der anderen. Überlegen Sie mal, wie viele davon schon vom Himmel gerieselt sind – und jede ist anders!» Worauf – «raaah!» – ein wortlos in die Höhe rollender Ausruf anzeigt, dass wir wieder am Punkt wären, wo die menschliche Vorstellungskraft endet.
Die Einsicht, dass «alles Moment» sei, scheint der Sängerin mehr Faszinosum als Furcht zu bedeuten. Immerhin pflegt sie ja selbst eine flüchtige Kunstform, die an den Augenblick gebunden ist wie keine andere. Es sei doch ebenso seltsam wie bezeichnend, dass «der Ton, in dem Moment, in dem er erklingt, schon sein Ende in sich trägt» und mit ihm auch die Endlichkeit des Zaubers, der im glücklichen Fall auf der Bühne entstehe. Höchstens im Herzen lasse sich dieser Zauber mitnehmen, wiederholbar sei er nicht. Bei Herlitzius ist das nicht einfach dahergesagt. Dem Versprechen von Wiederholbarkeit scheint sie auch mit Blick auf ihre eigene Karriere zu misstrauen. Den Wunsch von Kolleginnen, «als ‹Brünni› zu beginnen und als ‹Brünni› zu enden», findet sie zwar legitim. Die Rolle, die Herlitzius da so vertraulich verniedlichend nennt – Wagners Brünnhilde nämlich – ist der Mount Everest des dramatischen Sopranfachs. Sie hat sie selbst oft gesungen, notabene in einem kompletten Bayreuther Ring. Aber viel grösser scheint ihre Lust, nicht bloss alte Partien weiterzuentwickeln, sondern Platz für neue zu machen. Dass sich Stimme und Körper im Laufe des Lebens ändern, weckt ihre Neugier: «Wer will ich jetzt noch sein, auf der Bühne? Was möchte ich noch herausfinden?»
Bei dieser Suche sei niemand völlig frei, so wie auch Himmelskörper ihre Sternenbahn nicht ganz verlassen könnten, ohne vom Himmel zu fallen. Herlitzius lacht über ihren neuerlichen astronomischen Exkurs und macht gleich klar, dass sie die «Sternenbahn» nicht im Sinne einer vollständigen Vorbestimmung meint: Es seien – etwa durch die Entwicklungsfähigkeit der Stimme – einfach Grenzen gesetzt; den Spielraum dazwischen auszuleben, biete aber immer noch mehr Möglichkeiten, als man in einem Sängerinnenleben ausschöpfen könne. Und da sie vom theoretischen Leben nichts hält – «Leben heisst immer Er-Leben» – hat ihre Neugier künstlerisch konkrete Folgen: So in diesem Frühjahr in Wien, als sie in der vielbeachteten Jubiläumsproduktion von Richard Strauss’ Frau ohne Schatten nicht etwa wie früher die hochdramatische Sopranrolle der Färberin, sondern diejenige der Amme gesungen hat. Irrwitzig sind beide Partien, letztere gehört jedoch nominell ins dramatische Mezzo-Fach. Beide Rollen zugleich hat allerdings auch eine Evelyn Herlitzius nicht im Repertoire, die Färberin liege nun «bei den Akten». Ein wenig Trauer sei da schon dabei, «das ist, wie wenn ein Kind aus dem Haus geht». Als Mutter zweier erwachsener Söhne will sie mit diesem Bild aber auch das freudige Gefühl von Erfüllung ausdrücken – und wiederum die Einsicht, dass wir nichts festhalten könnten, im Leben erst recht nicht.
Spätestens hier drängt es sich auf, die Diskrepanz zur Rolle, die sie gerade probt, anzusprechen. Diese Emilia Marty klammert sich so sehr an ihr absurd langes Leben und an einstige Verehrer, dass ihr die Fähigkeit, sich auf Gegenwart und Mitmenschen einzulassen, ganz abhandengekommen ist. Ist es nicht schwierig, eine Figur von so starker innerer Ambivalenz darzustellen? Zugegeben, keine sonderlich kluge Frage an eine Vertreterin des hochdramatischen Fachs, das ja wahrlich keine alltäglichen Charaktere bereithält – wobei Herlitzius die Extreme von Ortrud, Isolde und (zuletzt auch in Zürich) Elektra alle preisgekrönt und vielgelobt ausgelotet hat. Tatsächlich – und diese Antwort überrascht vielleicht – suche sie immer nach der Möglichkeit, sich einzufühlen, noch das «kleinstmögliche erfahrbare Gefühl» zu suchen. Sich wie Emilia Marty einmal «im Leben vergaloppiert» zu haben, komme doch vielen Menschen bekannt vor. Sogar dort, wo Gefühllosigkeit herrscht, ergäben sich bisweilen Berührungspunkte. Und sie erzählt, dass ihr bei der Arbeit an der unmenschlichen Goneril in Aribert Reimanns Lear-Oper einfiel, wie sie sich als eigentlich zurückhaltendes Kind einst mit ihrer besten Freundin geprügelt habe – eine hilfreiche Erinnerung an irrationale, körperliche Aufwallung und an das eigene Entsetzen hinterher.
Der Weg vom – normalerweise friedlichen – Kind zum dramatischen Sopran folgte übrigens einer recht verwickelten Sternenbahn. Ihr Studium begann sie im Tanz, und erst allmählich trat das Singen in den Vordergrund, wobei das eine auch manchmal das andere ergab: So habe sie sich, um eine kleine Choreografie zum Furientanz aus Glucks Orpheus zu entwerfen, eine Schallplattenaufnahme mit Ferenc Fricsay, Dietrich Fischer-Dieskau und Maria Stader gekauft – und eine neue Welt entdeckt. Die Entdeckung ungeahnter Stimmregister hingegen verdanke sie ihrer ersten Gesangslehrerin, die ihr Luciano Berios Stripsody vorlegte: Eine Collage aus Comic-Strips, Texten, grafischer Notation, nach der es zu improvisieren gilt. Unvergesslich sei ihr die Reaktion ihrer Lehrerin: «Evelyn, Sie haben ja ganz viel Tiefe; da müssen wir mal ran!»
Zu Wagner und Strauss sei es da allerdings noch ein langer Weg gewesen; Ausflüge ins lyrische Fach und heftigere Kollisionen mit den Sternenbahn-Grenzen scheint es gegeben zu haben und einige Skeptiker dazu («zu jung, zu dünn, geht nicht»). Der Entfaltung von Persönlichkeit und Karriere ist dies alles offenkundig sehr zuträglich gewesen, und «nur die Geradeausspur» möchte sie auch weiterhin nicht wählen. Im Moment erhebt sich Evelyn Herlitzius aber erstmal feingliedrig von der gepolsterten Fensterbank. Morgen ist ja wieder Probe.
Text von Felix Michel.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Gespräch
Ein Elixier für das ewige Leben
Nicht sterben zu müssen – ist das wirklich der Traum der Menschen? Die Oper «Die Sache Makropulos» von Leoš Janáček, mit der wir die neue Spielzeit eröffnen, handelt davon. Wir haben mit der Zürcher Medizin-Ethikerin Nikola Biller-Andorno über Jugendwahn, Lebensüberdruss, Anti-Aging-Medizin und transhumane Zukunftsfantasien gesprochen.
Frau Prof. Biller-Andorno, wir wollen mit Ihnen über den Menschheitstraum vom ewigen Leben reden, den die Oper Die Sache Makropulos von Leoš Janáček thematisiert. Warum fällt es den Menschen so schwer, ihre Sterblichkeit zu akzeptieren?
Zum einen ist da schlicht die Angst vor dem Tod, vor dem Unbekannten. Zum anderen nimmt man im Alter die zunehmenden Defizite wahr: Ich bin weniger schnell, aus der evolutionären Perspektive betrachtet also weniger «fit for survival», weil ich nicht mehr so schnell vor dem Verfolger davonrennen kann. Aus biologischer Perspektive ist das ein Reflex: Wir wehren uns dagegen, schwächer zu werden und irgendwann nicht mehr da zu sein. Andererseits ist es ganz einfach Neugier, die diesen Traum vom ewigen Leben befördert: Es charakterisiert uns als Menschen, die immer an den Grenzen rütteln wollen. Ein grosser Teil der Biotechnologie ist getrieben von der Frage, ob wir unsere Grenzen akzeptieren müssen, oder ob ein neuer, geradezu gottähnlicher Mensch denkbar ist. Die sogenannten Transhumanisten sagen: Die menschliche Spezies, wie sie im Augenblick existiert, müssen wir nicht akzeptieren. Lasst uns weiterdenken, was da sonst noch drin liegt.
Der Traum vom ewigen Leben ist das eine, die Sehnsucht nach ewiger Jugend das andere. Die Gesellschaft erwartet von uns, dass wir bis ins hohe Alter fit sind und mindestens zehn Jahre jünger aussehen, damit wir als erfolgreich gelten. Mit allen Mitteln versuchen wir, das Altern hinauszuschieben.
Die Frage ist ja: Bringt man mir im Alter vielleicht sogar mehr Respekt entgegen, weil ich viel Lebenserfahrung habe und weise geworden bin? In anderen Kulturen ist das der Fall, bei uns ist es eher umgekehrt. Es geht darum, wie gut ich noch mithalten kann, wie mobil ich noch bin, wie schnell ich mich auf neue Kontexte einlassen kann. Je mehr ich zu erkennen gebe, dass ich alt bin, desto weniger wird man mir das alles zutrauen. Also versuche ich, das zu verbergen. Wir haben zwar auch Respekt vor Menschen mit viel Erfahrung, aber der grosse Trend in unserer Gesellschaft ist: Du musst fit sein. Deshalb hat das Anti-Aging auch solche Konjunktur.
An welchen Methoden, das Alter hinauszuschieben, wird momentan geforscht?
Das ist ein extrem unübersichtlicher Markt, von seiner Wirtschaftskraft her übrigens nicht zu unterschätzen. Vieles verkauft sich auch ohne die eigentlich nötige Evidenzgrundlage ganz prima. Vom Vitamin bis zum Hormon ist da vieles dabei, dessen Wirksamkeit gar nicht erwiesen ist. Die Idee, ich könnte mit Cremes Falten verschwinden lassen oder mit Pillen mein Gedächtnis verbessern, ist ungeheuer attraktiv. Das Spektrum der Möglichkeiten zwischen «Ein-paar-Vitamineschlucken» und «Sich-einfrieren-lassen» ist riesig und reicht bis hin zu der Idee, sich klonen zu lassen oder wenigstens durch das Schaffen eines Avatars die virtuelle Fortexistenz zu sichern. Man merkt schon: Das ist ein sehr selbstbezogenes Projekt ...
... und es stellt sich die Frage: Gibt es eine vom Körper unabhängige Seele, etwas, das über die biologische Existenz hinausweist?
Genau, da geht es ins Metaphysische, und dazu gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Man kann sich das mit dem Klonen wie einen zeitverzögerten Zwilling vorstellen: Ein eineiiger Zwilling, der später geboren wird, also nicht unbedingt eine Fortsetzung des eigenen Ichs ist.
Was macht denn mein Ich aus?
Wohl nicht nur meine Biologie und meine Gene, sondern auch meine Erfahrungen, meine Gedankenwelt.
Wie erfolgversprechend sind all die medizinischen Versuche, das Leben zu verlängern? Besteht die Hoffnung, dass wir demnächst 300 Jahre alt werden?
Man sagt ja, dass 120 Jahre drin liegen, wenn wir den individuell bestmöglichen Lebensstil wählen. Ich habe bisher noch von keiner Methode gehört, die diese Grenze deutlich erweitern würde.
Wie wünschenswert fänden Sie es denn, ein Elixier für das ewige Leben wie in Die Sache Makropulos zu finden?
Als souveränes Ich fände ich es vielleicht toll, wenn es mich noch länger gäbe, weil ich noch so viele Ideen und Projekte habe. Wäre ich jedoch in einer weniger souveränen Position und eingeschränkt in meiner Lebenssituation, hätte meine Endlichkeit vielleicht sogar etwas Tröstliches, denn sie wäre zugleich auch die Grenze meiner Verfügbarkeit. Bin ich endlich, sind auch Instrumentalisierung, Missbrauch und Ausbeutung meiner Person endlich. Gäbe es ein solches Elixier, wäre eine weitere Frage, wer das ausser mir noch nimmt. Wäre ich der einzige Freak unter lauter Normalsterblichen wie Emilia Marty? Würde ich mich dann einsam fühlen und unverstanden? Würde ich mich irgendwann langweilen, wenn das meiste doch nur noch mehr vom Gleichen ist? Wäre ich gerade noch so am Leben, mit vielen Gebrechen und Beschwerden? In der Debatte um den assistierten Suizid gibt es auch Leute, die sagen: Mir reicht es. Es geht mir zwar nicht wirklich schlecht, aber ich bin lebenssatt, habe gesehen, was ich sehen wollte. Und ich weiss, was noch kommt, wird für mich nicht angenehmer sein. Diese Leute wünschen sich das gegenteilige Elixier, nämlich eines, das ihre Existenz schnell und schmerzlos beendet. Die nächste Frage wäre: Wird man mir den Zaubertrank für das ewige Leben neiden? Können wir uns diesen Trank alle kaufen? Und, noch grundsätzlicher: Wie will man überhaupt jemals zeigen, dass ein Trank unsterblich macht? Rein logisch lässt sich Unsterblichkeit ja gar nicht nachweisen. Wir gehen davon aus, dass unsere Lebenserwartung immer länger wird, weil es das ist, was wir im letzten Jahrhundert erfahren haben; aber gleichzeitig wissen wir genau, wie ungesund unsere Lebensstile sind, und wir sind dabei, unsere Umwelt zügig zu ruinieren. Lächeln wir womöglich in 50 Jahren über die Diskussionen um ein potenzielles Lebensalter von 200 Jahren und wären froh, wenn wir die 80 halten könnten?
Aus einer globalen Perspektive betrachtet, ist es kaum wünschenswert, dass die Menschen immer älter werden. Die Erde leidet ja jetzt schon an Überbevölkerung.
Aus der individuellen Perspektive aber schon. Ausserdem könnte es ja sein, dass die Menschen mit dem Alter auch immer weiser werden, weil sie mehr verstanden haben. Vielleicht könnten wir weitsichtiger agieren, wenn wir mehr Zeit zum Nachdenken haben. Aber das ist natürlich eine offene Frage.
Gehen die Menschen, die an lebensverlängernden Möglichkeiten forschen, verantwortungsvoll mit dieser Forschung um?
Diese Szene ist sehr bunt, und ein Gutteil davon ist nicht mehr als seriöse Forschung zu bezeichnen. Oft stehen eher Geschäftsinteressen im Vordergrund, und ich glaube, dass auf diesem Gebiet sehr viel Fragwürdiges passiert. Wir müssen auch bedenken, auf wessen Kosten die Lebensverlängerung geht. Man untersucht etwa, ob Blut von jungen Menschen den Gesundheitszustand von alten Menschen verbessern kann. Bei Mäusen hat das in gewisser Hinsicht funktioniert. Aber der Ansatz zeigt zugleich, dass Privilegien für einige in der Regel damit einhergehen, dass es anderen schlechter geht.
Kann denn das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit auch positive Auswirkungen auf unser Leben haben?
Man kann sich durchaus die Frage stellen: Könnte ich unendlich lange leben, was wären dann überhaupt meine Ziele? Womit würde ich diesen riesigen Raum, der sich vor mir auftut, füllen wollen? Was hätte ich Grosses vor? Es gibt umgekehrt Experimente von Leuten, die sagen: Kündige doch mal deinen Tod für in einem Jahr an, und schaue, was mit deinem Lebensplan passiert. Und dann überleg dir, welche Prioritäten du in diesem Jahr setzt und was dir wirklich wichtig ist. Wenn ich weiss, dass ich unendlich viel Zeit habe, werde ich möglicherweise das, was mir eigentlich wichtig ist, gar nicht in Angriff nehmen, weil ich denke: Dafür ist immer noch Zeit. Also ist das Bewusstsein, dass ich nicht ewig leben werde, auch ein Motivator, Dinge anzugehen.
Die Endlichkeit des Lebens macht das Leben lebenswert ...
... und vielleicht auch erst erträglich. Diese Seite wird oft vergessen.
Trotzdem haben viele Menschen Angst zu sterben. Was könnte uns die Angst vor dem Tod nehmen?
Vielleicht ist es ganz in Ordnung, Angst zu haben. Vielleicht hilft es aber auch, über die eigene individuelle Existenz hinauszudenken und sich selbst als ein Teil eines grösseren Ganzen zu sehen. Zudem sind wir heute in der glücklichen Situation, dass jeder und jede sich selbst aussuchen kann, welche Art der vielen metaphysischen Angebote einem am ehesten Trost oder Geborgenheit vermitteln kann.
In der Gesellschaft der Moderne galt der Tod als Tabu und wurde verdrängt. Neuerdings spricht man von einer «neuen Sichtbarkeit des Todes». Manche, vor allem junge Menschen filmen sogar ihr Sterben, um die Internet-Community daran teilhaben zu lassen. Ist das auch ein Versuch, den Tod zu überwinden, und sei es nur im virtuellen Raum?
Ja, durchaus. Zurzeit wird sehr intensiv an dem sogenannten Brain-Computer-Interface gearbeitet. Könnte man Erinnerungen, Gefühle, Gedanken auf irgendein Medium downloaden und liesse sich diese Art von Existenz auch fortspinnen, gäbe es einen fliessenden Übergang zwischen dem verkörperten Selbst und dem, was im virtuellen Raum passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass nach dem Ende der biologischen Existenz eine Art Transfer in eine andere Welt passiert. Im Augenblick haben wir noch nicht die Grundlagen dafür, das, was in unseren Gehirnen gespeichert ist, herunterzuladen. Aber es wird auf jeden Fall Forschungsanstrengungen in diese Richtung geben. Je mehr Daten über uns verfügbar sind, desto eher scheint es denkbar, dass zwar die biologische Hülle nicht mehr vorhanden sein wird, wir aber im virtuellen Raum weiterexistieren können. Momentan ist das allerdings Science Fiction.
Nikola Biller-Andorno ist Ärztin, Professorin und Direktorin des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte an der Universität Zürich. Das Gebiet der Biomedizin, in dem sie tätig ist, umfasst viele ethische Fragen; sei es, ob Patienten ausreichend in klinische Entscheidungen einbezogen werden, oder was das gegenwärtige Vergütungssystem für das Primat des Patientenwohls bedeutet. In der Biomedizin geht es auch darum, Spielräume, die sich durch neue Erkenntnisse in der Forschung auftun, auf ihre ethische Dimension hin auszuloten und idealerweise mitzugestalten.
Das Gespräch führe Beate Breidenbach.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Volker Hagedorn trifft...

Jakub Hrůša
Schallendes Gelächter dringt aus dem Probensaal, als ich vor der Tür warte, also wage ich mich hinein und höre noch ein bisschen zu: «Die Sache Makropulos» im denkbar frühesten Stadium. Es ist nämlich die allererste Probe, jene, bei der Dirigent und Sänger, um den Flügel versammelt, einander überhaupt erst kennenlernen und das Stück zusammen durchgehen.
Da an diesem Montag noch drei Solisten fehlen, deuten Dirigent Jakub Hrůša und der Korrepetitor ihre Partien an. Auf Tschechisch natürlich, wie alle hier. Wobei der Dirigent der einzige Muttersprachler ist und schon mal kleine Tipps gibt. Er ist konzentriert, zurückhaltend, gelassen. Und hinterher kein bisschen müde, obwohl er mit seiner Familie gerade erst am Vorabend angereist ist. Er sieht jünger aus als 38, aber seine Präsenz ist die eines sehr sicheren Musikers. «Die Sänger sind wirklich gut vorbereitet», meint er, als wir im Café sitzen, und steigt sofort ein in Leoš Janáčeks Umgang mit der Sprache. Der Komponist war ja bekannt dafür, dass er sich unablässig Sprechtonfälle im Alltag notierte. «Manche denken, das sei schon alles. Aber dann fehlt es an Schönheit. Seine Sprachmelodien basieren auch auf musikalischen Ideen und harmonischer Entwicklung. Das kann wirklich gesungen werden. Es ist eine hochästhetische Art des Sprechens, und es gibt auch viel Arioses. Es ist realistisch, aber auch poetisch, er hat ja selbst viel geschrieben, nicht nur seine Libretti, und sich immer poetisch ausgedrückt. …» Schon ist Jakub Hrůša mitten im Leben des Komponisten, das von seinem eigenen gar nicht weit entfernt ist.
Er ist im tschechischen Brno geboren, Brünn, dem Lebensmittelpunkt des Leoš Janáček, und er zählt zu den Steilstartern seiner Generation. Seit drei Jahren ist er Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, dazu Erster Gastdirigent des Philharmonia Orchestra in London und der Tschechischen Philharmonie in Prag, nun debütiert er in Zürich mit der Sache Makropulos. Hrůša – auszusprechen mit weichem «sch» – ist mit Janáček bestens vertraut. Dramen und Geschichten, sagt er, finde man bei seinem Landsmann auch in der Instrumentalmusik. «Er ist einer der theatralischsten Komponisten, die je lebten. Sein ganzes Leben war ein bisschen wie eine Inszenierung, aber er lebte seine Gefühle viel mehr in Briefen und Musik und in den Dramen auf der Bühne als in seinem Leben!»
Gerade deswegen findet Hrůša das Konzept von Dmitri Tcherniakov so spannend, von dem er an diesem Vormittag ausführlicher erfahren hat. Emilia Marty ist dort keine Frau von 337 Jahren, sondern eine tödlich Erkrankte, der nicht mehr viel Zeit bleibt. Die ganze Sache Makropulos fantasiert sie, «um mit ihrer Krankheit klarzukommen. Es gibt da eine Parallele. Janáček war nicht todkrank, als er das komponierte, aber er wusste nicht, wie lange er noch leben würde. Fast alles, was wir heute von ihm wichtig finden, entstand in seinen letzten zwölf Jahren. Den ersten Erfolg hatte er mit Jenůfa in Prag, 1916, mit 62 Jahren, bis dahin hielt man ihn für keinen wichtigen Komponisten. Plötzlich der späte Ruhm! Da dachte er, ich muss so hart arbeiten wie möglich, das Leben nutzen. Dieser erhöhte Stress, die Gefühle, wie ein Ball mit zu viel Luft, der jeden Moment platzen kann. Die Parallele zu Emilia wurde mir heute klar. Wir können in jedem Takt diese verdichtete Struktur hören.» Eine Struktur des 20. Jahrhunderts sei das, «mit Collage, Repetition, dem dauernden Überarbeiten kleiner Motive, das war vielleicht der erste Minimalismus. Aber diese moderne Sprache hat einen romantischen Inhalt. Er war älter als Debussy und Puccini! Das Herz, der Puls, die Emotionen, das braucht viel Rubato und Ausdruck.»
Wozu bei Hrůša noch eine besondere Nähe kommt. «Meine Mutter lebt zweihundert Meter von dem Wald entfernt, in dem Das schlaue Füchslein spielt. Da bin ich sehr romantisch mit der Partitur in den Wald gegangen. Es klingt wie Kitsch, aber für die Seele ist es Nahrung!» Was hält er von Boulez’ Ansicht, neben Mahler sei Janáček «fast primitiv»? «In Anführungszeichen ist das richtig. Es war ein bewusstes Primitivsein. Eine Abkehr von Traditionen. Die Geschwindigkeit der Emotion auf der Bühne sollte der im richtigen Leben entsprechen. Nichts, wovon man sich bequem distanzieren kann.» Bei den Tschechen habe es Janáček auf gewisse Weise schwerer als anderswo, «vielleicht, weil wir jedes Wort verstehen. Es geht uns mehr unter die Haut. Aber er provoziert auch musikalisch. Ich habe so viel von ihm dirigiert, aber behaglich wird mir nie. Er hält dich immer auf der Stuhlkante, es fühlt sich sperrig an und zugleich natürlich, awkwardly natural.» Hrůša spricht bestes Englisch, wirft aber viele deutsche Begriffe ein – und schwärmt vom Geschmack und Duft der tschechischen Sprache, den man bei Janáček höre. Er ist mit seiner Musik gross geworden, in Brno wurde sie viel gespielt, «und jeder in meiner Familie ging in Konzerte und Opern.» Jakub lernte Klavier und Posaune, «aber nicht für eine berufliche Zukunft.»
Wie kam er dann zum Dirigieren? «Bei aller Liebe zur Musik dachte ich bis fünfzehn, ich würde etwas Geisteswissenschaftliches machen, oder Forscher werden, Biologe vielleicht. Und ich liebe Sprachen. Aber dann beschloss ich, es muss etwas mit Musik sein, und Dirigieren wäre das Richtige. Das war so eine Intuition.» Keine Angst vor dem Partiturenlesen? «Ich las Partituren zehn Stunden am Tag und liebte es, vom Blatt daraus zu spielen, zu entziffern, was da steht. Es ist wie Übersetzen, ein Erfinden innerhalb des Existierenden.» Mit sechzehn Jahren stand er erstmals vor einem Orchester, mit einer Ouvertüre von Smetana, «es war völlig anders, als ich gedacht hatte. Ich hatte mir das mechanischer vorgestellt: Du zeigst etwas und es geschieht irgendwie. Aber ich merkte schon im ersten Moment, dass es viel organischer ist. Man kann da nicht auf einen Knopf drücken!» Er habe gelernt, dass man offen sein muss für das, was die anderen machen. «Dirigieren ist eben nicht so, dass etwas perfekt wird, weil du perfekt vorbereitet bist. In einer Beziehung kommt man auch nicht zu einem guten Ergebnis, wenn einer etwas entscheidet. Die Kunst ist, zu umfassen, was jede spezielle Situation bringt, es in deine Vorstellung einarbeiten, während zugleich die Vorstellung davon geformt wird. Das klingt kompliziert, aber nur, wenn man es in Worte fasst. Man macht auch ziemlich viel intuitiv. Mir kam Dirigieren immer als das Natürlichste vor, was ich tun könnte. So wie Gehen oder Atmen.» Das allererste Mal sei für ihn so gewesen, «wie wenn ein Vogel zum ersten Mal fliegt.»
Die Zeit war gut für solche Flüge, denn Jakub Hrůša gehört zu der Generation, die in den 1990ern erwachsen wurde, nach der «Samtenen Revolution» in der Tschechoslowakei und deren friedlicher Teilung, aus der eine neue Česká republika hervorging. «Ich bin skeptisch mit Erinnerungen, denn wir projizieren viel. Aber ich kann garantieren, dass ich als Kind sehr stark den Unterschied im Verhalten der Leute bemerkte. Es gab Leute, die mit der Doktrin klarkamen, wie hohl sie auch schon sein mochte. Für sie brach die Welt zusammen. Andere waren offiziell auf Linie, hielten es aber für Unsinn, die änderten sich schnell. Mein Vater, ein Architekt, war mit den Dissidenten verbunden. Wenn er mir vor der Wende offen etwas sagte, dann sagte er auch, sprich nicht in der Schule darüber, das könnte uns ins Gefängnis bringen. Ich fand das sehr seltsam, aber ich hielt mich daran.»
An die dann folgende Freiheit denkt er aber mit einem «bittersüssen Gefühl», denn er sieht sie weltweit gefährdet. «Heute wird es etwas dunkler, und es ist schwieriger herauszufinden, was Lüge und was Wahrheit ist. Für uns war es früher eigentlich leichter, sich zu orientieren. Es gab Schwarz und Weiss. Man glaubte einfach nicht, was die Medien brachten.» Vielleicht passt ein Komponist wie Leoš Janáček um so besser in die Gegenwart. «Das Erschaffen besserer Welten auf der Bühne interessierte ihn nicht im Geringsten. Er hat seine düsteren Sujets aber nicht gewählt, um Leute zu schocken, er wollte diese Themen einfach nicht vermeiden. Und er wollte glaubwürdig ein bisschen Hoffnung, eine Katharsis schaffen. Darin war er ein Meister.»
Jakub Hrůša dirigiert mit Janáčeks «Die Sache Makropulos» seine erste Opernproduktion am Opernhaus Zürich. Der junge Tscheche wurde in Brünn geboren und hat schon deshalb eine grosse Nähe zu der Musik des tschechischen Komponisten. Hrůša gehört zu den hochgehandelten Dirigenten der jüngeren Generation. Mit seinen 38 Lebensjahren bekleidet er bereits zentrale Positionen bei renommierten Orchestern. So ist er Chefdirigent der Bamberger Symphoniker sowie Erster Gastdirigent bei der Tschechischen Philharmonie und beim London Philharmonic Orchestra.
Text von Volker Hagedorn.
Foto von Maderyc.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Fragebogen

Scott Hendricks
Scott Hendricks ist gebürtiger Texaner und am Opernhaus Zürich kein Unbekannter. Unter anderem war er Jack Rance in Puccinis «La fanciulla del West», und in Wolfgang Rihms «Hamletmaschine» hat der Bariton mit Faible für die musikalische Moderne vor vier Jahren die hochkomplexe Partie des Hamlet III souverän auf die Bühne gebracht. Nun ist er in unserer Neuproduktion von «Die Sache Makropulos» als Jaroslav Prus zu erleben.
Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Ich komme aus der Welt von Rigoletto auf der Seebühne Bregenz. Was für eine wunderbare Welt ist das! Ich war nun schon zum achten Mal bei diesen Festspielen unter freiem Himmel dabei. Auf der riesigen Seebühne aufzutreten, gehört zu den Höhepunkten meiner Karriere. Es ist elektrisierend, in welch spektakulärem Umfeld Oper da Realität wird, sogar mit all den Fliegen und Spinnen, dem Wind und dem Regen. Grossartig! Und mit dem Regisseur Philipp Stölzl zu arbeiten, war ein grosses Vergnügen.
Auf was freuen Sie sich in der Makropulos-Produktion?
Vor allem freue ich mich, wieder hier in Zürich zu sein. Ich liebe diese Stadt und dieses Opernhaus. Die Menschen hier sind wundervoll! Und ich freue mich darauf, wieder mit Dmitri Tcherniakov zu arbeiten. Wir hatten eine geradezu magische Zeit miteinander, als wir vor sieben Jahren zusammen Il trovatore in Brüssel gemacht haben. Ich finde es sehr aufregend, nun mit ihm an Janáčeks Die Sache Makropulos zu arbeiten.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Als ich an der Universität von Illinois war, hatte ich das Vergnügen, mit dem legendären Coach und Begleiter John Wustman zu arbeiten. Er initiierte das Projekt The Complete Songs of Franz Schubert, das auf sieben Jahre ausgelegt war, und ich durfte drei Jahre lang daran teilnehmen. Wir haben einige Liederabende mit Schubert-Liedern an der Universität gemacht und sind mit den Programmen ausserdem in den Mittleren Westen und an die Ostküste gereist. Das war eine grossartige und sehr bereichernde Erfahrung.
Welches Buch würden Sie niemals aus der Hand geben?
Watership Down von Richard Adams. Es ist mein absolutes Lieblingsbuch. Ich lese es gerade. Es geht eigentlich auf jeder Seite um die Oper…
Welche CD hören Sie immer wieder?
OK Computer und The Bends von Radiohead, ausserdem Purple Rain und 1999 von Prince; das höre ich wieder und wieder und wieder…
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Ich habe eigentlich nichts Überflüssiges oder Unnötiges in meiner Wohnung. Meine Freunde und Kollegen wundern sich allerdings manchmal darüber, warum ich ein sechsteiliges Soundsystem überallhin mitnehme, wohin ich reise…
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Ich würde gern mit Prince essen gehen. Er war das Idol und die Inspiration meiner Jugend, und natürlich würden wir über Musik sprechen.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
Musik, natürlich. Die Natur. Freunde und Familie.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 71, September 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Die Sache Makropulos
Synopsis
Die Sache Makropulos
Erster Akt
Der Fall Gregor gegen Prus zieht sich bereits über viele Jahre hin. 1827 ist Baron Prus kinderlos gestorben, ohne ein Testament zu hinterlassen; sowohl der Cousin des Barons als auch ein junger Mann namens Ferdinand Gregor erhoben damals Anspruch auf das Erbe. Seither prozessieren die Familien Gregor und Prus gegeneinander – mit Hilfe der Anwälte Kolenatý in mehreren Generationen.
Heute soll das Gericht einen endgültigen Schlusspunkt hinter den Prozess Gregor gegen Prus setzen. Dr. Kolenatý, Mitglied der Kolenatý-Dynastie, vertritt die Interessen Gregors.
Der Sekretär Kolenatýs, Vítek, wartet auf die Rückkehr des Anwalts aus dem Gericht. Albert Gregor, Vertreter der Anklage, möchte die Entscheidung des Gerichts erfahren, doch Vìtek kann nichts Genaues dazu sagen. Die Tochter Víteks, Krista, erzählt begeistert von der grossartigen Sängerin Emilia Marty, die zurzeit in der Stadt gastiert.
Unerwartet kehrt der Anwalt Kolenatý zurück – in Begleitung Emilia Martys. Die Primadonna ist erstaunlich gut mit den Umständen des Falles Albert Gregor vertraut. Sie weiss offenbar Dinge, die dazu führen könnten, dass das Urteil zu Albert Gregors Gunsten ausfällt. Ihren Worten nach war der junge Ferdinand Gregor ein uneheliches Kind von Baron Josef Prus und der Sängerin Elian MacGregor; das Testament des Barons Josef Prus existiere und befinde sich im Haus von Jaroslav Prus, des Prozessgegners von Albert Gregor. Kolenatý hält das für eine Erfindung Emilia Martys. Doch Albert Gregor, der Hoffnung schöpft, schickt Kolenatý los, um das Testament zu beschaffen – mit allen Mitteln.
Als Kolenatý weg ist, versucht Albert Gregor mit Emilia Marty zu flirten, aber sie fordert als Gegenleistung für das Testament einen wichtigen Umschlag, der sich ihrer Meinung nach bis heute bei den Gregors befindet. Doch Albert beteuert, dass er nichts von einem solchen Umschlag wisse. Die verzweifelte Emilia vermutet nun, dass der Umschlag sich in demselben Schrank bei Jaroslav Prus befindet wie das Testament.
Dieses Testament hat sich unterdessen wirklich gefunden, und zwar an genau dem geheimen Ort, den Emilia genannt hatte. Der Anwalt Kolenatý kommt mit Jaroslav Prus zurück, dem Prozessgegner Albert Gregors; dieser erinnert Albert Gregor daran, dass erst noch bestätigt werden muss, dass der uneheliche Sohn des Barons Josef Prus wirklich Ferdinand Gregor war. Emilia behauptet, dies mit entsprechenden Dokumenten beweisen zu können.
Zweiter Akt
Jaroslav Prus möchte Emilia Marty sprechen.
Auf Prus folgt sein Sohn Janek. Krista sagt Janek, dass sie die Liebesbeziehung mit ihm beenden müsse, weil ihre Karriere als Sängerin für sie nun wichtiger sei als alles andere.
Emilia reagiert gereizt und überspannt auf ihre Verehrer, darunter auch Albert Gregor sowie Janek, der sofort von ihr fasziniert ist. Sie möchte nur Jaroslav Prus sehen, der mit grosser Wahrscheinlichkeit im Besitz des von ihr begehrten Umschlags ist.
Ein weiterer Verehrer Emilia Martys, Graf Hauk-Schöndorf, ist sich sicher, in Emilia Marty die junge Eugenia Montez erkannt zu haben, eine Zigeunerin, die er vor 50 Jahren in Andalusien geliebt hat. Emilia ist zärtlich zu ihm und behauptet, dass Eugenia nicht tot sei, sondern jung und voller Leben vor ihm stehe. Graf Hauk-Schöndorf verspricht, zurückzukommen und Emilia von hier fort zu bringen.
Jaroslav Prus, der mit Emilia allein zurückgeblieben ist, berichtet ihr, dass er in seinem Haus, in dem Schrank, in dem auch das Testament war, Liebesbriefe gefunden hat, die Anfang des 19. Jahrhunderts von einer Elian MacGregor an Josef Prus geschrieben wurden; ausserdem einen Briefumschlag. Jaroslav Prus hat all diese Liebesbriefe gelesen und dabei entdeckt, dass sie nur mit den Initialen «E.M.» unterschrieben sind; er hat auch entdeckt, dass in der Geburtsurkunde des jungen Ferdinand eine gewisse Elina Makropulos erwähnt wird – ebenfalls mit den Initialen «E.M.». Sie wird als Mutter Ferdinands bezeichnet. Da ein uneheliches Kind gewöhnlich den Namen der Mutter erhält, hätte ihr Sohn Ferdinand Makropulos heissen müssen; ein Gregor wird hier nicht erwähnt. So wird also das Erbe doch nicht Albert Gregor zufallen, sondern in den Besitz von Jaroslav Prus übergehen.
Prus begreift, dass es für Emilia unerlässlich ist, den Umschlag zu bekommen, der zusammen mit dem Testament gefunden wurde. Er bringt sie in eine ausweglose Lage, als er ihr sagt, dass der Umschlag ungeöffnet bei ihm im Schrank bleiben werde. Emilia bittet Jaroslav Prus, ihr den Umschlag zu verkaufen; auf diesen Vorschlag geht Prus nicht ein.
Emilia ist verzweifelt und unternimmt die unmöglichsten Schritte, um den Umschlag zu bekommen. Fieberhaft überlegt sie, wie sie Albert Gregor helfen könnte, den Prozess gegen Jaroslav Prus zu gewinnen, und versucht Janek, Jaroslav Prus’ Sohn, zu überreden, den Umschlag aus dem Haus seines Vaters zu stehlen.
Schliesslich ist sie bereit, eine Nacht mit Prus zu verbringen, wenn er ihr dafür den Umschlag überlässt.
Dritter Akt
Nach der mit Emilia Marty verbrachten Nacht übergibt Prus ihr den Umschlag. Seine Bedingung wurde erfüllt; dennoch fühlt er sich betrogen. Im Bett war die Marty kalt wie Eis. In diesem Moment erfährt Prus, dass sich sein Sohn Janek erschossen hat. Jaroslav Prus ist ausser sich vor Schmerz und beschuldigt Emilia: Janek habe sich erschossen, weil er Emilia wie wahnsinnig geliebt habe. Gleichgültig hört Emilia dem rasenden Prus zu.
Hauk-Schöndorf erscheint und schlägt Emilia vor, mit ihm wegzufahren. Doch im selben Moment treten Albert Gregor, Rechtsanwalt Dr. Kolenatý, Vítek und Krista ein. Sie fordern von Emilia Marty eine Erklärung. In den Dokumenten, die sie dem Rechtsanwalt geschickt hatte, um die Verwandtschaft von Josef Prus und Ferdinand Gregor zu beweisen, hat Kolenatý etwas entdeckt: Die Schrift der angeblichen Elian MacGregor ist dieselbe wie die von Emilia Marty, und geschrieben wurde das Dokument mit moderner Tinte. Kolenatý verdächtigt Emilia der Dokumentenfälschung und des Betrugs. Verzweifelt versucht Emilia Marty sich zu verteidigen, aber niemand glaubt ihr. Alle durchwühlen Emilias Sachen und stossen auf eine Vielzahl von Dingen, die mit den Initialen «E.M.»«E.M.» gekennzeichnet sind. Jaroslav Prus weist darauf hin, dass die Handschrift von Elina Makropulos mit der von Elian MacGregor identisch ist.
Schliesslich erzählt Emilia alles. Sie wurde 1585 auf Kreta geboren, ihr richtiger Name ist Elina. Sie war die Tochter von Hieronymus Makropulos, eines Alchimisten am Hof Rudolfs II. Der Kaiser hatte ihm befohlen, ein Elixier herzustellen, das ihm Unsterblichkeit verleihen soll; als Makropulos das getan hatte, erhielt er den Befehl, dieses Elixier zuerst an seiner Tochter auszuprobieren. Elina fiel ins Koma, und der Alchimist wurde ins Gefängnis geworfen. Als Elina nach einer Woche wieder zu sich kam, rannte sie davon – mit dem Rezept für das Elixier im Gepäck.
Seit dieser Zeit lebte sie unter verschiedenen Namen. Irgendwann zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab sie das Rezept dem Baron Prus, mit dem sie einen Sohn hatte – Ferdinand. Seither war das Rezept nicht mehr auffindbar. Es ist eben jenes Papier in dem Umschlag, den sie so dringend haben wollte.
Die Wirkung des Elixiers lässt nach; um dem Tod zu entkommen, wollte Emilia das Rezept in ihren Besitz bringen und noch einmal 300 Jahre leben. Doch nun hat sie erkannt, dass sie die Unsterblichkeit nicht mehr braucht.
Dmitri Tcherniakov