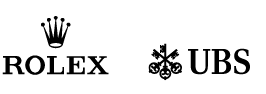Boris Godunow
Oper von Modest Mussorgski (1839-1881)
Libretto vom Komponisten nach der gleichnamigen Tragödie von Alexander Puschkin und Nikolai Karamsins «Die Geschichte des russischen Reiches»
Fassung von 1869 inklusive Polenakt und Revolutionsszene (1872)
In russischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 4 Std. inkl. Pausen nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 37 Min. und nach dem 2. Teil nach ca. 2 Std. 44 Min.
Unterstützt von 
Vergangene Termine
September 2020
Oktober 2020
Gut zu wissen
Boris Godunow
Kurzgefasst
Boris Godunow
Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow führt uns mitten in eine Zeit apokalyptischer Grundstimmung, die von Hysterie, Eskapismus und Paranoia geprägt ist. Den politischen Hintergrund bildet die turbulente Zeit der sogenannten Smuta, als Iwan der Schreckliche starb und sein Sohn Dimitri an den Folgen einer Verletzung am Hals zu Tode kam. War es Mord? Und der Auftraggeber Boris Godunow, der sieben Jahre später der dritte russische Zar wurde? In Zeiten labiler Machtverhältnisse hatte es auch ein Emporkömmling wie der ominöse Grigori Otrepjew (der «falsche Dimitri») leicht, der von sich behauptete, der von seiner Verletzung wundersam genesene Sohn Iwans zu sein – viele blinde historische Flecken also, an denen sich die Fantasie der Dramatiker entzündete. Hauptgrundlage für Mussorgskis Boris Godunow war das gleichnamige Drama Puschkins. Mussorgski verwendete daraus viele Verse, setzte sie neu zusammen, bis eine kaleidoskopartige Struktur mit immer wechselnden Perspektiven entstand: Schlaglichtartig verfolgen wir den Weg des falschen Dimitri, wohnen dem psychisch-körperlichen Zerfall des Potentaten Boris bei, werden in die Dynamik der Volksmenge hineingezogen. Ob schuldig oder nicht – Mussorgski entwirft mit Boris Godunow das faszinierende Psychogramm eines isolierten Herrschers, der zwischen Machterhalt, Machtgewinn, aber auch Skrupeln und Selbstzweifeln zerrissen ist und letztlich am Schreckbild eines toten Kindes verrückt wird. Der ukrainische Dirigent Kirill Karabits stellt sich mit dieser Neuproduktion zum ersten Mal am Opernhaus Zürich vor, die exquisite Besetzung führt der gefeierte Bariton Michael Volle als Zar Boris an, der nach seinem Nabucco ein weiteres wichtiges Rollendebüt an unserem Haus geben wird. Ausgehend von einer weiteren Figur in dieser Oper, dem Mönch Pimen, der an einer Chronik über Russland sitzt, geht Regisseur Barrie Kosky in seiner Neuinszenierung auch der Frage nach, wie wir Geschichte schreiben, wie wir sie erinnern oder instrumentalisieren.
Interview

Eine Landschaft aus Paranoia und Schlaflosigkeit
Mit Modest Mussorgskis Oper «Boris Godunow» bringt das Opernhaus Zürich zum Saisonstart ein Meisterwerk der russischen Oper auf die Bühne. Für Regisseur Barrie Kosky weist das tiefgründige Werk weit in die Zukunft, ein faszinierender Polit-Thriller von Shakespearehaften Dimensionen.
Barrie, die Salzburger Festspiele und die Staatsoper Hamburg haben ihre Neuproduktionen von Boris Godunow in dieser Spielzeit wegen Corona verschoben, du hast dich hingegen bereit erklärt, dieses Projekt in Zürich trotzdem zu verwirklichen. Gehört dazu auch eine Portion Verrücktheit, oder liebst du ganz einfach die Herausforderung?
Beides. Dazu kommt, dass ich ja nicht nur Regisseur bin, sondern auch Intendant an der Komischen Oper Berlin, und als Intendant musste ich mich sehr früh mit der Frage beschäftigen, ob und wie Musiktheater in dieser Pandemie möglich ist. Ich habe daher schnell auch über neue Lösungen für den Zürcher Boris Godunow nachgedacht und unser Konzept, das ich mit meinem Team während drei Jahren entwickelt habe, in meinem Kopf hin und her gewälzt und nach neuen Ansätzen gesucht. Andreas Homoki und ich waren uns einig, dass wir unbedingt versuchen müssen, diesen Boris auf die Bühne zu bringen. Es ging uns auch darum, ein Zeichen zu setzen und zu unseren Sängerinnen und Sängern zu stehen. Für mich ist es sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit pragmatisch und kreativ zu sein. Dennoch kamen für Andreas und mich eine neue, reduzierte Fassung von Boris für kleines Orchester, vielleicht in der Tradition von Strawinskys Les Noces mit Klavier und Schlagzeug im Graben, bei diesem Stück nicht in Frage.
Von Boris Godunow heisst es immer wieder, der eigentliche Protagonist dieser Oper sei das russische Volk. Einen Chor auf der Bühne zu haben ohne Einhaltung der Abstandsregeln, ist momentan aber nicht möglich.
Als mir Andreas von der Lösung erzählte, dass Chor und Orchester vom Orchesterproberaum am Kreuzplatz live ins Opernhaus übertragen werden sollen und er mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, eine Inszenierung ohne Chor auf der Bühne zu machen, habe ich ihn um 24 Stunden Bedenkzeit gebeten. Ich hatte bereits ein paar Ideen, aber sie waren noch sehr abstrakt. Unser Konzept spielt sowieso in einem zeitlosen Raum, in einer Bibliothek. Ich habe mir gesagt: Was wäre, wenn wir hier noch radikaler werden und unser Konzept zuspitzen? Ich will jetzt nichts verraten, aber es hat sich in den ersten Probetagen gezeigt, dass die blosse vokale Anwesenheit des Chores im Raum, als innere Stimme hochinteressant ist. Dass dieses Experiment klappen kann, hängt aber auch mit der Dramaturgie des Stücks zusammen: Der Chor agiert sowieso ziemlich unabhängig von den Hauptdarstellern. Mussorgski denkt in grossen Tableaux.
Das Volk ist in dieser Oper für das politische Spiel der Mächtigen sowieso irrelevant.
Das Volk ist ein eigener Kosmos. Das gilt aber auch für die Hauptdarsteller, deren Wege sich zum Teil nie kreuzen – ganz anders als in Opern von Mozart, Puccini oder Janáček, die von den Interaktionen der Figuren leben. Das macht es für uns geradezu zum perfekten Corona-Stück. Durch die Abwesenheit des Chores und das Fehlen des Spektakels wird die Einsamkeit der Figuren noch deutlicher, denn diese äussern sich hauptsächlich in Monologen. Sie sind einsame Planeten, von Melancholie und Trauer umgeben. Mussorgski interessiert das persönliche Schicksal dieser Individuen, deren Emotionen. Seine Musik ist für mich die Musik der Träume und Halluzinationen. Mussorgski träumt russische Geschichte, ohne uns eine trockene Geschichtslektion zu verpassen. Er malt eine Landschaft aus Angst, Paranoia, Misstrauen und Schlaflosigkeit, einen Polit-Thriller ganz ohne Dogma. Ich habe mir für Zürich die lange Fassung mit dem Polen-Akt und dem Revolutionsbild gewünscht, in der Instrumentation von Mussorgski. Hier entwirft Mussorgski ein breites gesellschaftliches Panoptikum. Wir erleben den Zaren mit seinen Kindern im Palast, tauchen in die religiöse und politische Welt ein, eine Wirtin erscheint, dann eine polnische Prinzessin, allesamt verlorene Menschen. Man fühlt die Last der Geschichte auf den Schultern dieser Menschen.
Was ist für dich das Besondere an Mussorgski als Komponist?
Mussorgski hat dieses atemberaubende Verständnis für psychologische Vorgänge. Er ist der einflussreichste russische Komponist überhaupt, am ehesten noch mit Strawinsky im 20. Jahrhundert vergleichbar. Alle waren sie von ihm fasziniert: Rimski-Korsakow, Schostakowitsch, auch Tschaikowsky insgeheim, obwohl ihm Mussorgski wohl zu radikal erschien. Mussorgski galt zu seinen Lebzeiten als ein Komponist, der sein Handwerk nicht richtig verstand, dessen chaotischen Arbeitsprozess man beargwöhnte, und der angeblich nicht für Stimmen komponieren konnte. Die sehr besondere harmonische Struktur, die seltsame Klangwelt und ungewöhnliche Orchestrierung seiner Werke verstörten. Aber Mussorgski war seiner Zeit voraus und vermittelt uns einen Hauch von dem, was dann später im 20. Jahrhundert richtig explodieren wird. In Boris Godunow experimentiert Mussorgski mit einer Theaterform, die gegen die Belcanto-Tradition geht, gegen die BarockTradition, gegen den Wagnerismus. Er erschafft etwas vollkommen Neues, auch wenn er natürlich aus der russischen Oper kommt und in der Tradition von Glinka steht: Das Stück ist eine Kombination aus russischem Verismo und einem Parlando Ton, den Debussy und Janáček im 20. Jahrhundert weiterentwickeln sollten.
Eine der unkonventionellsten Szenen in Boris Godunow ist die Krönungsszene. Während Boris die Zarenkrone erhält, erleben wir ihn nicht als strahlenden Helden, sondern Mussorgski lenkt den Blick in dessen Innerstes: Boris’ Seele «zittert». In dieser Deutlichkeit steht das nicht bei Puschkin, dessen gleichnamiges Theaterstück Mussorgski als Vorlage diente.
Das ist eben die Genialität Mussorgskis und ein Beweis für seinen Theaterinstinkt. Man erwartet den grossen Auftritt von Boris, das ganze Spektakel mit den Glocken und den Jubel-Rufen des Chores – und was macht Mussorgski? Boris hebt an mit einem melancholischen Monolog, gewissermassen seiner Winterreise. Wir erleben einen verängstigten, misstrauischen Menschen, der zum Zeitpunkt der Inthronisation bereits gescheitert ist. Gleichzeitig ist der Jubel der Menge ja nicht ungebrochen, wie es in Opern von Borodin oder Glinka der Fall wäre, sondern die «Slava»-Rufe sind genauso vorgespielt. Das Volk wurde zum Jubeln gezwungen. Die Menschen haben Angst – alle haben Angst.
Boris ist ein Machtmensch, der Sünden auf sich geladen hat und vermutlich mit dem Zarewitsch Dimitri ein Kind getötet hat. Und dennoch entsteht die paradoxe Situation, dass wir mit ihm leiden und Sympathie für ihn empfinden.
Das ist purer Shakespeare, wie wir es von seinem Richard II., Richard III. oder Macbeth kennen: Durch die emotionale Ehrlichkeit, durch die Komplexität der psychologischen Dimension wird ein zunächst unsympathischer Typ zu einem Menschen, dessen Leid wir teilen. Der historische Boris hat für Russland ja auch viele gute Dinge gemacht, aber auch viele furchtbare, wie fast alle Diktatoren. Mussorgskis Boris hat mehrere Gesichter. Er ist ehrgeizig und ein Manipulator, ein skrupelloser Machtmensch und gleichzeitig besorgter Staatsmensch. Ein Zweifler, dessen schlechtes Gewissen und Schuld ihn niederdrücken. Damit kann er nicht umgehen. Das ist eben Mussorgskis Genie, dass er eine historische Geschichte schreibt – die Geschichte von Boris Godunow, die aber letztendlich eine sehr persönliche und tieftragische Geschichte ist.
In dieser Oper wird Geschichte nicht nur leibhaftig erlebt, sondern durch die Figur des Mönchs Pimen auch aktiv niedergeschrieben.
Welcher andere Komponist würde sich trauen, eine fast 20-minütige Szene über einen alten Mönch zu schreiben, der an der Chronik Russlands sitzt? Was für eine kühne Idee! Ich kenne nichts Vergleichbares in der Opernliteratur. Dramatisch passiert eigentlich nichts. Und trotzdem ist kein einziger Takt belanglos, sondern alles ist hochemotional und hochkomplex. Als Zuschauer sitzt man gebannt auf der Stuhlkante. Das Dokumentieren des Erlebten hat sich Pimen zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Er weiss, dass er bald sterben wird und mit seinem Opus magnum wohl nie zu Ende kommen wird. Die Szene führt uns aber zu einer noch viel grösseren Frage, die dieses Stück aufwirft, nämlich: Wer schreibt eigentlich Geschichte und für wen? Wie wird sie interpretiert und wie erinnert? Was ist die Wahrheit? Geschichte ist nie objektiv. Geschichte ist für mich wie eine Parade von Geistern. Es ist eine theatralische Metapher und die Protagonisten der Geschichte gleichsam die Geister auf dieser Bühne, die ihre Versionen der Ereignisse zu artikulieren versuchen. Gemeinsam mit meinem Bühnenbildner Rufus Didwiszus sind wir daher auch auf die Bibliothek als Raum gekommen, einem magischen Ort. Und da kann es durchaus sein, dass die Bücher, dass die Geschichte zu singen anfängt...
Boris Godunow spielt in der sogenannten «Zeit der Wirren», eine Zeit der Destabilisierung der Gesellschaft und der instabilen Machtverhältnisse. Gibt es für dich Parallelen zu heute?
Wir spielen dieses Stück während der schlimmsten Pandemie der vergangenen 100 Jahre – da gibt es ein ähnliches unsicheres Grundgefühl. Kommt dazu, dass wir mitten in der Probenzeit von den Ereignissen in Weissrussland eingeholt wurden. Man geht nach Hause, sieht im Fernsehen die Bilder, hört, was die Menschen dort sagen, was Lukaschenko sagt – es ist fast eins zu eins das, was wir auch im Boris erleben. Ich muss das in meiner Inszenierung nicht aktualisieren, denn die Worte und die Situationen sprechen für sich selbst. Zeitlosigkeit ist immer ein Zeichen von grosser Kunst. Das sehen wir bei Shakespeare, Euripides, Tschechow, den guten Brecht-Stücken, bei Mozart, Verdi, Wagner oder Janáček.
Mussrgski geht mit dem letzten Bild der langen Fassung, der Szene bei Kromy, noch einen Schritt weiter, indem er eine Art Apokalypse beschreibt – eine Szene, die bei Puschkin nicht vorkommt. Ein ausgelassener Mob tobt, die Mönche Missail und Warlaam werden zu apokalyptischen Wanderpredigern: Die Welt sei «ins Wanken geraten».
Das Bild von Kromy ist eine dystopische Beschreibung einer Gesellschaft, die komplett auseinanderbricht. Eine verkehrte Welt, eine Welt der Selbstjustiz, der sinnlosen Gewalt und des Chaos. Dass nach der atemberaubenden Todesszene von Boris überhaupt noch etwas kommen kann, ist eigentlich unvorstellbar. Aber in Kromy kollidiert alles auf einer höheren Ebene. Am Ende singt dann der Narr. Eine fast vierstündige Oper über Boris Godunow und über ein Kapitel russischer Geschichte – und wer hat das letzte Wort? Der Narr. Einfach genial.
Welche persönliche Bedeutung hat Boris Godunow für dich?
Mein Grossvater kam aus Weissrussland. Von ihm habe ich als Teenager alte russische Schallplatten geerbt, darunter war auch die berühmte Aufnahme mit Schaljapin als Boris aus den 1920er-Jahren. Man kann sich heute kaum vorstellen, welcher Star Schaljapin damals war und welch ein hervorragender Darsteller! Schaljapin hat sogar Filme gedreht, russische Schauspieldirektoren wollten ihn für ihre Stücke engagieren. Seine Deklamation war unerreicht. Er hat sich nicht davor gefürchtet, ungewöhnliche oder unmusikalische Töne zu produzieren. Die Halluzinationen, wenn Boris das tote Kind vor sich sieht, die Todesszene, die Schaljapin so grandios gesungen hat, haben mich damals absolut verzaubert. Durch diese Stimme habe ich Mussorgski, ja die Oper insgesamt, kennen- und liebengelernt. Meine ungarische Grossmutter hat Schaljapin übrigens noch selbst auf der Bühne in Budapest erlebt!
Was schätzt du an Michael Volle, der jetzt den Zürcher-Boris singt?
Es war mein Wunsch, Michael dafür anzufragen. Ich musste ihn dazu richtiggehend überreden, denn sein Einwand war natürlich sofort, dass Boris eine Rolle für einen Bass sei und also nicht für seine Stimmlage. Doch das ist ein Missverständnis. Mussorgski schrieb die Rolle ursprünglich für einen Bariton oder Bassbariton, denn bei der Uraufführung wurde Boris von Iwan Melnikow verkörpert, der auch Graf Tomski in Tschaikowskys Pique Dame sang – eine Baritonpartie. Mussorgskis Intention war wahrscheinlich, Boris’ Stimme irgendwo zwischen Pimen, der die eigentlich grosse Bassrolle in diesem Stück ist und Warlaam, anzusiedeln. Wären alle drei Bässe, würde es eindimensional. Für mich bringt Michael etwas auf die Bühne, was kein Bassist, der normalerweise Philipp II. aus Don Carlos singt, erfüllen kann: Michael hat einen Wotan, einen Hans Sachs und einen Fliegenden Holländer in seiner Seele. Das ist eine Dimension, die man nicht inszenieren kann.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Fragebogen

Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Wie die meisten von uns aus einer merkwürdigen, aber nützlichen langen Pause. Zuletzt dirigierte ich am 16. März eine Generalprobe für eine halbszenische Elektra in Südengland, die wegen Covid-19 leider nicht mehr zur Aufführung kam.
Worauf freuen Sie sich in der Neuproduktion Boris Godunow?
Boris Godunow ist die Oper, die mich seit meiner Studentenzeit begleitet, obwohl ich bisher erst die einaktige Version von 1869 dirigiert habe. Diese Oper ist eine Art Bibel für die russische Musik. Sie reflektiert viele politische und psychologische Prozesse, die bis heute in Russland zu beobachten sind. Es ist faszinierend, ein Werk auf die Bühne zu bringen, das vor über 150 Jahren geschrieben wurde, aber ein Spiegel unserer heutigen Zeit ist.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Mein Lehrer in der Ukraine, der Dirigent Roman Kofman, pflegte zu sagen: «Ich weiss nicht, was man als Dirigent tun soll, ich weiss nur, was man nicht tun soll.» Dieser Satz half mir, aus meinen Fehlern zu lernen. Eine wichtige Station war für mich die Assistenz bei Ivan Fischer und seinem Budapest Festival Orchestra. Auch nicht missen möchte ich die kostbaren Momente, als ich aus dem Konservatorium in den Wiener Musikverein schlich, um Proben mit Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta oder Valeriy Gergiev zu erleben.
Welches Buch würden Sie niemals weggeben?
Wahrscheinlich immer jenes, welches ich aktuell lese. Gerade habe ich mit einem originellen Essay von Kai Kupferschmidt über die Farbe Blau begonnen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Kirill Kondrashins Interpretation der Glocken von Rachmaninow, oder die Mozart- Aufnahmen von Harnoncourt. Aber wenn ich von einer Probe nach Hause komme, höre ich keine CDs. Da brauche ich die Stille.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Ich versuche, keine überflüssigen Objekte in meiner Wohnung in Paris zu haben, denn ich glaube, dass die Dinge, die uns umgeben, einen starken Einfluss auf unsere Seele und unser Leben haben.
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Kürzlich ging ich mit Barrie Kosky essen. Er erzählte mir aus seinem Leben, wir sprachen über Musiktheater – wohl die komplexeste und universellste Form der Kunst überhaupt. In den aktuellen Umständen fühlt es sich so an, als ob wir tatsächlich etwas Neues und Aufregendes kreieren würden.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
1. Liebe zu anderen Menschen wie zu allem, was uns umgibt.
2. Es gibt so viel zu entdecken, zu sehen, zu hören und mehr über uns selbst zu lernen.
3. Den Moment eines Wunders zu erleben. Wenn man denkt, alles ist verloren oder
verschwunden, ist der Zeitpunkt da, wo alles beginnt.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Boris Godunow
Die Ahnengalerie der Tyrannen
Am 20. September eröffnen wir die neue Spielzeit mit «Boris Godunow» von Modest Mussorgski – einer russischen Oper über Machtintrigen und Gewaltherrschaft. Despotische Regierungsstrukturen haben in Russland eine lange Geschichte. Der Schweizer Slawist und Politologe Ulrich Schmid beleuchtet die Hintergründe dieser Tradition von Boris Godunow bis Wladimir Putin.
Die berühmteste Regieanweisung in der russischen Theatergeschichte lautet: «Das Volk schweigt» Sie steht ganz am Ende von Alexander Puschkins Drama Boris Godunow, als die Menge aufgefordert wird, dem neuen Herrscher zu huldigen. In unüberbietbarer Präzision beschreibt diese Formel das Verhältnis von Machthaber und Untertanen in Russland. Anders als in Westeuropa gab es in Russland keine nachhaltige Entwicklung eines demokratischen Staatsaufbaus mit der Sicherung individueller Menschenrechte. Politische Denker haben sich bereits sehr früh zur Architektur der Macht geäussert. Die erste Staatsideologie wurde von Abt Joseph Sanin von Wolokolamsk im 15. Jahrhundert entworfen. Joseph erkannte zwar die Menschennatur des Monarchen an, die Macht des Zaren war aus seiner Sicht aber göttlich. Für die Ausübung der Herrschaft gab es keine Grenzen. Joseph erlaubte sogar ausdrücklich Intrigen und Täuschungen, um die Orthodoxie im Zarenreich zu schützen. Der im 16. Jahrhundert herrschende Iwan der Schreckliche stützte seine Regentschaft auf diese absolutistische Konzeption. Der Zar war zwar keinem politischen Gremium Rechenschaft schuldig. Umso strenger fiel aber seine Abhängigkeit von der Gnade Gottes aus, die seinen Herrschaftsanspruch begründete. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg legte der Regisseur Sergej Eisenstein mit dem zweiteiligen Film Iwan der Schreckliche eine filmische Parabel auf die Einsamkeit des absoluten Herrschers vor. Jossif Stalin erkannte sich sehr wohl in dieser historischen Allegorie. Am 26. Februar 1947 lud der Diktator den Regisseur und den Hauptdarsteller in den Kreml ein, um ihnen seine Eindrücke über den Film mitzuteilen. Gönnerhaft erklärte Stalin den beiden Künstlern: «Iwan der Schreckliche war sehr grausam. Man darf seine Grausamkeit sehr wohl darstellen, aber man muss auch zeigen, warum solche Grausamkeit notwendig war. Einer von Iwans Fehlern bestand darin, dass er fünf Bojarenfamilien nicht ganz abgeschlachtet hat. Wenn er diese fünf Familien ausgelöscht hätte, dann hätte es die Zeit der Wirren später überhaupt nicht gegeben. Aber Iwan der Schreckliche richtete den einen oder anderen hin, bereute seine Taten später und betete lange. Gott störte ihn beim Regieren. Man hätte noch entschlossener vorgehen
müssen …»
Wahrscheinlich war Stalins historische Spekulation zu optimistisch. Sogar wenn Iwan der Schreckliche ein noch grösseres Blutbad angerichtet hätte, wäre es nach seinem Tod zu einem Machtvakuum gekommen. In der russischen Geschichtsschreibung wird das fünfzehnjährige Interregnum zu Beginn des 17. Jahrhunderts als «Zeit der Wirren» bezeichnet. Die Zeit zwischen dem letzten RurikidenHerrscher und dem ersten RomanowZaren war von Machtgerangel und Fremdherrschaft gekennzeichnet. Zunächst konnte der Emporkömmling Boris Godunow (15521605), der in die Familie Iwans des Schrecklichen eingeheiratet hatte, die Regierungsgeschäfte an sich reissen. Später liess er sich sogar zum Zaren krönen. Seine Herrschaft wurde vom Verdacht überschattet, er habe den rechtmässigen Zarewitsch Dimitri umbringen lassen, um selbst den Thron besteigen zu können. Ob Godunow tatsächlich die Schuld am Tod seines minderjährigen Rivalen trägt, ist historisch nicht gesichert. Allerdings bot allein schon das Gerücht reiche Inspiration für zahlreiche künstlerische Bearbeitungen dieses Stoffes – von Alexander Puschkin bis Alexej Tolstoj und von Friedrich Schiller bis Volker Braun.
Stalins rabiate Handlungsanweisung an Iwan den Schrecklichen half auch in seinem eigenen Fall nicht. Die Zahl der Opfer seiner Säuberungen geht zwar in die Millionen, dennoch konnte er sein Schreckensregime nicht etablieren. Nach Stalins Ableben war nicht klar, wer die Herrschaft übernehmen würde. Der ehemalige Geheimdienstchef Lawrenti Beria, der Stalin an Brutalität nicht nachstand, erhob Anspruch auf die Führung. Allerdings ging sein Plan einer deutschen Wiedervereinigung dem Politbüro zu weit. Beria wurde entmachtet und hingerichtet. An der Spitze von Partei und Staat setzte sich der unwahrscheinliche Kandidat Nikita Chruschtschow durch, der ursprünglich nur an fünfter Stelle der PolitbüroHierarchie gestanden hatte.
Es gibt eine ganze Reihe von Parallelen beim historischen Schicksal der beiden Tyrannen. Sowohl Iwan der Schreckliche als auch Stalin hatten ihre Erstgeborenen auf dem Gewissen: Iwan erschlug den Thronfolger im Streit, Stalin weigerte sich, seinen Sohn aus der deutschen Kriegsgefangenschaft auszulösen. Die Todesumstände beider Tyrannen sind nicht restlos geklärt und haben Anlass zu weitläufigen Verschwörungstheorien gegeben. Schliesslich profitierte in beiden Fällen der Nachfolger vom Kontrast, den die eigene Politik gegenüber der alten Schreckensherrschaft markierte.
Boris Godunow gilt seit Alexander Puschkins Drama als negative Figur in der russischen Geschichte. Das Image des glücklosen Zaren untermauerte der Komponist Mussorgski mit einem weiteren Schlag: In seiner Oper wird Godunow vom Geist des ermordeten Zarewitsch heimgesucht – damit erscheint seine Schuld als erwiesen. Diese Legende verweist auf ein zentrales Problem russischer Herrschaft: Der Zar wurde vom einfachen Volk aufgrund seiner dynastischen Herkunft anerkannt. Sobald diese Kette der Machtübergabe unterbrochen wurde, bröckelte die Legitimation des Herrschers. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts profitierte die polnischlitauische Adelsrepublik von der Schwäche des Zarenreichs und besetzte mit ihrer Armee Moskau. Erst gegen Ende des Jahres 1612 gelang es der russischen Landwehr, die Polen zu vertreiben. Seit 2005 erinnert der «Tag der Einheit des Volkes», der immer am 4. November gefeiert wird, an dieses historische Ereignis. Präsident Putin war auf der Suche nach einem Ersatz für den diskreditierten Feiertag der Oktoberrevolution und schwor seine Nation auf den Sieg über die polnische Besatzungsmacht ein. Dieses Ereignis markierte auch das Ende der «Zeit der Wirren», die bis heute als Schreckgespenst durch die Regierungshallen des Kremls geistert. Wie wichtig die dynastische Kontinuität für die Herrschaftssicherung war, zeigen frühe Urkunden des ersten RomanowZaren Michail, der sich nach der Thronbestei gung im Jahr 1613 als «Enkel» des Rurikiden Iwans des Schrecklichen bezeichnete. Die Herrschaft der Romanows, die auf die «Zeit der Wirren» folgte, sollte mehr als 300 Jahre dauern – bis zur Februarrevolution 1917. Legitimitätskrisen gab es in dieser langen Zeit relativ selten, aber sie kamen vor. So gelangte Katharina die Grosse aufgrund einer Palastrevolte im Jahr 1762 an die Macht – ihr Ehemann, Zar Peter III., kam dabei unter ungeklärten Umständen ums Leben. Ebenfalls einem Putsch fiel Paul im Jahr 1801 zum Opfer. Sein Sohn, der spätere Zar Alexander I., gab sein Einverständnis für das Erzwingen der Abdankung und fragte, ob denn auch Gewalt angewendet werden solle. Der Anführer der Verschwörer beschied ihm darauf vieldeutig, dass man Eier zerschlagen müsse, wenn man ein Omelette machen wolle. Eine Ironie des Schicksals wollte es, dass auch nach dem Tod Alexanders I. im Jahr 1825 eine Zäsur in der Fortführung der Zarenherrschaft entstand. Eine Reihe junger Adliger setzte sich für eine republikanische Revolution ein. Allerdings scheiterte der sogenannte Dekabristenaufstand jämmerlich. Die Aufständischen marschierten auf dem Senatsplatz der Hauptstadt St. Petersburg auf und blieben dort stehen, bis sie von regierungstreuen Truppen verhaftet wurden. Das umstehende Volk verstand nicht einmal, was mit der geforderten Verfassung (russ:«konstituzija») gemeint war und feierte in seinen Hochrufen den regulären Thronfolger Konstantin und «seine Frau Konstituzija». Allerdings war nicht nur das Herrschaftsverständnis des einfachen Volkes mangelhaft ausgebildet. Dasselbe gilt auch für die anachronistische Auffassung des Gottesgnadentums bei den Zaren. Noch kurz vor seiner Abdankung beschied Nikolaus II. dem britischen Botschafter, der ihn auf seine schwindende Popularität ansprach: «Meinen Sie nun, dass ich das Vertrauen meines Volks zurückgewinnen muss, oder meinen Sie nicht vielmehr, dass mein Volk mein Vertrauen zurückgewinnen muss? » Schon nach der ersten russischen Revolution von 1905 hatte Nikolaus II. seinem Volk nur widerwillig ein «Grundgesetz» zugestanden, in dem die Einrichtung eines Parlaments angekündigt wurde. Allerdings nutzte Nikolaus später jede Gelegenheit, um die Duma aufzulösen. In diesem Sinne war der letzte Zar der beste Komplize Lenins, für den die Devise «Je schlechter, desto besser» galt: Je schlechter die Bürger in das politische System eingebunden waren, desto besser standen die Chancen für einen radikalen Machtumsturz. Die «Oktoberrevolution», die später von den Sowjets mit tatkräftiger Hilfe des Regisseurs Eisenstein als Aufstand der empörten Massen gegen eine ungerechte Regierung gefeiert wurde, war jedoch in Tat und Wahrheit ein Staatsstreich.
Das Verhältnis von Herrschaft und Volk wurde während der Sowjetzeit nicht von der politischen Realität, sondern von der marxistischen Ideologie definiert. Das sowjetische Verständnis von «Demokratie» unterscheidet sich radikal von der aufklärerischen Tradition. Schon bei Marx ist die Demokratie gerade kein Garant für die Ausübung politischer Bürgerrechte, sondern umgekehrt ein Unterdrückungsinstrument in den Händen der kapitalistischen Ausbeuter. Bei allen Sowjetführern lässt sich der verzweifelte Versuch beobachten, dem Westen die angebliche Überlegenheit des eigenen Systems vor Augen zu führen. Besonders deutlich lässt sich das am raschen Wechsel der sowjetischen Verfassungen der Jahre 1918, 1924, 1936 und 1977 ablesen. Die erste Verfassung von 1918 wird in klarer Analogie zur französischen Deklaration der Menschenrechte von 1789 durch eine «Erklärung der Rechte der Werktätigen und Ausgebeuteten» eröffnet. Als Staatsform etabliert sie explizit eine «Diktatur des Proletariats», die kommissarisch von der Kommunistischen Partei ausgeübt wird. Ihr politisches Mandat bezogen die bolschewistischen Herrscher gerade nicht aus einer demokratischen Wahl, sondern aus den ehernen Gesetzen der marxistischen Geschichtsphilosophie. Im berühmten «Kurzen Lehrgang», an dem Stalin höchstpersönlich in den dreissiger Jahren mitgeschrieben hat, kann man diesen umfassenden Wahrheitsanspruch nachlesen: «Die Kraft der marxistischleninistischen Theorie besteht darin, dass sie der Partei die Möglichkeit gibt, sich in der jeweiligen Situation zu orientieren, den inneren Zusammenhang der um sie herum geschehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der Ereignisse vorauszusehen, und nicht nur zu erkennen, wie und wohin sich die Ereignisse gegenwärtig entwickeln, sondern auch, wie und wohin sie sich künftig entwickeln müssen. » Dieses überbordende Selbstbewusstsein wurde in der StalinVerfassung von 1936 kodifiziert. Sie schützte das Eigentum und sah auch ein Erbrecht vor. Auch die Rede, Presse und Versammlungsfreiheit war auf dem Papier garantiert, allerdings mit dem entscheidenden Zusatz «in Übereinstimmung mit den Interessen der Werktätigen und zur Festigung der sozialistischen Ordnung». Sogar ein Recht auf Erholung wurde verbrieft. In der BreschnewVerfassung von 1977 kommt das Wort «Demokratie» konsequenterweise nicht in Reinform vor. Entweder ist von «wahrer Demokratie» oder von «demokratischem Zentralismus» die Rede. In beiden Fällen verweisen die Formulierungen auf den Anspruch der Partei, den Willen des Volkes besser als das Volk selbst verstehen und umsetzen zu können.
Die jahrzehntelange Gängelung der Sowjetbürger zog ein «schweigendes Volk» in Puschkins Sinne heran. Die neunziger Jahre waren von einem erbitterten Kampf um die Staatsmacht geprägt. Boris Jelzin, der Held bei der Abwehr des Moskauer AugustPutsches von 1991, entwickelte sich zu einem aufgedunsenen Alkoholiker, der auf Pressekonferenzen auch schon mal Deutschland und Japan als Atommächte bezeichnete und sich am Schluss kaum mehr selbst auf den Beinen halten konnte. Seine Wiederwahl als Präsident im Jahr 1996 kam nur aufgrund von ausgeklügelten «Polittechnologien» zustande, weil man um jeden Preis seinen kommunistischen Rivalen ausschalten wollte. Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny unterstützte damals die Beeinflussung der Öffentlichkeit zugunsten von Jelzin. Im Rückblick beurteilt er sein Verhalten jedoch selbstkritisch: Nawalny glaubt heute, dass ein kommunistischer Präsident in einer überschaubaren Amtszeit von vier Jahren wenig Schaden hätte anrichten können. Viel schlimmer sei die nachhaltige Diskreditierung der demokratischen Institutionen, von der das System Putin bis heute profitiere.
Wladimir Putin wurde 1999 von Boris Jelzin selbst auf den Schild gehoben. Seither regiert Putin aus offiziellen und inoffiziellen Positionen das Land mit eiserner Hand. Lange Zeit genoss er hohe Zustimmungsraten, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 sogar durch die Decke schossen. Bis vor kurzem beruhte der Gesellschaftsvertrag in Russland auf der Losung: «Enrichissezvous, mais ne vous indignez pas!» (Bereichern Sie sich, ohne sich zu beschweren!) Soziologische Langzeituntersuchungen zeigen, dass in der gesamten Ära Putin jeweils nur gerade zwei bis fünf Prozent der Befragten glauben, einen Einfluss auf die Situation im Land zu haben. Mittlerweile ist der Führung im Kreml ebenfalls klar, dass ihr sorgfältig konstruiertes Modell der «gelenkten Demokratie» nicht nachhaltig funktioniert. Die Verfassungsreform, über die am 1. Juli 2020 abgestimmt wurde, will deshalb in Russland ein «einheitliches System der öffentlichen Herrschaft» etablieren. Der Deal besteht darin, dass die politische Teilhabe der russischen Staatsbürger auf das Vertragsverhältnis einer Sozialversicherung reduziert wird: Die Verfassung garantiert neu einen Mindestlohn und indexiert die Renten. Dafür wird alle politische Macht an ein straff zentralisiertes Verwaltungssystem delegiert. Eine Ironie des Schicksals will es, dass die Kampagne für die Verfassungsreform ausgerechnet mit Alexander Puschkins Kopf warb: Das russische Volk schwieg sich mit fast 78 Prozent Zustimmung für die Beibehaltung des Systems Putin aus.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Sound-Übertragung von nebenan

Bühne hier, Orchester da. So spielen wir.
Unser Orchester und Chor werden derzeit aus einem externen Proberaum live in die Vorstellungen eingespielt. Dank diesem weltweit einzigartigen Spielmodell heisst es trotz Abstandsregeln: Vorhang auf für grosses Musiktheater! Erfahren Sie, wie unsere «Sound-Übertragung von nebenan» funktioniert und wie Sie mit Ihrer Spende in Ihren Musikgenuss investieren können. mehr
Auf der Couch
Wäre ich doch ein Anderer
Wer die Ahnengalerien stolzer Adelsgeschlechter betrachtet, wird entdecken, dass Hochstapelei zum feudalen Lebensgefühl gehört. Stammbäume reichen in dunkle Zeiten zurück und greifen dort nach Ahnen wie Karl dem Grossen oder Iulius Caesar, gar nach König Salomo und der Königin von Saba. In Ägypten begründete die Abstammung von einem Gott die Macht des Pharao; in der griechischen und römischen Adelsgesellschaft führten Stammbäume auf Götter und Heroen zurück. Gaius Iulius Caesar beispielsweise gehörte zum Geschlecht der Iulier. Iulius war der Sohn von Aeneas. Dieser, ein Sohn der Liebesgöttin Venus, war der Legende nach aus Troja geflohen und hatte die Stadt Rom gegründet. Also war auch Caesar «göttlichen Blutes» und ein geborener Herrscher. Kaiser und Zaren haben ihre Titel von Caesar übernommen, der den Dolchen von Verschwörern zum Opfer fiel und bald danach als Gott verehrt wurde.
Wer von uns bekommt schon die Anerkennung, die er nach seinem eigenen besten Wissen und Gewissen verdient? Wo sich in diesem Punkt die Realität spröde zeigt und die eigenen Grössenwünsche wenig unterstützt, bieten Tagträume eine unerschöpfliche Quelle von Macht und Ruhm. Ich erinnere mich mit wehmütiger Scham an eine Zeit, in der ich als pubertierender Gymnasiast mein Rad nach Hause schob, weil ich alle Konzentration dafür brauchte, mir eigene Heldengeschichten auszumalen: Ich war ein unverwundbarer Ritter (bitte kein Lindenblatt beim Drachenblutbad), mein Schwert das schärfste von allen. Oder ich ritt mit Winnetou und Old Shatterhand über die Prärie und befreite die beiden aus grosser Gefahr, denn ich hatte eine kleine Pistole, aus der ich notfalls auch Atombomben verschiessen konnte.
In der Psychoanalyse werden solche Tagträume mit dem so genannten Familienroman verknüpft. Das sind kindliche Phantasien, in denen die in ihrer Belanglosigkeit den eigenen Grössenwunsch kränkenden Eltern durch würdigere Bilder ersetzt werden. Der Freudschüler Otto Rank hat in Der Mythus von der Geburt des Helden Sagen über die babylonischen Könige Gilgamesh und Sargon, den Perserkönig Cyrus, Ödipus, Herakles und Perseus, die römischen Könige Romulus und Remus, den keltischen Tristan, Siegfried und Lohengrin untersucht. Er fand typische Muster: Es gibt ein Paar von hohem Rang und einen Traum oder ein Orakel, das die Geburt eines Sohnes ankündigt, der gleichzeitig auch eine Gefahr für den Vater sei. Im Kindesalter wird der Held ausgesetzt. Er würde ohne Hilfe sterben, wird aber gerettet – von Tieren oder Menschen von geringem Stand. Erwachsen, entdeckt er seine wirklichen Eltern, rächt sich und gewinnt Ruhm und Würde.
Tiere oder Taglöhner, die den Helden aufziehen, symbolisieren die realen Eltern; Könige oder Götter die idealen Eltern, die sich das Kind herbeiträumt. Sobald die Geheimnisse der Sexualität dem kindlichen Forschen nicht mehr widerstehen, orientieren sich Fantasien an der Tatsache, dass die Mutter ganz eindeutig ist, der Vater aber stets von Unsicherheit umgeben. Nach 1945 etwa tauchten in den Analysen Fantasien auf, einem heimlichen Verhältnis der Mutter mit einem untergetauchten Juden zu entstammen – auch ein Weg, der Beschämung durch den Holocaust zu entgehen.
Die Oper Boris Godunow kreist um das zentrale Motiv in unruhigen Zeiten: Wer kann führen? Der Tüchtige oder der durch Abstammung und Geburt Begnadete? Ergänzt wird diese Frage durch eine zweite, die tiefer in die unbewusste Dynamik des ÖdipusKomplexes reicht: Wer ist schuldig? Ist es der Sohn, der dem Vater dessen Rang streitig macht? Ist es der Vater, der den Sohn unterdrückt, gar töten lässt, um seine Macht zu bewahren? Godunow regierte zunächst für den geistesschwachen Fjodor I. und liess sich nach dessen Tod zum Zaren wählen. Seine Gegner schürten den Verdacht, er habe den Zarensohn Dimitri ermorden lassen. Als ein junger Mönch behauptete, eben dieser Dimitri zu sein, unterstützten seine Feinde den «falschen Dimitri». Der selbsternannte Zarensohn wurde später ebenfalls ermordet.
Alexander Puschkin hat in einem Drama die Vorlage für Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow geschaffen. Puschkin konzentrierte sich auf die Spannung zwischen dem selbst ermächtigten Zaren und dem ebenfalls selbst ermächtigten Zarensohn. Sie gibt dem Geschehen eine psychologische Tiefe, die dem uralten Motiv der Aussetzung und Erhebung des Helden seine Geradlinigkeit nimmt.
In Märchen, Mythen und Legenden bleibt das Thema des unterschätzten, erniedrigten und dann wie durch ein Wunder erhöhten Helden allgegenwärtig. Von einem hohen Unterhaltungswert zu sprechen, ist nicht falsch, aber banalisiert doch das Ringen des menschlichen Narzissmus mit den Abgründen der Bedeutungslosigkeit. Wer sich aus der Menge erhebt und für alle sichtbar wird, steht für die Ambivalenz einer universalen Sehnsucht. Sein Herausgehobensein ist Erlösung und Gefahr – heute als verschollener Prinz gefeiert, morgen als Betrüger entlarvt oder von Rivalen um die Macht erdolcht.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Wie machen Sie das, Herr Bogatu?
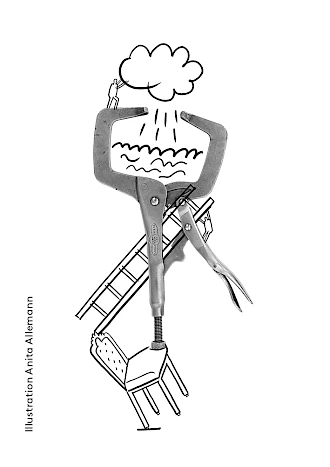
Das blutende Buch
Am rechten Bühnenportal kauert Boris Godunow. Von der linken Seite bewegt sich ein grosses, stehendes, aufgeschlagenes Buch auf ihn zu. Unaufhaltsam kommt es näher. Blut fliesst an den Seiten des Buches herab. Boris greift sich das Buch, seine Hände sind voller Blut – seinem Schicksal kann er nicht entkommen.
Wenn Sie gerne auch mal ein blutendes Buch auf sich zukommen lassen möchten: Nehmen Sie ein grosses Buch, schlagen Sie es mittig auf und schneiden Sie auf der rechten Hälfte die Seiten so aus, dass von jeder Seite nur noch ein ca. 1 cm breiter Rand stehen bleibt. Nun kleben Sie diese Seiten aufeinander: Sie haben ein Geheimfach geschaffen.
Füllen Sie dann einen Infusionsbeutel mit Blut. Mittels Infusionsschlauch verbinden Sie den Beutel mit einer kleinen ferngesteuerten Pumpe.
Alle Teile (Beutel, Pumpe, Leitungen, Elektronik) kleben Sie einfach auf den Boden des Geheimfachs. Von der Pumpe aus führen Sie einen Schlauch erstmal lose aus dem Fach heraus. Nun decken Sie das Fach mit einer passend zugeschnittenen Kunststoffplatte so ab, dass sich diese Platte ca. einen halben Zentimeter unter dem Rand befindet. Den losen Schlauch führen Sie in der oberen linken Ecke durch die Platte hindurch und kleben die Platte fest.
Den Schlauch kleben Sie nun am oberen Rand der Platte fest, verkleben das Ende und schneiden den Überstand ab. Dann bohren Sie alle zwei Zentimeter Löcher in den Schlauch – und zwar so, dass das Blut aus dem Fach hinausspritzen würde. Die Schwammtücher leimen Sie auf der Kunststoffplatte fest; diese bilden die Auflage für das Bambuspapier.
Als nächstes schneiden Sie das Bambuspapier genau auf das Mass der Buchseiten zu und bedrucken oder (wenn Sie entsprechend begabt sind) bemalen es mit einem Motiv Ihrer Wahl. Mit diesem Papier kleben Sie das Fach zu. Nun sieht niemand mehr das Innenleben des Buches. Machen Sie das gleiche mit der linken Hälfte des Buches. Dann stellen Sie es vor sich hin und klappen es so weit auf, dass es gut steht und Sie die gestalteten Seiten gut sehen können.
Wenn Sie die Pumpe per Fernsteuerung starten, so wird das Blut durch die Löcher im Schlauch auf das Bambuspapier gespritzt. Dieses saugt sich sofort voll, das Blut fliesst herab und wird vom Schwammtuch aufgesaugt. Wenn Sie nun das Buch anfassen, so haben Sie aufgrund des vollgesaugten Schwammtuchs schnell viel Blut an den Händen... Um das Buch fahren zu lassen, motorisieren Sie einfach ein zweites Buch mit einem ferngesteuerten Modellfahrzeug und stellen das Blutbuch darauf. Das Blutbuch von Boris wurde von unserer Requisite entwickelt. Es funktioniert wie beschrieben – ist aber wesentlich komplizierter hergestellt. Die Beschreibung dieser raffinierten Herstellung passt jedoch leider nicht auf diese Seite...
Text von Sebastian Bogatu.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 78, Oktober 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Fragebogen

Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Aus dem Land der Pandemie – wo ich immer noch bin! Tragt bitte eure Masken, alle!
Worauf freuen Sie sich in den Neu-produktionen Boris Godunow und Die Csárdásfürstin?Ich liebe die grosse Freiheit, die ich beim Spielen und Experimentieren auf der Bühne bei Boris Godunow habe. Es war ein grosses Vergnügen, diese besondere Art des Agierens auf der Bühne mit Barrie auszuprobieren. Und ehrlich gesagt liebe ich es, wie vulgär und
schrecklich ich in der Csárdásfürstin sein darf… Das macht eine beschämend grosse Freude!
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Eine schwierige Frage. Ich glaube, die Tatsache, dass ich meine musikalische Ausbildung als Pianist begonnen habe, hatte den grössten Einfluss auf mein Leben und meine Karriere. Ich begann mit vier Jahren mit dem Klavier, und erst als ich an der Universität war, fing ich ernsthaft mit dem Gesang an. Meine pianistische Vorbildung hilft mir noch
immer, wenn ich eine neue Rolle einstudiere.
Welches Buch würden Sie niemals weggeben?
Ich besitze eine Ausgabe von Game of Thrones mit Kommentaren einer lieben Freundin von mir. Sie teilte all ihre Lieblingsmomente und ihre Gedanken. Ich könnte mich nie davon trennen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Queen: A Night at the Opera. Das ist Kult.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Mein Nintendo Switch. (Ich bin im Herzen immer noch ein Kind, werde es immer bleiben.)
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Mit meinem Verlobten. Er ist ein Schauspieler, deshalb zählt diese Antwort! Ich habe ihn seit März wegen der Pandemie nicht mehr gesehen (er lebt in Kanada) und vermisse ihn furchtbar. Ich bin sicher, dass wir den Abend zusammen verbringen würden, um unsere gemeinsame Zukunft zu planen.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
– Das Vorübergehen der Jahreszeiten,
– wenn man jemanden nach einer
langen Zeit wieder umarmt...
– Tiere!
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 78, Oktober 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Biografien

Kirill Karabits, Musikalische Leitung
Kirill Karabits
Kirill Karabits wurde in Kiew geboren und studierte zunächst Klavier, Musikwissenschaften und Komposition in Kiew. 1995 wechselte er an die Musikhochschule Wien und erlangte dort sein Diplom als Kapellmeister. Danach studierte er an der Bachakademie in Stuttgart, wo er Schüler von Helmuth Rilling und Peter Gülke war. Noch während seiner Studienzeit assistierte er als Dirigent beim Festival Orchester Budapest. 2002 gewann er beim Orchestre Philharmonique de Radio France den «jeune chef associé», den er bis 2005 inne hatte. Dem schloss sich von 2005-2007 die Tätigkeit des ersten Gastdirigenten am Orchestre Philharmonique de Strasbourg an. Im Oktober 2006 gastierte er das erste Mal beim Bournemouth Symphony Orchestra, dessen Chefdirigent er anschliessend für elf Jahre wurde. Von 2016-2020 war er Generalmusikdirektor am Deutschen Nationaltheater und der Staatskapelle Weimar. In den letzten Jahren hat er mit zahlreichen renommierten Klangkörpern gearbeitet, u.a. den Orchestern von San Francisco, Chicago, den Münchner Philharmonikern, dem Orchestre National de France, dem Orchestra Filarmonica del Teatro La Fenice und dem BBC Symphony Orchestra und dirigierte dabei u.a. an der Staatsoper Hamburg, am Bolschoi Theater Moskau und am Glyndebourne Festival. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit dem russischen Nationalorchester, mit welchem er 2019 beim Edinburgh Festival auftrat und 2019/20 eine Tour durch Nordamerika, Europa und Asien machten (u.a. Lincoln Center in New York und Elbharmonie Hamburg). 2013 erhielt er den Royal Philharmonic Society Music Award als «Dirigent des Jahres». Am Opernhaus Zürich dirigierte er zuletzt 2020 Boris Godunov.

Barrie Kosky, Inszenierung
Barrie Kosky
Barrie Kosky war von 2012 bis 2022 Intendant und Chefregisseur der Komischen Oper Berlin. Er inszeniert u.a. an Opernhäusern wie der Bayerischen Staatsoper, der Pariser Oper, dem Royal Opera House Covent Garden und an der Wiener Staatsoper, bei den Salzburger und den Bayreuther Festspielen, dem Glyndebourne Festival sowie an Schauspielhäusern wie dem Deutschen Theater Berlin und dem Schauspiel Frankfurt. 1996 war er Künstlerischer Leiter des Adelaide Festivals und von 2001 bis 2005 Co-Direktor des Schauspielhauses Wien. An der Komischen Oper Berlin inszenierte er Die Zauberflöte (zusammen mit «1927»), die inzwischen weltweit zu sehen ist und 2019 in mehreren Kategorien mit den australischen Helpmann Awards ausgezeichnet wurde, sowie u.a. Die Nase und Pelléas et Mélisande. Für Aus einem Totenhaus (Staatsoper Hannover) erhielt er 2009 den Theaterpreis «Der Faust», für Castor et Pollux (English National Opera) 2011 den Laurence Olivier Award. 2014 wurde er in der Kategorie «Regisseur des Jahres» mit dem International Opera Award ausgezeichnet und 2016 in der Kritikerumfrage der Opernwelt zum «Regisseur des Jahres» gewählt. Die Komische Oper Berlin wurde in derselben Zeitschrift für die Spielzeit 2012/13 zum «Opernhaus des Jahres» ernannt, 2015 folgte der International Opera Award in der Kategorie «Ensemble des Jahres». Seine Bayreuther Inszenierung Die Meistersinger von Nürnberg wurde 2017 in der Kritikerumfrage der Opernwelt zur «Aufführung des Jahres» gewählt. 2020 kürte ihn die Zeitschrift Die deutsche Bühne zum «besten Opernregisseur». Am Opernhaus Zürich inszenierte Barrie Kosky La fanciulla del West, Macbeth, Eugen Onegin, Die Gezeichneten und Boris Godunow.

Rufus Didwiszus, Bühnenbild
Rufus Didwiszus
Rufus Didwiszus studierte Bühnen- und Kostümbild in Stuttgart bei Jürgen Rose und arbeitet seither als freier Bühnenbildner in Theater-, Opern- und Tanzproduktionen, u. a. mit Barrie Kosky (La Belle Hélène, Die Perlen der Cleopatra und Anatevka an der Komischen Oper Berlin; La fanciulla del West, Die Gezeichneten und Boris Godunow am Opernhaus Zürich; Orphée aux enfers, Salzburger Festspiele; Fürst Igor, Opéra de Paris; Der Rosenkavalier, Bayerische Staatsoper), Thomas Ostermeier (u.a. Shoppen &Ficken in der Baracke des Deutschen Theaters Berlin mit Einladung zum Berliner Theatertreffen und nach Avignon; Der blaue Vogel am Deutschen Theater, Feuergesicht am Schauspielhaus Hamburg, Der Name bei den Salzburger Festspielen und an der Berliner Schaubühne, The Girl on the Sofa beim Edinburgh International Festival und an der Schaubühne, Vor Sonnenaufgang an den Münchner Kammerspielen), Sasha Waltz, Tom Kühnel, Christian Stückl, Stefan Larsson, Tomas Alfredson und Christian Lollike. Seit 2004 entwirft und inszeniert Rufus Didwiszus mit Joanna Dudley eigene Musik-Theater-Performances, u. a. in den Sophiensaelen, an der Schaubühne und im Radialsystem in Berlin sowie im BOZAR in Brüssel. Mit seiner Band «Friedrichs» war er in Der weisse Wolf am Staatstheater Stuttgart zu sehen. Zudem war er als Gastdozent an der Akademie der Bildenden Künste München und an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee tätig. Für Christian Spuck entstanden die Bühnenbilder zu Der fliegende Holländer an der Deutschen Oper Berlin, Nussknacker und Mausekönig, Winterreise, Das Mädchen mit den Schwefelhölzern, Dornröschen und Monteverdi beim Ballett Zürich sowie Orlando am Moskauer Bolschoitheater.

Klaus Bruns, Kostüme
Klaus Bruns
Klaus Bruns studierte Bühnenbild und Kostümentwurf am Mozarteum in Salzburg. Seit fast 30 Jahren ist er als Kostümbildner tätig, u.a. an den Schauspielhäusern von Stuttgart, Graz, Frankfurt, Zürich, Köln, Leipzig, dem Burgtheater in Wien, dem Thalia-Theater Hamburg, der Schaubühne und dem Deutschen Theater Berlin sowie dem Residenztheater und den Kammerspielen in München. Eine enge Zusammenarbeit verbindet ihn mit Karin Henkel. In der Oper arbeitet er u. a. mit Barrie Kosky, Michael Talke, Andreas Homoki, Olivier Tambosi, Michael Schulz, Harry Kupfer, Götz Friedrich und Christof Loy, u. a. an den drei Berliner Opernhäusern, der Nürnberger Oper, der Hamburgischen Staatsoper, der Vlaamse Opera Antwerpen, der Bayerischen Staatsoper München, der Oper Leipzig, dem Teatro Regio Turin, dem Theater an der Wien, den Nationaltheatern in Mannheim und Weimar, dem Rossini Opera Festival in Pesaro und der Oper Amsterdam. Mit Barrie Kosky entstanden u. a. Der Ring des Nibelungen an der Staatsoper Hannover, Rusalka, Moses und Aron, Eugen Onegin, Anatevka und Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny an der Komischen Oper Berlin, La fanciulla del West, Macbeth, Die Gezeichneten, Jewgeni Onegin und Boris Godunow am Opernhaus Zürich, Prinz Igor an der Opéra Bastille in Paris, Die Meistersinger von Nürnberg bei den Bayreuther Festspielen, Fiddler on the Roof an der Lyric Opera of Chicago und Agrippina an der Staatsoper in Hamburg.

Franck Evin, Lichtgestaltung
Franck Evin
Franck Evin, geboren in Nantes, ging mit 19 Jahren nach Paris, um Klavier zu studieren. Nachts begleitete er Sänger im Café Théâtre Le Connetable und begann sich auch für Beleuchtung zu interessieren. Schliesslich entschied er sich für die Kombination aus Musik und Technik. Dank eines Stipendiums des französischen Kulturministeriums wurde er 1983 Assistent des Beleuchtungschefs an der Opéra de Lyon. Hier arbeitete er u. a. mit Ken Russel und Robert Wilson zusammen. Am Düsseldorfer Schauspielhaus begann er 1986 als selbstständiger Lichtdesigner zu arbeiten und legte 1993 die Beleuchtungsmeisterprüfung ab. Besonders eng war in dieser Zeit die Zusammenarbeit mit Werner Schröter und mit dem Dirigenten Eberhard Kloke. Es folgten Produktionen u. a. in Nantes, Strassburg, Paris, Lyon, Wien, Bonn, Brüssel und Los Angeles. Von 1995 bis 2012 war er Künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung der Komischen Oper Berlin und dort verantwortlich für alle Neuproduktionen. Hier wurden besonders Andreas Homoki, Barrie Kosky, Calixto Bieto und Hans Neuenfels wichtige Partner für ihn. Im März 2006 wurde Franck Evin mit dem «OPUS» in der Kategorie Lichtdesign ausgezeichnet. Seit Sommer 2012 arbeitet er als künstlerischer Leiter der Beleuchtungsabteilung an der Oper Zürich. Franck Evin wirkt neben seiner Tätigkeit in Zürich weiterhin als Gast in internationalen Produktionen mit, etwa an den Opernhäusern von Oslo, Stockholm, Tokio, Amsterdam, München, Graz sowie der Opéra Bastille, der Mailänder Scala, dem Teatro La Fenice, der Vlaamse Opera und bei den Bayreuther Festspielen.

Ernst Raffelsberger, Choreinstudierung
Ernst Raffelsberger
Ernst Raffelsberger stammt aus Gmunden, Oberösterreich. Er studierte Musikpädagogik und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien (Chorleitung bei Prof. Erwin Ortner) und anschliessend Chordirigieren am Salzburger Mozarteum bei Prof. Walter Hagen-Groll. Von 1983 bis 1986 war er Kapellmeister der Wiener Sängerknaben. In dieser Zeit leitete er das Ensemble in Wien und auf Tourneen durch Europa, Südafrika, Kanada und die USA. Ab 1986 war Ernst Raffelsberger Chordirektor und Kapellmeister am Landestheater Salzburg (Mitwirkung bei der Salzburger Mozartwoche und den Salzburger Festspielen). 1989 wurde er von Donald Runnicles als Chordirektor und Kapellmeister an das Theater in Freiburg/Breisgau berufen. Seit Herbst 1993 ist Ernst Raffelsberger am Opernhaus Zürich als Chordirektor engagiert. Hier hat er inzwischen über 100 Premieren betreut und mit vielen namhaften Dirigenten wie Riccardo Chailly, Christoph von Dohnányi, Vladimir Fedoseyev, Sir John Eliot Gardiner, Daniele Gatti, Bernard Haitink, Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta und Franz Welser-Möst zusammengearbeitet. Gastspiele mit dem Opernhaus Zürich führten ihn nach Wien, London, Paris und Tokio. Zahlreiche CD- und DVD-Aufnahmen dokumentieren diese Arbeit. Im Sommer 2012 begann zusätzlich seine Tätigkeit als Chordirektor der Salzburger Festspiele. Er ist dort für die Produktionen der Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor verantwortlich. In seiner ersten Festspielsaison kam es u. a. zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit Riccardo Muti und Sir Simon Rattle.

Kathrin Brunner, Dramaturgie
Kathrin Brunner
Kathrin Brunner wurde in Zürich geboren. Sie studierte in ihrer Heimatstadt sowie an der Humboldt-Universität Berlin Germanistik, Musikwissenschaft und Französisch. Nach diversen Regiehospitanzen (u.a. Die Dreigroschenoper am Luzerner Theater; Regie: Vera Nemirova) und Dramaturgiehospitanzen ist sie seit 2008 Dramaturgin am Opernhaus Zürich. Hier arbeitete sie u.a. mit Regisseur:innen wie Achim Freyer (Moses und Aron), Harry Kupfer (Die Meistersinger von Nürnberg, Tannhäuser), Stephan Müller, Guy Joosten, Damiano Michieletto, Christof Loy (La straniera, Alcina, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale, La rondine), Willy Decker (Il ritorno d'Ulisse in patria, The Turn of the Screw), Andreas Homoki (Wozzeck, Das Land des Lächelns, La forza del destino), Christoph Marthaler (Il viaggio a Reims, Orphée et Euridice), Barrie Kosky (Die Gezeichneten, Boris Godunow), Nadja Loschky, Nina Russi, Jan Essinger und Jetske Mijnssen (Idomeneo, Hippolyte et Aricie, Platée). Bei den Salzburger Festspielen 2012 erarbeitete sie La bohème mit Damiano Michieletto. Während der Corona-Pandemie war sie Co-Gründerin der Konzertreihe Altchemie live in der Alten Chemie Uetikon (https://www.altchemie.live).

Michael Volle, Boris Godunow
Michael Volle
Michael Volle studierte bei Josef Metternich und Rudolf Piernay. Nach Engagements an den Opernhäusern in Mannheim, Bonn, Düsseldorf und Köln war er Mitglied des Ensembles des Opernhauses Zürich und der Bayerischen Staatsoper in München. In Zürich war er u.a. als Marcello (La bohème), Jewgeni Onegin, Jeletzki (Pique Dame), Roland (Fierrabras), Sixtus Beckmesser, Hans Sachs (Meistersinger von Nürnberg) und Golaud (Pelléas et Mélisande) zu erleben. Gastspiele führten ihn an alle grossen Opernhäuser im In- und Ausland (u.a. Berlin, München, Hamburg, Dresden, London, Paris, Barcelona, Wien, Mailand, Florenz, New York) und zu bedeutenden Festspielen (u.a. Salzburg, Bregenz, Baden-Baden). Bei den Bayreuther Festspielen 2007 und 2008 sang er den Beckmesser, 2017 den Hans Sachs und 2023 den Holländer. Zuletzt war er an der Metropolitan Opera in New York, in Florenz in der Titelpartie von Verdis Falstaff, sowie als Hans Sachs an der Staatsoper Wien zu erleben. In Mailand beeindruckte er als Pater ecstaticus in Mahlers 8. Sinfonie und als Jochanaan in Salome. An der Hamburgischen Staatsoper brillierte er, neben Klaus Florian Vogt, in der Rolle des Wolfram in Wagners Tannhäuser. 2008 und 2023 wählte ihn die «Opernwelt» zum «Sänger des Jahres». Für seine Interpretation des Wozzeck wurde er 2009 mit dem Deutschen Theaterpreis «Der Faust» ausgezeichnet. Als Anerkennung für seine Leistungen auf der Bühne wurde ihm bei den «Oper! Awards 2023» der Preis in der Kategorie «Bester männlicher Sänger» verliehen. Am Opernhaus Zürich sang er zuletzt Wolfram in Tannhäuser (2012), die Titelpartie in Wagners Der fliegende Holländer (2016), Nabucco (2019) und Boris Godunow (2020).

Lina Dambrauskaité, Xenia, seine Tochter
Lina Dambrauskaité
Lina Dambrauskaité stammt aus Litauen und hat ihre Gesangsaubildung bei Sigute Stonyte an der Litauischen Musik- und Theaterakademie abgeschlossen. Ausserdem belegte sie Kurse bei Lillian Watson und Jonathan Papp an der Royal Academy Opera, wo sie 2017 ihr Londoner Debüt als Zerlina in Mozarts Don Giovanni gab. Zuvor debütierte sie 2015 als Barbarina in Mozart’s Le nozze di Figaro am Litauischen Nationaltheater für Oper und Ballett. Zu ihrem Repertoire gehören Thais in Händels Das Alexanderfest, Yniold in Debussys Pelléas et Mélisande sowie die Titelpartie in Händels Semele, Le Feu/Le Rossignol (L’Enfant et les sortilèges) und Vixen (The Cunning Little Vixen). Zudem hat sie an der Weltaustellung «Expo 2015» in Mailand Litauen repräsentiert und diverse Solopartien in Konzerten gesungen. Im Frühjahr 2019 hat Lina Dambrauskaité die Titelrolle in Leoš Janáčeks Das schlaue Füchslein an der Royal Academy Opera gesungen und im Herbst 2019 Cunigonde (Candide) am Litauischen Nationaltheater. Ab 2019/20 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich und sang hier u.a. in Belshazzar, Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse, der Zauberflöte und Iphigénie en Tauride. Für ihre Interpretation von Marie (La Fille du regiment) und von Sophie (Der Rosenkavalier) erhielt sie 2022 den Golden Cross of the Stage.

Irène Friedli, Amme
Irène Friedli
Irène Friedli ist in Räuchlisberg, Schweiz, aufgewachsen und schloss an der Musik-Akademie Basel mit dem Solistendiplom ab. Die Altistin ergänzte ihre Studien in der Interpretationsklasse von Dietrich Fischer-Dieskau in Berlin, nahm an Meisterkursen von Brigitte Fassbaender teil und bildete sich bei Helen Keller weiter. Sie gewann zahlreiche Preise bei internationalen Liedwettbewerben. Seit 1994/95 ist sie Ensemblemitglied des Opernhauses Zürich. Hier sang sie u.a. 2. und 3. Dame (Die Zauberflöte), Mercédès (Carmen), die Titelrolle in Ravels L’Enfant et les sortilèges, Elsbeth in Schlafes Bruder (UA), Lily in Harley (UA), Annina und Flora (La traviata), Flosshilde (Rheingold, Götterdämmerung), Marcellina (Le nozze di Figaro), Emilia (Otello), Lucia (Cavalleria rusticana), Olga in Peter Eötvös’ Drei Schwestern, Marthe in Gounods Faust, Margret (Wozzeck), Lovis in Ronja Räubertochter von Jörn Arnecke, Blumenmädchen und Stimme aus der Höhe (Parsifal), Gertrud/Knusperhexe (Hänsel und Gretel), Clotilde (Norma), Mutter/Andermutter (Coraline), Kartenaufschlägerin (Arabella) und Amme (Boris Godunow). In der Uraufführung der Familienoper Odyssee verkörperte sie Eurykleia/Mutter und in Girl with a Pearl Earring Tanneke. 2012 gastierte sie an der Opéra Bastille in Paris. Zuletzt trat sie in Zürich u.a. als Herzkönigin in Alice im Wunderland, Filipjewna in Jewgeni Onegin, Tisbe in La Cenerentola, Miss Bentson in Lakmé, Frau Waas/Frau Mahlzahn in Jim Knopf, Die Oberköchin in Amerika und Ninetta in I vespri siciliani auf.

John Daszak, Fürst Wassili Iwanowitsch Schuiski
John Daszak
Der britische Tenor John Daszak gab sein Bühnendebüt an der English National Opera als Števa (Jenůfa) nach seinen Studien an der Londoner Guildhall School of Music and Drama, dem Royal Northern College of Music in Manchester und der Accademia d’Arte Lirica in Osimo. Neben seinem Bayreuther Festspieldebüt 2015 als Loge (Das Rheingold) unter Kirill Petrenko, gab er in vergangener Zeit einige wichtige Rollendebüts; er sang Captain Veres (Billy Budd) an der New Yorker Met, die Titelrolle in Zemlinskys Der Zwerg an der Bayerischen Staatsoper in München, Herodes (Salome) am Royal Opera House Covent Garden unter Henrik Nanasi, den Hauptmann in Wozzeck am Theater an der Wien sowie den Tambourmajor (Wozzeck) an der Berliner Staatsoper unter Daniel Barenboim und bei seinem Salzburger Festspieldebüt unter Vladimir Jurowski. Höhepunkte der jüngeren Zeit waren Aron (Moses und Aron) an der Wiener Staatsoper und der Komischen Oper Berlin, Herodes bei den Salzburger Festspielen, Kaufmann in Jakob Lenz beim Festival d’Aix-en-Provence, Tambourmajor am Opera House Sydney und an der Opéra National de Paris sowie Aegisth (Elektra) an der Bayerischen Staatsoper. Konzertant war er mit der NDR Elbphilharmonie unter Thomas Hengelbrock in Honeggers Jeanne d’Arc au bûcher zu erleben. Auf DVD ist John Daszak u.a. in Pfitzners Palestrina unter Simone Young (Bayerische Staatsoper) und in der Inszenierung von La Fura dels Baus von Das Rheingold unter Zubin Mehta (Palau de les Arts in Valencia) zu sehen. In Zürich sang er zuletzt 2018 Alviano Salvago in Die Gezeichneten und 2020 Schuiski in Boris Godunow.

Konstantin Shushakov, Andrei Schtschelkalow
Konstantin Shushakov
Konstantin Shushakov stammt aus Russland und studierte am Izhevsk Music College und an der Russischen Akademie für Theaterkunst. 2009 wurde er Mitglied des Young Artist Program am Bolschoi-Theater in Moskau. 2011 war er Preisträger des Queen Elisabeth Wettbewerbs in Brüssel und gewann im selben Jahr den 2. Preis beim Operalia Wettbewerb in Moskau. Ein Jahr später wurde er Ensemblemitglied am Bolschoi-Theater, wo er u.a. als Morales (Carmen), Almaviva (Le nozze di Figaro), Marullo (Rigoletto), Malatesta (Don Pasquale), Schaunard und Marcello (La bohème), Lebedjev (Der Idiot), Robert (Iolanta), Papageno und Figaro (Il barbiere di Siviglia) zu erleben war. Gastengagements führten ihn 2014 als Guglielmo (Così fan tutte) an die Scala, 2016 als Ford (Falstaff) nach Genf und als Prinz Afron (Der goldene Hahn) ans Théâtre de la Monnaie in Brüssel. 2018 gastierte er in Vancouver in der Titelrolle von Jewgeni Onegin sowie als Jelezki (Pique Dame) beim Savonlinna Festival und an der Oper in Oslo. Er ist ausserdem regelmässig als Konzertsänger zu erleben; er sang in Brahms’ Ein deutsches Requiem zusammen mit dem Russischen National Orchester in der Tschaikovsky Concert Hall unter Mikhail Pletnev und in Mozarts c-Moll-Messe mit dem Musica Viva Chamber Orchestra Moskau. 2019 bis 2023 gehörte er zum Ensemble am Opernhaus Zürich und war hier u.a. als Don Giovanni, Guglielmo, Malatesta, Marcello, Andrei Tchelkalov (Boris Godunow), Ernesto (Il pirata), Ford, Valentin (Faust) und in Ein deutsches Requiem unter Gianandrea Noseda zu hören.

Brindley Sherratt, Pimen
Brindley Sherratt
Brindley Sherratt, Bass, studierte Gesang an der Royal Academy of Music in London, wo er unterdessen Mitglied des Gelehrtenkollegs und Gastprofessor ist. Sein Debüt am Covent Garden gab er 2001 als Plutone (L’anima del filosofo). Seither war er in London u.a. als John Claggart (Billy Budd), Sarastro (Die Zauberflöte), Sparafucile (Rigoletto), Ramfis (Aida) und Fafner (Siegfried und Das Rheingold) zu erleben. Er ist zudem regelmässiger Gast beim Glyndbourne Festival, wo er Sarastro, John Claggart, Baron Ochs (Der Rosenkavalier) und Rocco (Fidelio) sang. Weitere Engagements führten ihn an die Staatsopern von Wien und Hamburg sowie an De Nationale Opera in Amsterdam als Sarastro, in der Rolle des Geronte de Ravoir (Manon Lescaut) und als Bartolo (Le nozze di Figaro) an die Met, als John Claggart ans Teatro Real Madrid, als Bottom (A Midsummer Night’s Dream) an das Festival d’Aix-en-Provence, als Doktor (Wozzeck) an die Lyric Opera of Chicago, als Baron Ochs und Pogner (Die Meistersinger von Nürnberg) an die Welsh National Opera, als Filippo (Don Carlo) an die Opera North sowie als Pimen und Fiesco (Simon Boccanegra) an die English National Opera. In Zürich sang er in der Spielzeit 2018/19 zuletzt den Judge Turpin in Sweeney Todd.

Edgaras Montvidas, Grigori Otrepjew/Prätendent («der falsche Dimitri»)
Edgaras Montvidas
Edgaras Montvidas wurde in Litauen geboren, studierte an der Musik- und Theaterakademie Vilnius und sammelte erste Bühnenerfahrungen an der Litauischen Nationaloper. Nach seinem Studium war er Mitglied des Royal Opera House Covent Garden Young Artists Programme und sang dort u. a. Alfredo Germont (La traviata) und Fenton (Falstaff). Gastengagements führten ihn in jüngerer Zeit u. a. in der Titelrolle von Werther an die Opéra Nationale de Lorraine in Nancy und nach Bergen, als Anatol in Barbers Vanessa zum Glyndebourne Festival, als Alfred (Die Fledermaus) an die Bayerische Staatsoper, als Don Ottavio (Don Giovanni) und als Sir Edgardo di Ravenswood (Lucia di Lammermoor) an die Semperoper Dresden, in der Titelrolle von Faust, als Lensky (Jewgeni Onegin), Alfredo (La traviata) und Pinkerton (Madama Butterfly) nach Vilnius, als Conrad in Saint-Saëns Le Timbre d’argent an die Opéra Comique in Paris und als Pastore in einer konzertanten Aufführung von Szymanowskis Re Ruggero zur Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom unter der Leitung von Antonio Pappano. In der Spielzeit 2019/20 war er als Pinkerton in Nancy, als Boris Grigorjewitsch (Katja Kabanova) an der Staatsoper Hamburg und in der Titelrolle der Uraufführung Egmont von Christian Jost am Theater an der Wien zu erleben. Auch auf der Konzertbühne ist Edgaras Montvidas zu Hause; er konzertierte u.a. als Fischer (Le Rossignol) mit den Berliner Philharmonikern unter der musikalischen Leitung von Pierre Boulez, mit dem Boston Symphony Orchestra unter Charles Dutoit (Król Roger und L’Enfant et les sortilèges) sowie für Radio France mit Benjamin Godards Dante und Éduard Lalos La Jacquerie. Jüngst sang er zudem Faust an der Vilnius City Opera, Pinkerton und Alfredo an der Litauischen Nationaloper, Tito (La clemenza di Tito) am ROH London und Lensky an der Norske Opera Oslo. Am Opernhaus Zürich debütierte er 2020 als Grigori Otrepjew/Prätendent in Boris Godunov.

Oksana Volkova, Marina Mnischek
Oksana Volkova
Oksana Volkova wuchs in Minsk auf und absolvierte ihre Gesangsausbildung bei Lidia Galushkina an der Staatlichen Musikakademie in ihrer Heimatstadt. Dort wurde sie bereits 2002, in ihrem dritten Studienjahr, an die Weissrussische Bolschoi-Oper verpflichtet. 2007 gewann sie den Internationalen Glinka-Wettbewerb und wurde 2009 in das «Young Singers Program» des Moskauer Bolschoi-Theaters aufgenommen. Mittlerweile gastiert sie an führenden Opernhäusern auf der ganzen Welt. So sang sie an der Met in New York Maddalena (Rigoletto), Olga (Jewgeni Onegin), Sonjetka (Lady Macbeth von Mzensk) und Giulietta (Les Contes d’Hoffmann) an der Scala in Mailand, Santuzza (Cavalleria rusticana) am Royal Opera House London. Am Teatro Real Madrid war sie als Olga zu erleben und an der Oper Tel Aviv als Preziosilla (La forza del destino). Die Titelrolle der Carmen sang sie in Litauen, Riga, Tallin, Buenos Aires und am Bolschoi-Theater in Moskau. Dem Bolschoi ist sie seit vielen Jahren eng verbunden und interpretierte dort neben Carmen u. a. Laura (Der steinerne Gast von Dargomyzhsky), Polina (Pique Dame), Fenena (Nabucco) und Ljubascha (Die Zarenbraut). Jüngst sang sie u.a. Olga an der Staatsoper Hamburg, Santuzza am Grand-Théâtre de Genève, Polina bei den Salzburger Festspielen, Sonjetka an der Opéra National de Paris, Prinzessin Eboli (Don Carlo) an der Oper Graz sowie im Sommer 2019 in Verdis Requiem beim Tanglewood Festival mit dem Boston Symphony Orchestra. In Zürich war sie als Marina in Boris Godunow zu hören.

Johannes Martin Kränzle, Rangoni, geheimer Jesuit
Johannes Martin Kränzle
Johannes Martin Kränzle wurde in Augsburg geboren. Er studierte zunächst Violine und Musiktheaterregie, danach Gesang in Frankfurt. Seine ersten Stationen im Festengagement waren die Opernhäuser Dortmund, Hannover und Frankfurt. Er ist seither regelmässig Gast an den grossen Bühnen, so an der New Yorker Met, Mailänder Scala, Londoner Covent Garden, Pariser Opéra, Teatro Real Madrid, Zürich, Berlin, München und Hamburg. Sein Opernrepertoire umfasst 120 Partien und reicht von Händel, Rossini, Verdi, Strauss und Lehar bis zu Henze und Rihm. Schwerpunkte bilden Mozart und Wagner sowie das slawische Repertoire. Regelmässig widmet er sich dem Lied- und Konzertgesang. 1997 wurde seine Kammeroper Der Wurm beim Kompositionswettbewerb in Berlin ausgezeichnet und uraufgeführt. 2016 komponierte er den Zyklus Lieder um Liebe nach Brechts Liebesgedichten. 2011 und 2018 wurde er «Sänger des Jahres» bei der Kritikerumfrage der OPERNWELT, 2019 gewann er den deutschen Theaterpreis «Der Faust». Seit 2014 ist er Mitglied der Deutschen Akademie der darstellenden Künste. 2015 wurde bei ihm eine aggressiv fortschreitende Form der Knochenmarkerkrankung MDS diagnostiziert und er musste sich einer Stammzell-Transplantation unterziehen. Mit grossem Erfolg kehrte er 2016 in London (Così fan tutte) zurück auf die Bühne. Es folgten Debüts u.a. an der Pariser Oper (Wozzeck), an der Elbphilharmonie und bei den Bayreuther Festspielen (Die Meistersinger von Nürnberg). In Zürich gab er in der Spielzeit 2019/20 sein Rollendebüt als Don Pasquale und sang 2020/21 Rangoni in Boris Godunow. In der Spielzeit 2022/23 singt er u.a. Alberich (Ring des Nibelungen) an der Staatsoper Berlin, Don Alfonso an der Bayerischen Staatsoper und Wozzeck an der Wiener Staatsoper.

Alexei Botnarciuc, Warlaam, Bettelmönch
Alexei Botnarciuc
Alexei Botnarciuc, Bass, wurde in Moldawien geboren und studierte an der Musikakademie in Chișinău. Er gewann zahlreiche Preise u.a. beim VoxArtis-Wettbewerb in Rumänien (2012) und beim Stanislaw-Moniuszko-Wettbewerb in Polen (2013). Ab 2010 war er als Solist an der Moldawischen Nationaloper in Chișinău engagiert, wo er u.a. Leporello (Don Giovanni), Don Basilio (Il barbiere di Siviglia), Colline (La bohème), Sparafucile (Rigoletto), Gran Sacerdote (Nabucco), Gremin (Eugen Onegin) und König René (Iolanta) gesungen hat. 2013 gab er sein Debüt an der Pariser Opéra Bastille als Ramfis (Aida). Er war Mitglied des IOS und war hier u.a. als Narumov (Pique Dame), Ramfis sowie in Salome, Don Carlo und La fanciulla del West zu hören. Seit der Spielzeit 2015/16 ist er festes Ensemblemitglied an der Deutschen Oper Berlin, wo er zuletzt als Sciarrone (Tosca), Reinmar von Zweter (Tannhäuser), Warlaam (Boris Godunow) und Thoré / Maurevert (Les Huguenots) gesungen hat.

Iain Milne, Missail, Bettelmönch
Iain Milne
Iain Milne stammt aus Aberdeenshire/Schottland. Er schloss sein Studium an der Royal Academy of Music in London mit Auszeichnung ab, war Mitglied des National Opera Studio in London und des Internationalen Opernstudios in Zürich. Sein Operndebüt gab er in der Titelrolle von Mozarts La clemenza di Tito. Seither sang er u.a. in Peter Maxwell Davies’ The Lighthouse an der Royal Academy und Tamino an der Hampstead Garden Opera. Engagements als Solist in Oratorien führten ihn zudem nach Hamburg (Händels Messiah), nach Aberdeen (Haydns Schöpfung) und in die Fairfield Halls in Croydon (Elgars Dream of Gerontius). Als Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich war er u.a. als Orlando (Haydns Orlando paladino), als Erster Priester (Die Zauberflöte), Brighella (Ariadne auf Naxos) sowie in Lohengrin, Fälle, Elektra, Il viaggo a Reims, Le Comte Ory und Der Zauberer von Oz zu hören. Seit der Spielzeit 2016/17 gehört er zum Ensemble des Opernhauses Zürich und sang hier u.a. Normanno in Lucia di Lammermoor, Roderigo in Otello, Jakob Glock in Prokofjews Der feurige Engel, Jack in Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, Pong in Turandot, Gastone in La traviata, Menaldo Negroni in Die Gezeichneten, The Beadle in Sweeney Todd, Mister Bobo / Ander-Bobo in Coraline, Walther von der Vogelweide in Tannhäuser und Misail in Boris Godunov. Ausserdem sang er den 1. Juden in Salome, Van Ruijven in Girl with a Pearl Earring, Normanno in Lucia di Lammermoor, Cajus in Falstaff und Pang in Turandot. Jüngst übernahm er an De Nationale Opera Jack / Tobby Higgins in Weills Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny.

Katia Ledoux, Schenkwirtin
Katia Ledoux
Katia Ledoux (Mezzosopran) wurde in Paris geboren und wuchs in Österreich auf. Mit sechs Jahren begann sie bei den Schubert Sängerknaben in Wien zu singen und gewann 2008 den ersten Preis beim Jugendgesangswettbewerb «Prima la Musica». 2017 war sie Preisträgerin des «Feruccio Tagliavini» Gesangswettbewerbs, 2018 Stipendiatin in Bayreuth und im selben Jahr gewann sie den Pressepreis bei der «International Vocal Competition» in ‘s-Hertogenbosch. 2019 war sie Preisträgerin der «Belvedere Competition» und gewann den ersten Preis beim «Nordfriesischen Liedpreis». Auf der Bühne war sie als Marcellina in Le nozze di Figaro u. a. am Stadttheater Schaffhausen, der Kammeroper Schönbrunn, der Sommerserenade Graz und am Stadttheater Wels und als Zita in Gianni Schicchi am Schlosstheater Schönbrunn zu erleben. 2017 debütierte sie an der Oper Graz als Mutter in Amahl and the night visitors von Gian Carlo Menotti. 2019 gab sie ihr Debüt als Geneviève in Pelléas et Mélisande an De Nationale Opera Amsterdam mit dem Concertgebouw Orchester. Von 2019 bis 2021 gehörte sie zum Internationalen Opernstudio des Opernhauses Zürich und war u. a. in Die Sache Makropulos, Belshazzar, Coraline, Zauberflöte, Belshazzar und Iphigénie en Tauride zu hören. Zudem gab sie hier 2021 das Konzert Opera goes Pop und war 2023 als Gertrude in Roméo et Juliette zu erleben. Jüngst sang sie Ježibaba (Rusalka) an der Staatsoper Stuttgart sowie Prinz Orlofsky (Die Fledermaus), Marta (Iolanta) und Vénus / Orphée / L’opinion Publique (Orphée aux enfers) an der Volksoper Wien.

Spencer Lang, Gottesnarr
Spencer Lang
Spencer Lang stammt aus Sandy/Oregon und studierte an der Juilliard School in New York sowie am Curtis Institute of Music in Philadelphia. Am Curtis Opera Theatre interpretierte er u. a. Nemorino (L’elisir d’amore), Goffredo (Rinaldo), Lechmere in Brittens Owen Wingrave und Monostatos (Die Zauberflöte). Zu hören war er ausserdem am Opera Theatre of St. Louis als Liederverkäufer (Puccinis Il tabarro), sang Flute / Thisbe in Brittens A Midsummer Night’s Dream am Aspen Opera Theatre und trat als Solist mit dem Juilliard Orchestra, Juilliard 415, und der Northwest Sinfonietta auf. Von 2014-2016 war er Mitglied des Internationalen Opernstudios in Zürich und war hier zunächst als Daniel (Robin Hood), Hirt (Tristan und Isolde), Fay-Pu (Rote Laterne) sowie in Lohengrin, Luisa Miller und Fälle von Oscar Strasnoy zu erleben. 2015/16 sang er Monsieur Vogelsang (Der Schauspieldirektor), Don Luigino (Il viaggio a Reims) und Medoro (Orlando paladino). 2015 war er Finalist in der Wigmore International Song Competition in London. Spencer Lang gehörte zum Ensemble des Opernhauses Zürich und sang hier u. a. Pedrillo (Die Entführung aus dem Serail), Arcas (Médée), Graf Gustav (Das Land des Lächelns), Jaquino (Fidelio), Mister Bobo/Ander-Bobo (Coraline), Tobias Ragg in der Musical-Neuproduktion Sweeney Todd, Tisiphone/Seconde Parque in Hippolyte et Aricie, Graf Boni (Die Csárdásfürstin), Andrès / Cochenille / Frantz / Pitichinaccio in Les Contes d’Hoffmann, Basilio in Le nozze di Figaro sowie Le Remendado in Carmen.

Valeriy Murga, Polizeioffizier
Valeriy Murga
Valeriy Murga studierte an der Ukrainischen Nationalen Musikakademie Kiew. Sowohl beim 41. Concours International de Chant in Toulouse 1996 als auch beim 7. Julian-Gayarre-Wettbewerb in Pamplona 1998 gehörte er zu den Finalisten. 1997 gewann er den zweiten Preis beim Maria Callas Grand Prix in Athen und konnte 1999 am Cardiff Singer of the World-Wettbewerb (BBC) teilnehmen. 1997 bis 1999 war er Solist der Ukrainischen Nationaloper Kiew, wo er u.a. die Rollen Figaro, Don Giovanni, Germont, Escamillo, Onegin, den Fürsten Igor und Schaunard verkörperte. In seinem Repertoire befinden sich ausserdem Partien wie der Marchese di Posa (Don Carlo) und Schaklowity (Chowanschtschina). Am Opernhaus Zürich trat Valeriy Murga noch als Mitglied des IOS u.a. in Tosca (Sciarrone, Schliesser) und Rigoletto (Monterone) auf. Seit Beginn der Spielzeit 2000/01 ist er hier fest engagiert und war u.a. in Pique Dame (Jelezki), Carmen (Moralès), Salome (2. Soldat), Il barbiere di Siviglia (Fiorello/Ufficiale), La sonnambula (Alessio), Rigoletto (Marullo und Monterone), L’italiana in Algeri (Ali), Faust (Wagner) sowie in Familienopern wie u.a. Das Gespenst von Canterville (Dr. Bürkli), Robin Hood (Little John), Das verzauberte Schwein (Schwein) und Jim Knopf (Halbdrache/Oberbonze Pi Pa Po) zu hören. In Tiefland gastierte er am Liceu Barcelona und in L’italiana in Algeri an der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Zuletzt war er in Zürich u.a. in Die Odyssee (Eurylochos), Dialogues des Carmélites (Le Geôlier), La bohème (Dottor Grenvil), Alice im Wunderland (Schlafmaus/Zwiddeldum), La rondine (Butler) und Die lustige Witwe (Bogdanowitsch) zu erleben.

Saveliy Andreev, Leibbojar
Saveliy Andreev
Saveliy Andreev wurde in Sankt Petersburg geboren und studierte am Glinka Choral College Gesang, Dirigat und Klavier. 2015 schloss er sein Studium in Chorleitung ab und studierte anschliessend in Sankt Petersburg am Rimski-Korsakov Konservatorium Gesang. In der Music Hall in Sankt Petersburg war er seit 2017 regelmässig als Solist zu hören. 2017 war er Teilnehmer des Festivals «14th German Week» in St. Petersburg und sang dort eine Solopartie in der Bach-Kantate Lasst uns sorgen, lasst uns wachen. 2018 gewann er den ersten Preis in der Tenor-Kategorie bei dem Wettbewerb «Great Opera. Voices of the Future». 2019 war er Teilnehmer eines Studienprogramms des Teatro del Maggio Musicale in Florenz. Seit der Spielzeit 2020/21 ist er Mitglied des Internationalen Opernstudios und war hier bisher in Boris Godunov, Simon Boccanegra, Salome, Le Comte Ory, Dialogues des Carmélites und in Il mondo della luna zu erleben.

Ilya Altukhov, Lawitzki, Jesuit / Mitjucha, Bauer
Ilya Altukhov
Ilya Altukhov, Bassbariton, stammt aus Russland und war vor seinem Studium am Khabarovsk College of Art als Popsänger tätig. 2007 vertrat er Russland beim Junior Eurovision Song Contest. Nach seinem Studium sang er 2017 beim Dinara Alieva Festival Rambaldo in Puccinis La rondine und 2019 Gubetta in Donizettis Lucrezia Borgia. Im gleichen Jahr schloss er seinen Master an der Academy of Choral Art in Moskau ab und begann als Solist für ein barockes Musik-Ensemble unter Andrei Spiridonov zu singen. Dabei sang er Rollen wie Miller in der Oper Magician, Fortuneteller and Matchmaker des russischen Komponisten Yevstigney Fomin und Colas in Mozarts Bastien und Bastienne. 2021 sang er Polyphemus in einer konzertanten Vorstellung von Acis and Galatea in der Philharmonie Moskau. Ab der Spielzeit 2020/21 war Ilya Altukhov Mitglied des Internationalen Opernstudios Zürich und war hier in der IOS-Produktion Viva la mamma sowie in Salome, Tosca, Le Comte Ory und in L’italiana in Algeri zu erleben.

Brent Michael Smith, Tschernikowski, Jesuit
Brent Michael Smith
Brent Michael Smith stammt aus den USA. Er studierte Gesang an der Academy of Vocal Arts in Philadelphia und der University of Northern Iowa sowie Klavier am Hope College. 2021 gewann er den 3. Preis beim Concorso Lirico Internazionale di Portofino, war Finalist beim Queen Sonja International Music Competition und gewann das Förderstipendium der Zachary L. Loren Society, 2020 war er Halbfinalist bei den Metropolitan Opera Council Auditions, 2018 war er Preisträger des Opera Index Wettbewerbs und der Opera Birmingham International Competition, ausserdem gewann er Preisträger bei der Giargiari Bel Canto Competition. In der Spielzeit 2016/17 war er als Gast am Michigan Opera Theatre engagiert und sang dort Zuniga in Carmen, den British Major in Silent Night von Kevin Puts, Friedrich Bhaer in Little Women und Ashby in La fanciulla del West. In der gleichen Spielzeit debütierte er an der Toledo Opera als Antonio in Le nozze di Figaro und beim Glimmerglass Festival als Ariodante in Xerxes. An der Santa Fe Opera war er als Lakai in Ariadne auf Naxos zu erleben. An der Opera Philadelphia sang er 2019 Tschelio in Die Liebe zu den drei Orangen und Peter Quince in A Midsummer Night’s Dream. Nach einer Spielzeit im Internationalen Opernstudio gehört er seit 2020/21 zum Ensemble des Opernhauses, wo er bisher in Boris Godunow, Simon Boccanegra, I Capuleti e i Montecchi, im Ballett Monteverdi, als Sparafucile (Rigoletto), als Graf Lamoral (Arabella), als Raimond Bidebent (Lucia di Lammermoor) als Pistola (Falstaff), Angelotti (Tosca), Gualtiero Raleigh (Roberto Devereux), Gremin (Jeweni Onegin) und Frère Laurent (Roméo et Juliette) zu hören war.