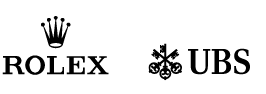Boris Godunow
Oper von Modest Mussorgski (1839-1881)
Libretto vom Komponisten nach der gleichnamigen Tragödie von Alexander Puschkin und Nikolai Karamsins «Die Geschichte des russischen Reiches»
Fassung von 1869 inklusive Polenakt und Revolutionsszene (1872)
In russischer Sprache mit deutscher und englischer Übertitelung. Dauer ca. 4 Std. inkl. Pausen nach dem 1. Teil nach ca. 1 Std. 37 Min. und nach dem 2. Teil nach ca. 2 Std. 44 Min.
Unterstützt von 
Gut zu wissen
Interview

Eine Landschaft aus Paranoia und Schlaflosigkeit
Mit Modest Mussorgskis Oper «Boris Godunow» bringt das Opernhaus Zürich zum Saisonstart ein Meisterwerk der russischen Oper auf die Bühne. Für Regisseur Barrie Kosky weist das tiefgründige Werk weit in die Zukunft, ein faszinierender Polit-Thriller von Shakespearehaften Dimensionen.
Barrie, die Salzburger Festspiele und die Staatsoper Hamburg haben ihre Neuproduktionen von Boris Godunow in dieser Spielzeit wegen Corona verschoben, du hast dich hingegen bereit erklärt, dieses Projekt in Zürich trotzdem zu verwirklichen. Gehört dazu auch eine Portion Verrücktheit, oder liebst du ganz einfach die Herausforderung?
Beides. Dazu kommt, dass ich ja nicht nur Regisseur bin, sondern auch Intendant an der Komischen Oper Berlin, und als Intendant musste ich mich sehr früh mit der Frage beschäftigen, ob und wie Musiktheater in dieser Pandemie möglich ist. Ich habe daher schnell auch über neue Lösungen für den Zürcher Boris Godunow nachgedacht und unser Konzept, das ich mit meinem Team während drei Jahren entwickelt habe, in meinem Kopf hin und her gewälzt und nach neuen Ansätzen gesucht. Andreas Homoki und ich waren uns einig, dass wir unbedingt versuchen müssen, diesen Boris auf die Bühne zu bringen. Es ging uns auch darum, ein Zeichen zu setzen und zu unseren Sängerinnen und Sängern zu stehen. Für mich ist es sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit pragmatisch und kreativ zu sein. Dennoch kamen für Andreas und mich eine neue, reduzierte Fassung von Boris für kleines Orchester, vielleicht in der Tradition von Strawinskys Les Noces mit Klavier und Schlagzeug im Graben, bei diesem Stück nicht in Frage.
Von Boris Godunow heisst es immer wieder, der eigentliche Protagonist dieser Oper sei das russische Volk. Einen Chor auf der Bühne zu haben ohne Einhaltung der Abstandsregeln, ist momentan aber nicht möglich.
Als mir Andreas von der Lösung erzählte, dass Chor und Orchester vom Orchesterproberaum am Kreuzplatz live ins Opernhaus übertragen werden sollen und er mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, eine Inszenierung ohne Chor auf der Bühne zu machen, habe ich ihn um 24 Stunden Bedenkzeit gebeten. Ich hatte bereits ein paar Ideen, aber sie waren noch sehr abstrakt. Unser Konzept spielt sowieso in einem zeitlosen Raum, in einer Bibliothek. Ich habe mir gesagt: Was wäre, wenn wir hier noch radikaler werden und unser Konzept zuspitzen? Ich will jetzt nichts verraten, aber es hat sich in den ersten Probetagen gezeigt, dass die blosse vokale Anwesenheit des Chores im Raum, als innere Stimme hochinteressant ist. Dass dieses Experiment klappen kann, hängt aber auch mit der Dramaturgie des Stücks zusammen: Der Chor agiert sowieso ziemlich unabhängig von den Hauptdarstellern. Mussorgski denkt in grossen Tableaux.
Das Volk ist in dieser Oper für das politische Spiel der Mächtigen sowieso irrelevant.
Das Volk ist ein eigener Kosmos. Das gilt aber auch für die Hauptdarsteller, deren Wege sich zum Teil nie kreuzen – ganz anders als in Opern von Mozart, Puccini oder Janáček, die von den Interaktionen der Figuren leben. Das macht es für uns geradezu zum perfekten Corona-Stück. Durch die Abwesenheit des Chores und das Fehlen des Spektakels wird die Einsamkeit der Figuren noch deutlicher, denn diese äussern sich hauptsächlich in Monologen. Sie sind einsame Planeten, von Melancholie und Trauer umgeben. Mussorgski interessiert das persönliche Schicksal dieser Individuen, deren Emotionen. Seine Musik ist für mich die Musik der Träume und Halluzinationen. Mussorgski träumt russische Geschichte, ohne uns eine trockene Geschichtslektion zu verpassen. Er malt eine Landschaft aus Angst, Paranoia, Misstrauen und Schlaflosigkeit, einen Polit-Thriller ganz ohne Dogma. Ich habe mir für Zürich die lange Fassung mit dem Polen-Akt und dem Revolutionsbild gewünscht, in der Instrumentation von Mussorgski. Hier entwirft Mussorgski ein breites gesellschaftliches Panoptikum. Wir erleben den Zaren mit seinen Kindern im Palast, tauchen in die religiöse und politische Welt ein, eine Wirtin erscheint, dann eine polnische Prinzessin, allesamt verlorene Menschen. Man fühlt die Last der Geschichte auf den Schultern dieser Menschen.
Was ist für dich das Besondere an Mussorgski als Komponist?
Mussorgski hat dieses atemberaubende Verständnis für psychologische Vorgänge. Er ist der einflussreichste russische Komponist überhaupt, am ehesten noch mit Strawinsky im 20. Jahrhundert vergleichbar. Alle waren sie von ihm fasziniert: Rimski-Korsakow, Schostakowitsch, auch Tschaikowsky insgeheim, obwohl ihm Mussorgski wohl zu radikal erschien. Mussorgski galt zu seinen Lebzeiten als ein Komponist, der sein Handwerk nicht richtig verstand, dessen chaotischen Arbeitsprozess man beargwöhnte, und der angeblich nicht für Stimmen komponieren konnte. Die sehr besondere harmonische Struktur, die seltsame Klangwelt und ungewöhnliche Orchestrierung seiner Werke verstörten. Aber Mussorgski war seiner Zeit voraus und vermittelt uns einen Hauch von dem, was dann später im 20. Jahrhundert richtig explodieren wird. In Boris Godunow experimentiert Mussorgski mit einer Theaterform, die gegen die Belcanto-Tradition geht, gegen die BarockTradition, gegen den Wagnerismus. Er erschafft etwas vollkommen Neues, auch wenn er natürlich aus der russischen Oper kommt und in der Tradition von Glinka steht: Das Stück ist eine Kombination aus russischem Verismo und einem Parlando Ton, den Debussy und Janáček im 20. Jahrhundert weiterentwickeln sollten.
Eine der unkonventionellsten Szenen in Boris Godunow ist die Krönungsszene. Während Boris die Zarenkrone erhält, erleben wir ihn nicht als strahlenden Helden, sondern Mussorgski lenkt den Blick in dessen Innerstes: Boris’ Seele «zittert». In dieser Deutlichkeit steht das nicht bei Puschkin, dessen gleichnamiges Theaterstück Mussorgski als Vorlage diente.
Das ist eben die Genialität Mussorgskis und ein Beweis für seinen Theaterinstinkt. Man erwartet den grossen Auftritt von Boris, das ganze Spektakel mit den Glocken und den Jubel-Rufen des Chores – und was macht Mussorgski? Boris hebt an mit einem melancholischen Monolog, gewissermassen seiner Winterreise. Wir erleben einen verängstigten, misstrauischen Menschen, der zum Zeitpunkt der Inthronisation bereits gescheitert ist. Gleichzeitig ist der Jubel der Menge ja nicht ungebrochen, wie es in Opern von Borodin oder Glinka der Fall wäre, sondern die «Slava»-Rufe sind genauso vorgespielt. Das Volk wurde zum Jubeln gezwungen. Die Menschen haben Angst – alle haben Angst.
Boris ist ein Machtmensch, der Sünden auf sich geladen hat und vermutlich mit dem Zarewitsch Dimitri ein Kind getötet hat. Und dennoch entsteht die paradoxe Situation, dass wir mit ihm leiden und Sympathie für ihn empfinden.
Das ist purer Shakespeare, wie wir es von seinem Richard II., Richard III. oder Macbeth kennen: Durch die emotionale Ehrlichkeit, durch die Komplexität der psychologischen Dimension wird ein zunächst unsympathischer Typ zu einem Menschen, dessen Leid wir teilen. Der historische Boris hat für Russland ja auch viele gute Dinge gemacht, aber auch viele furchtbare, wie fast alle Diktatoren. Mussorgskis Boris hat mehrere Gesichter. Er ist ehrgeizig und ein Manipulator, ein skrupelloser Machtmensch und gleichzeitig besorgter Staatsmensch. Ein Zweifler, dessen schlechtes Gewissen und Schuld ihn niederdrücken. Damit kann er nicht umgehen. Das ist eben Mussorgskis Genie, dass er eine historische Geschichte schreibt – die Geschichte von Boris Godunow, die aber letztendlich eine sehr persönliche und tieftragische Geschichte ist.
In dieser Oper wird Geschichte nicht nur leibhaftig erlebt, sondern durch die Figur des Mönchs Pimen auch aktiv niedergeschrieben.
Welcher andere Komponist würde sich trauen, eine fast 20-minütige Szene über einen alten Mönch zu schreiben, der an der Chronik Russlands sitzt? Was für eine kühne Idee! Ich kenne nichts Vergleichbares in der Opernliteratur. Dramatisch passiert eigentlich nichts. Und trotzdem ist kein einziger Takt belanglos, sondern alles ist hochemotional und hochkomplex. Als Zuschauer sitzt man gebannt auf der Stuhlkante. Das Dokumentieren des Erlebten hat sich Pimen zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Er weiss, dass er bald sterben wird und mit seinem Opus magnum wohl nie zu Ende kommen wird. Die Szene führt uns aber zu einer noch viel grösseren Frage, die dieses Stück aufwirft, nämlich: Wer schreibt eigentlich Geschichte und für wen? Wie wird sie interpretiert und wie erinnert? Was ist die Wahrheit? Geschichte ist nie objektiv. Geschichte ist für mich wie eine Parade von Geistern. Es ist eine theatralische Metapher und die Protagonisten der Geschichte gleichsam die Geister auf dieser Bühne, die ihre Versionen der Ereignisse zu artikulieren versuchen. Gemeinsam mit meinem Bühnenbildner Rufus Didwiszus sind wir daher auch auf die Bibliothek als Raum gekommen, einem magischen Ort. Und da kann es durchaus sein, dass die Bücher, dass die Geschichte zu singen anfängt...
Boris Godunow spielt in der sogenannten «Zeit der Wirren», eine Zeit der Destabilisierung der Gesellschaft und der instabilen Machtverhältnisse. Gibt es für dich Parallelen zu heute?
Wir spielen dieses Stück während der schlimmsten Pandemie der vergangenen 100 Jahre – da gibt es ein ähnliches unsicheres Grundgefühl. Kommt dazu, dass wir mitten in der Probenzeit von den Ereignissen in Weissrussland eingeholt wurden. Man geht nach Hause, sieht im Fernsehen die Bilder, hört, was die Menschen dort sagen, was Lukaschenko sagt – es ist fast eins zu eins das, was wir auch im Boris erleben. Ich muss das in meiner Inszenierung nicht aktualisieren, denn die Worte und die Situationen sprechen für sich selbst. Zeitlosigkeit ist immer ein Zeichen von grosser Kunst. Das sehen wir bei Shakespeare, Euripides, Tschechow, den guten Brecht-Stücken, bei Mozart, Verdi, Wagner oder Janáček.
Mussrgski geht mit dem letzten Bild der langen Fassung, der Szene bei Kromy, noch einen Schritt weiter, indem er eine Art Apokalypse beschreibt – eine Szene, die bei Puschkin nicht vorkommt. Ein ausgelassener Mob tobt, die Mönche Missail und Warlaam werden zu apokalyptischen Wanderpredigern: Die Welt sei «ins Wanken geraten».
Das Bild von Kromy ist eine dystopische Beschreibung einer Gesellschaft, die komplett auseinanderbricht. Eine verkehrte Welt, eine Welt der Selbstjustiz, der sinnlosen Gewalt und des Chaos. Dass nach der atemberaubenden Todesszene von Boris überhaupt noch etwas kommen kann, ist eigentlich unvorstellbar. Aber in Kromy kollidiert alles auf einer höheren Ebene. Am Ende singt dann der Narr. Eine fast vierstündige Oper über Boris Godunow und über ein Kapitel russischer Geschichte – und wer hat das letzte Wort? Der Narr. Einfach genial.
Welche persönliche Bedeutung hat Boris Godunow für dich?
Mein Grossvater kam aus Weissrussland. Von ihm habe ich als Teenager alte russische Schallplatten geerbt, darunter war auch die berühmte Aufnahme mit Schaljapin als Boris aus den 1920er-Jahren. Man kann sich heute kaum vorstellen, welcher Star Schaljapin damals war und welch ein hervorragender Darsteller! Schaljapin hat sogar Filme gedreht, russische Schauspieldirektoren wollten ihn für ihre Stücke engagieren. Seine Deklamation war unerreicht. Er hat sich nicht davor gefürchtet, ungewöhnliche oder unmusikalische Töne zu produzieren. Die Halluzinationen, wenn Boris das tote Kind vor sich sieht, die Todesszene, die Schaljapin so grandios gesungen hat, haben mich damals absolut verzaubert. Durch diese Stimme habe ich Mussorgski, ja die Oper insgesamt, kennen- und liebengelernt. Meine ungarische Grossmutter hat Schaljapin übrigens noch selbst auf der Bühne in Budapest erlebt!
Was schätzt du an Michael Volle, der jetzt den Zürcher-Boris singt?
Es war mein Wunsch, Michael dafür anzufragen. Ich musste ihn dazu richtiggehend überreden, denn sein Einwand war natürlich sofort, dass Boris eine Rolle für einen Bass sei und also nicht für seine Stimmlage. Doch das ist ein Missverständnis. Mussorgski schrieb die Rolle ursprünglich für einen Bariton oder Bassbariton, denn bei der Uraufführung wurde Boris von Iwan Melnikow verkörpert, der auch Graf Tomski in Tschaikowskys Pique Dame sang – eine Baritonpartie. Mussorgskis Intention war wahrscheinlich, Boris’ Stimme irgendwo zwischen Pimen, der die eigentlich grosse Bassrolle in diesem Stück ist und Warlaam, anzusiedeln. Wären alle drei Bässe, würde es eindimensional. Für mich bringt Michael etwas auf die Bühne, was kein Bassist, der normalerweise Philipp II. aus Don Carlos singt, erfüllen kann: Michael hat einen Wotan, einen Hans Sachs und einen Fliegenden Holländer in seiner Seele. Das ist eine Dimension, die man nicht inszenieren kann.
Das Gespräch führte Kathrin Brunner.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Fragebogen

Aus welcher Welt kommen Sie gerade?
Wie die meisten von uns aus einer merkwürdigen, aber nützlichen langen Pause. Zuletzt dirigierte ich am 16. März eine Generalprobe für eine halbszenische Elektra in Südengland, die wegen Covid-19 leider nicht mehr zur Aufführung kam.
Worauf freuen Sie sich in der Neuproduktion Boris Godunow?
Boris Godunow ist die Oper, die mich seit meiner Studentenzeit begleitet, obwohl ich bisher erst die einaktige Version von 1869 dirigiert habe. Diese Oper ist eine Art Bibel für die russische Musik. Sie reflektiert viele politische und psychologische Prozesse, die bis heute in Russland zu beobachten sind. Es ist faszinierend, ein Werk auf die Bühne zu bringen, das vor über 150 Jahren geschrieben wurde, aber ein Spiegel unserer heutigen Zeit ist.
Welches Bildungserlebnis hat Sie besonders geprägt?
Mein Lehrer in der Ukraine, der Dirigent Roman Kofman, pflegte zu sagen: «Ich weiss nicht, was man als Dirigent tun soll, ich weiss nur, was man nicht tun soll.» Dieser Satz half mir, aus meinen Fehlern zu lernen. Eine wichtige Station war für mich die Assistenz bei Ivan Fischer und seinem Budapest Festival Orchestra. Auch nicht missen möchte ich die kostbaren Momente, als ich aus dem Konservatorium in den Wiener Musikverein schlich, um Proben mit Nikolaus Harnoncourt, Zubin Mehta oder Valeriy Gergiev zu erleben.
Welches Buch würden Sie niemals weggeben?
Wahrscheinlich immer jenes, welches ich aktuell lese. Gerade habe ich mit einem originellen Essay von Kai Kupferschmidt über die Farbe Blau begonnen.
Welche CD hören Sie immer wieder?
Kirill Kondrashins Interpretation der Glocken von Rachmaninow, oder die Mozart- Aufnahmen von Harnoncourt. Aber wenn ich von einer Probe nach Hause komme, höre ich keine CDs. Da brauche ich die Stille.
Welchen überflüssigen Gegenstand in Ihrer Wohnung lieben Sie am meisten?
Ich versuche, keine überflüssigen Objekte in meiner Wohnung in Paris zu haben, denn ich glaube, dass die Dinge, die uns umgeben, einen starken Einfluss auf unsere Seele und unser Leben haben.
Mit welchem Künstler würden Sie gerne essen gehen, und worüber würden Sie reden?
Kürzlich ging ich mit Barrie Kosky essen. Er erzählte mir aus seinem Leben, wir sprachen über Musiktheater – wohl die komplexeste und universellste Form der Kunst überhaupt. In den aktuellen Umständen fühlt es sich so an, als ob wir tatsächlich etwas Neues und Aufregendes kreieren würden.
Nennen Sie drei Gründe, warum das Leben schön ist!
1. Liebe zu anderen Menschen wie zu allem, was uns umgibt.
2. Es gibt so viel zu entdecken, zu sehen, zu hören und mehr über uns selbst zu lernen.
3. Den Moment eines Wunders zu erleben. Wenn man denkt, alles ist verloren oder
verschwunden, ist der Zeitpunkt da, wo alles beginnt.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Boris Godunow
Die Ahnengalerie der Tyrannen
Am 20. September eröffnen wir die neue Spielzeit mit «Boris Godunow» von Modest Mussorgski – einer russischen Oper über Machtintrigen und Gewaltherrschaft. Despotische Regierungsstrukturen haben in Russland eine lange Geschichte. Der Schweizer Slawist und Politologe Ulrich Schmid beleuchtet die Hintergründe dieser Tradition von Boris Godunow bis Wladimir Putin.
Die berühmteste Regieanweisung in der russischen Theatergeschichte lautet: «Das Volk schweigt» Sie steht ganz am Ende von Alexander Puschkins Drama Boris Godunow, als die Menge aufgefordert wird, dem neuen Herrscher zu huldigen. In unüberbietbarer Präzision beschreibt diese Formel das Verhältnis von Machthaber und Untertanen in Russland. Anders als in Westeuropa gab es in Russland keine nachhaltige Entwicklung eines demokratischen Staatsaufbaus mit der Sicherung individueller Menschenrechte. Politische Denker haben sich bereits sehr früh zur Architektur der Macht geäussert. Die erste Staatsideologie wurde von Abt Joseph Sanin von Wolokolamsk im 15. Jahrhundert entworfen. Joseph erkannte zwar die Menschennatur des Monarchen an, die Macht des Zaren war aus seiner Sicht aber göttlich. Für die Ausübung der Herrschaft gab es keine Grenzen. Joseph erlaubte sogar ausdrücklich Intrigen und Täuschungen, um die Orthodoxie im Zarenreich zu schützen. Der im 16. Jahrhundert herrschende Iwan der Schreckliche stützte seine Regentschaft auf diese absolutistische Konzeption. Der Zar war zwar keinem politischen Gremium Rechenschaft schuldig. Umso strenger fiel aber seine Abhängigkeit von der Gnade Gottes aus, die seinen Herrschaftsanspruch begründete. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg legte der Regisseur Sergej Eisenstein mit dem zweiteiligen Film Iwan der Schreckliche eine filmische Parabel auf die Einsamkeit des absoluten Herrschers vor. Jossif Stalin erkannte sich sehr wohl in dieser historischen Allegorie. Am 26. Februar 1947 lud der Diktator den Regisseur und den Hauptdarsteller in den Kreml ein, um ihnen seine Eindrücke über den Film mitzuteilen. Gönnerhaft erklärte Stalin den beiden Künstlern: «Iwan der Schreckliche war sehr grausam. Man darf seine Grausamkeit sehr wohl darstellen, aber man muss auch zeigen, warum solche Grausamkeit notwendig war. Einer von Iwans Fehlern bestand darin, dass er fünf Bojarenfamilien nicht ganz abgeschlachtet hat. Wenn er diese fünf Familien ausgelöscht hätte, dann hätte es die Zeit der Wirren später überhaupt nicht gegeben. Aber Iwan der Schreckliche richtete den einen oder anderen hin, bereute seine Taten später und betete lange. Gott störte ihn beim Regieren. Man hätte noch entschlossener vorgehen
müssen …»
Wahrscheinlich war Stalins historische Spekulation zu optimistisch. Sogar wenn Iwan der Schreckliche ein noch grösseres Blutbad angerichtet hätte, wäre es nach seinem Tod zu einem Machtvakuum gekommen. In der russischen Geschichtsschreibung wird das fünfzehnjährige Interregnum zu Beginn des 17. Jahrhunderts als «Zeit der Wirren» bezeichnet. Die Zeit zwischen dem letzten RurikidenHerrscher und dem ersten RomanowZaren war von Machtgerangel und Fremdherrschaft gekennzeichnet. Zunächst konnte der Emporkömmling Boris Godunow (15521605), der in die Familie Iwans des Schrecklichen eingeheiratet hatte, die Regierungsgeschäfte an sich reissen. Später liess er sich sogar zum Zaren krönen. Seine Herrschaft wurde vom Verdacht überschattet, er habe den rechtmässigen Zarewitsch Dimitri umbringen lassen, um selbst den Thron besteigen zu können. Ob Godunow tatsächlich die Schuld am Tod seines minderjährigen Rivalen trägt, ist historisch nicht gesichert. Allerdings bot allein schon das Gerücht reiche Inspiration für zahlreiche künstlerische Bearbeitungen dieses Stoffes – von Alexander Puschkin bis Alexej Tolstoj und von Friedrich Schiller bis Volker Braun.
Stalins rabiate Handlungsanweisung an Iwan den Schrecklichen half auch in seinem eigenen Fall nicht. Die Zahl der Opfer seiner Säuberungen geht zwar in die Millionen, dennoch konnte er sein Schreckensregime nicht etablieren. Nach Stalins Ableben war nicht klar, wer die Herrschaft übernehmen würde. Der ehemalige Geheimdienstchef Lawrenti Beria, der Stalin an Brutalität nicht nachstand, erhob Anspruch auf die Führung. Allerdings ging sein Plan einer deutschen Wiedervereinigung dem Politbüro zu weit. Beria wurde entmachtet und hingerichtet. An der Spitze von Partei und Staat setzte sich der unwahrscheinliche Kandidat Nikita Chruschtschow durch, der ursprünglich nur an fünfter Stelle der PolitbüroHierarchie gestanden hatte.
Es gibt eine ganze Reihe von Parallelen beim historischen Schicksal der beiden Tyrannen. Sowohl Iwan der Schreckliche als auch Stalin hatten ihre Erstgeborenen auf dem Gewissen: Iwan erschlug den Thronfolger im Streit, Stalin weigerte sich, seinen Sohn aus der deutschen Kriegsgefangenschaft auszulösen. Die Todesumstände beider Tyrannen sind nicht restlos geklärt und haben Anlass zu weitläufigen Verschwörungstheorien gegeben. Schliesslich profitierte in beiden Fällen der Nachfolger vom Kontrast, den die eigene Politik gegenüber der alten Schreckensherrschaft markierte.
Boris Godunow gilt seit Alexander Puschkins Drama als negative Figur in der russischen Geschichte. Das Image des glücklosen Zaren untermauerte der Komponist Mussorgski mit einem weiteren Schlag: In seiner Oper wird Godunow vom Geist des ermordeten Zarewitsch heimgesucht – damit erscheint seine Schuld als erwiesen. Diese Legende verweist auf ein zentrales Problem russischer Herrschaft: Der Zar wurde vom einfachen Volk aufgrund seiner dynastischen Herkunft anerkannt. Sobald diese Kette der Machtübergabe unterbrochen wurde, bröckelte die Legitimation des Herrschers. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts profitierte die polnischlitauische Adelsrepublik von der Schwäche des Zarenreichs und besetzte mit ihrer Armee Moskau. Erst gegen Ende des Jahres 1612 gelang es der russischen Landwehr, die Polen zu vertreiben. Seit 2005 erinnert der «Tag der Einheit des Volkes», der immer am 4. November gefeiert wird, an dieses historische Ereignis. Präsident Putin war auf der Suche nach einem Ersatz für den diskreditierten Feiertag der Oktoberrevolution und schwor seine Nation auf den Sieg über die polnische Besatzungsmacht ein. Dieses Ereignis markierte auch das Ende der «Zeit der Wirren», die bis heute als Schreckgespenst durch die Regierungshallen des Kremls geistert. Wie wichtig die dynastische Kontinuität für die Herrschaftssicherung war, zeigen frühe Urkunden des ersten RomanowZaren Michail, der sich nach der Thronbestei gung im Jahr 1613 als «Enkel» des Rurikiden Iwans des Schrecklichen bezeichnete. Die Herrschaft der Romanows, die auf die «Zeit der Wirren» folgte, sollte mehr als 300 Jahre dauern – bis zur Februarrevolution 1917. Legitimitätskrisen gab es in dieser langen Zeit relativ selten, aber sie kamen vor. So gelangte Katharina die Grosse aufgrund einer Palastrevolte im Jahr 1762 an die Macht – ihr Ehemann, Zar Peter III., kam dabei unter ungeklärten Umständen ums Leben. Ebenfalls einem Putsch fiel Paul im Jahr 1801 zum Opfer. Sein Sohn, der spätere Zar Alexander I., gab sein Einverständnis für das Erzwingen der Abdankung und fragte, ob denn auch Gewalt angewendet werden solle. Der Anführer der Verschwörer beschied ihm darauf vieldeutig, dass man Eier zerschlagen müsse, wenn man ein Omelette machen wolle. Eine Ironie des Schicksals wollte es, dass auch nach dem Tod Alexanders I. im Jahr 1825 eine Zäsur in der Fortführung der Zarenherrschaft entstand. Eine Reihe junger Adliger setzte sich für eine republikanische Revolution ein. Allerdings scheiterte der sogenannte Dekabristenaufstand jämmerlich. Die Aufständischen marschierten auf dem Senatsplatz der Hauptstadt St. Petersburg auf und blieben dort stehen, bis sie von regierungstreuen Truppen verhaftet wurden. Das umstehende Volk verstand nicht einmal, was mit der geforderten Verfassung (russ:«konstituzija») gemeint war und feierte in seinen Hochrufen den regulären Thronfolger Konstantin und «seine Frau Konstituzija». Allerdings war nicht nur das Herrschaftsverständnis des einfachen Volkes mangelhaft ausgebildet. Dasselbe gilt auch für die anachronistische Auffassung des Gottesgnadentums bei den Zaren. Noch kurz vor seiner Abdankung beschied Nikolaus II. dem britischen Botschafter, der ihn auf seine schwindende Popularität ansprach: «Meinen Sie nun, dass ich das Vertrauen meines Volks zurückgewinnen muss, oder meinen Sie nicht vielmehr, dass mein Volk mein Vertrauen zurückgewinnen muss? » Schon nach der ersten russischen Revolution von 1905 hatte Nikolaus II. seinem Volk nur widerwillig ein «Grundgesetz» zugestanden, in dem die Einrichtung eines Parlaments angekündigt wurde. Allerdings nutzte Nikolaus später jede Gelegenheit, um die Duma aufzulösen. In diesem Sinne war der letzte Zar der beste Komplize Lenins, für den die Devise «Je schlechter, desto besser» galt: Je schlechter die Bürger in das politische System eingebunden waren, desto besser standen die Chancen für einen radikalen Machtumsturz. Die «Oktoberrevolution», die später von den Sowjets mit tatkräftiger Hilfe des Regisseurs Eisenstein als Aufstand der empörten Massen gegen eine ungerechte Regierung gefeiert wurde, war jedoch in Tat und Wahrheit ein Staatsstreich.
Das Verhältnis von Herrschaft und Volk wurde während der Sowjetzeit nicht von der politischen Realität, sondern von der marxistischen Ideologie definiert. Das sowjetische Verständnis von «Demokratie» unterscheidet sich radikal von der aufklärerischen Tradition. Schon bei Marx ist die Demokratie gerade kein Garant für die Ausübung politischer Bürgerrechte, sondern umgekehrt ein Unterdrückungsinstrument in den Händen der kapitalistischen Ausbeuter. Bei allen Sowjetführern lässt sich der verzweifelte Versuch beobachten, dem Westen die angebliche Überlegenheit des eigenen Systems vor Augen zu führen. Besonders deutlich lässt sich das am raschen Wechsel der sowjetischen Verfassungen der Jahre 1918, 1924, 1936 und 1977 ablesen. Die erste Verfassung von 1918 wird in klarer Analogie zur französischen Deklaration der Menschenrechte von 1789 durch eine «Erklärung der Rechte der Werktätigen und Ausgebeuteten» eröffnet. Als Staatsform etabliert sie explizit eine «Diktatur des Proletariats», die kommissarisch von der Kommunistischen Partei ausgeübt wird. Ihr politisches Mandat bezogen die bolschewistischen Herrscher gerade nicht aus einer demokratischen Wahl, sondern aus den ehernen Gesetzen der marxistischen Geschichtsphilosophie. Im berühmten «Kurzen Lehrgang», an dem Stalin höchstpersönlich in den dreissiger Jahren mitgeschrieben hat, kann man diesen umfassenden Wahrheitsanspruch nachlesen: «Die Kraft der marxistischleninistischen Theorie besteht darin, dass sie der Partei die Möglichkeit gibt, sich in der jeweiligen Situation zu orientieren, den inneren Zusammenhang der um sie herum geschehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der Ereignisse vorauszusehen, und nicht nur zu erkennen, wie und wohin sich die Ereignisse gegenwärtig entwickeln, sondern auch, wie und wohin sie sich künftig entwickeln müssen. » Dieses überbordende Selbstbewusstsein wurde in der StalinVerfassung von 1936 kodifiziert. Sie schützte das Eigentum und sah auch ein Erbrecht vor. Auch die Rede, Presse und Versammlungsfreiheit war auf dem Papier garantiert, allerdings mit dem entscheidenden Zusatz «in Übereinstimmung mit den Interessen der Werktätigen und zur Festigung der sozialistischen Ordnung». Sogar ein Recht auf Erholung wurde verbrieft. In der BreschnewVerfassung von 1977 kommt das Wort «Demokratie» konsequenterweise nicht in Reinform vor. Entweder ist von «wahrer Demokratie» oder von «demokratischem Zentralismus» die Rede. In beiden Fällen verweisen die Formulierungen auf den Anspruch der Partei, den Willen des Volkes besser als das Volk selbst verstehen und umsetzen zu können.
Die jahrzehntelange Gängelung der Sowjetbürger zog ein «schweigendes Volk» in Puschkins Sinne heran. Die neunziger Jahre waren von einem erbitterten Kampf um die Staatsmacht geprägt. Boris Jelzin, der Held bei der Abwehr des Moskauer AugustPutsches von 1991, entwickelte sich zu einem aufgedunsenen Alkoholiker, der auf Pressekonferenzen auch schon mal Deutschland und Japan als Atommächte bezeichnete und sich am Schluss kaum mehr selbst auf den Beinen halten konnte. Seine Wiederwahl als Präsident im Jahr 1996 kam nur aufgrund von ausgeklügelten «Polittechnologien» zustande, weil man um jeden Preis seinen kommunistischen Rivalen ausschalten wollte. Der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny unterstützte damals die Beeinflussung der Öffentlichkeit zugunsten von Jelzin. Im Rückblick beurteilt er sein Verhalten jedoch selbstkritisch: Nawalny glaubt heute, dass ein kommunistischer Präsident in einer überschaubaren Amtszeit von vier Jahren wenig Schaden hätte anrichten können. Viel schlimmer sei die nachhaltige Diskreditierung der demokratischen Institutionen, von der das System Putin bis heute profitiere.
Wladimir Putin wurde 1999 von Boris Jelzin selbst auf den Schild gehoben. Seither regiert Putin aus offiziellen und inoffiziellen Positionen das Land mit eiserner Hand. Lange Zeit genoss er hohe Zustimmungsraten, die nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 sogar durch die Decke schossen. Bis vor kurzem beruhte der Gesellschaftsvertrag in Russland auf der Losung: «Enrichissezvous, mais ne vous indignez pas!» (Bereichern Sie sich, ohne sich zu beschweren!) Soziologische Langzeituntersuchungen zeigen, dass in der gesamten Ära Putin jeweils nur gerade zwei bis fünf Prozent der Befragten glauben, einen Einfluss auf die Situation im Land zu haben. Mittlerweile ist der Führung im Kreml ebenfalls klar, dass ihr sorgfältig konstruiertes Modell der «gelenkten Demokratie» nicht nachhaltig funktioniert. Die Verfassungsreform, über die am 1. Juli 2020 abgestimmt wurde, will deshalb in Russland ein «einheitliches System der öffentlichen Herrschaft» etablieren. Der Deal besteht darin, dass die politische Teilhabe der russischen Staatsbürger auf das Vertragsverhältnis einer Sozialversicherung reduziert wird: Die Verfassung garantiert neu einen Mindestlohn und indexiert die Renten. Dafür wird alle politische Macht an ein straff zentralisiertes Verwaltungssystem delegiert. Eine Ironie des Schicksals will es, dass die Kampagne für die Verfassungsreform ausgerechnet mit Alexander Puschkins Kopf warb: Das russische Volk schwieg sich mit fast 78 Prozent Zustimmung für die Beibehaltung des Systems Putin aus.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.
Sound-Übertragung von nebenan

Bühne hier, Orchester da. So spielen wir.
Unser Orchester und Chor werden derzeit aus einem externen Proberaum live in die Vorstellungen eingespielt. Dank diesem weltweit einzigartigen Spielmodell heisst es trotz Abstandsregeln: Vorhang auf für grosses Musiktheater! Erfahren Sie, wie unsere «Sound-Übertragung von nebenan» funktioniert und wie Sie mit Ihrer Spende in Ihren Musikgenuss investieren können. mehr
Auf der Couch
Wäre ich doch ein Anderer
Wer die Ahnengalerien stolzer Adelsgeschlechter betrachtet, wird entdecken, dass Hochstapelei zum feudalen Lebensgefühl gehört. Stammbäume reichen in dunkle Zeiten zurück und greifen dort nach Ahnen wie Karl dem Grossen oder Iulius Caesar, gar nach König Salomo und der Königin von Saba. In Ägypten begründete die Abstammung von einem Gott die Macht des Pharao; in der griechischen und römischen Adelsgesellschaft führten Stammbäume auf Götter und Heroen zurück. Gaius Iulius Caesar beispielsweise gehörte zum Geschlecht der Iulier. Iulius war der Sohn von Aeneas. Dieser, ein Sohn der Liebesgöttin Venus, war der Legende nach aus Troja geflohen und hatte die Stadt Rom gegründet. Also war auch Caesar «göttlichen Blutes» und ein geborener Herrscher. Kaiser und Zaren haben ihre Titel von Caesar übernommen, der den Dolchen von Verschwörern zum Opfer fiel und bald danach als Gott verehrt wurde.
Wer von uns bekommt schon die Anerkennung, die er nach seinem eigenen besten Wissen und Gewissen verdient? Wo sich in diesem Punkt die Realität spröde zeigt und die eigenen Grössenwünsche wenig unterstützt, bieten Tagträume eine unerschöpfliche Quelle von Macht und Ruhm. Ich erinnere mich mit wehmütiger Scham an eine Zeit, in der ich als pubertierender Gymnasiast mein Rad nach Hause schob, weil ich alle Konzentration dafür brauchte, mir eigene Heldengeschichten auszumalen: Ich war ein unverwundbarer Ritter (bitte kein Lindenblatt beim Drachenblutbad), mein Schwert das schärfste von allen. Oder ich ritt mit Winnetou und Old Shatterhand über die Prärie und befreite die beiden aus grosser Gefahr, denn ich hatte eine kleine Pistole, aus der ich notfalls auch Atombomben verschiessen konnte.
In der Psychoanalyse werden solche Tagträume mit dem so genannten Familienroman verknüpft. Das sind kindliche Phantasien, in denen die in ihrer Belanglosigkeit den eigenen Grössenwunsch kränkenden Eltern durch würdigere Bilder ersetzt werden. Der Freudschüler Otto Rank hat in Der Mythus von der Geburt des Helden Sagen über die babylonischen Könige Gilgamesh und Sargon, den Perserkönig Cyrus, Ödipus, Herakles und Perseus, die römischen Könige Romulus und Remus, den keltischen Tristan, Siegfried und Lohengrin untersucht. Er fand typische Muster: Es gibt ein Paar von hohem Rang und einen Traum oder ein Orakel, das die Geburt eines Sohnes ankündigt, der gleichzeitig auch eine Gefahr für den Vater sei. Im Kindesalter wird der Held ausgesetzt. Er würde ohne Hilfe sterben, wird aber gerettet – von Tieren oder Menschen von geringem Stand. Erwachsen, entdeckt er seine wirklichen Eltern, rächt sich und gewinnt Ruhm und Würde.
Tiere oder Taglöhner, die den Helden aufziehen, symbolisieren die realen Eltern; Könige oder Götter die idealen Eltern, die sich das Kind herbeiträumt. Sobald die Geheimnisse der Sexualität dem kindlichen Forschen nicht mehr widerstehen, orientieren sich Fantasien an der Tatsache, dass die Mutter ganz eindeutig ist, der Vater aber stets von Unsicherheit umgeben. Nach 1945 etwa tauchten in den Analysen Fantasien auf, einem heimlichen Verhältnis der Mutter mit einem untergetauchten Juden zu entstammen – auch ein Weg, der Beschämung durch den Holocaust zu entgehen.
Die Oper Boris Godunow kreist um das zentrale Motiv in unruhigen Zeiten: Wer kann führen? Der Tüchtige oder der durch Abstammung und Geburt Begnadete? Ergänzt wird diese Frage durch eine zweite, die tiefer in die unbewusste Dynamik des ÖdipusKomplexes reicht: Wer ist schuldig? Ist es der Sohn, der dem Vater dessen Rang streitig macht? Ist es der Vater, der den Sohn unterdrückt, gar töten lässt, um seine Macht zu bewahren? Godunow regierte zunächst für den geistesschwachen Fjodor I. und liess sich nach dessen Tod zum Zaren wählen. Seine Gegner schürten den Verdacht, er habe den Zarensohn Dimitri ermorden lassen. Als ein junger Mönch behauptete, eben dieser Dimitri zu sein, unterstützten seine Feinde den «falschen Dimitri». Der selbsternannte Zarensohn wurde später ebenfalls ermordet.
Alexander Puschkin hat in einem Drama die Vorlage für Modest Mussorgskis Oper Boris Godunow geschaffen. Puschkin konzentrierte sich auf die Spannung zwischen dem selbst ermächtigten Zaren und dem ebenfalls selbst ermächtigten Zarensohn. Sie gibt dem Geschehen eine psychologische Tiefe, die dem uralten Motiv der Aussetzung und Erhebung des Helden seine Geradlinigkeit nimmt.
In Märchen, Mythen und Legenden bleibt das Thema des unterschätzten, erniedrigten und dann wie durch ein Wunder erhöhten Helden allgegenwärtig. Von einem hohen Unterhaltungswert zu sprechen, ist nicht falsch, aber banalisiert doch das Ringen des menschlichen Narzissmus mit den Abgründen der Bedeutungslosigkeit. Wer sich aus der Menge erhebt und für alle sichtbar wird, steht für die Ambivalenz einer universalen Sehnsucht. Sein Herausgehobensein ist Erlösung und Gefahr – heute als verschollener Prinz gefeiert, morgen als Betrüger entlarvt oder von Rivalen um die Macht erdolcht.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 77, September 2020.
Das Mag können Sie hier hier abonnieren.