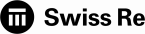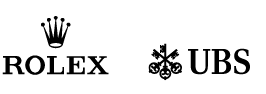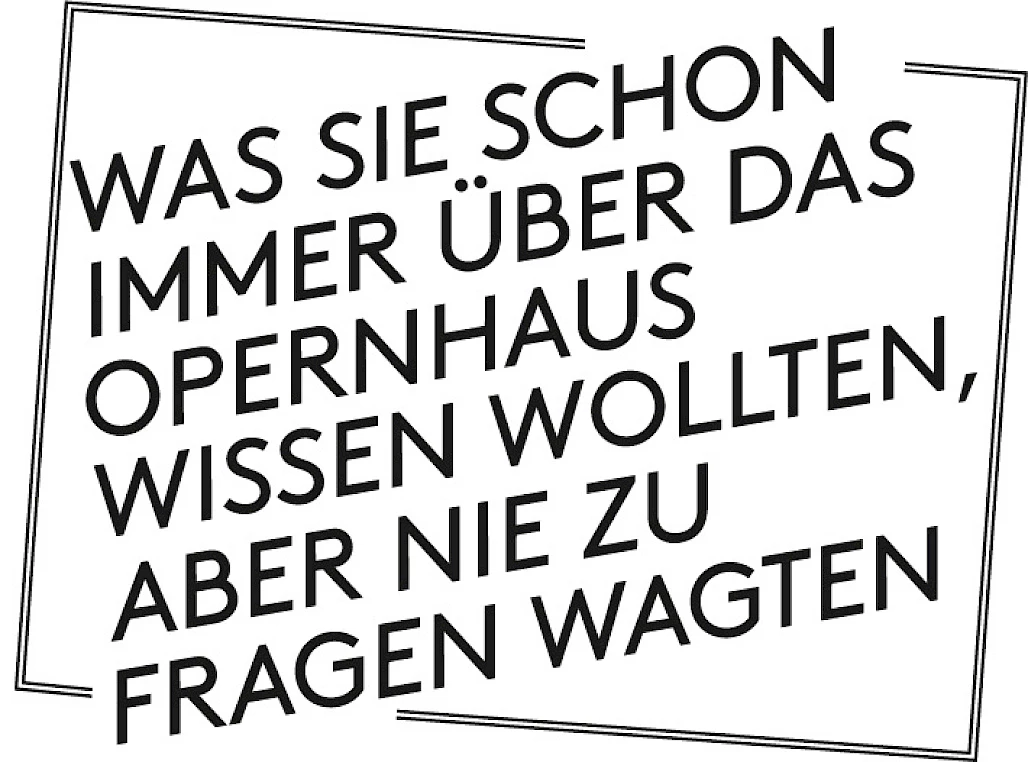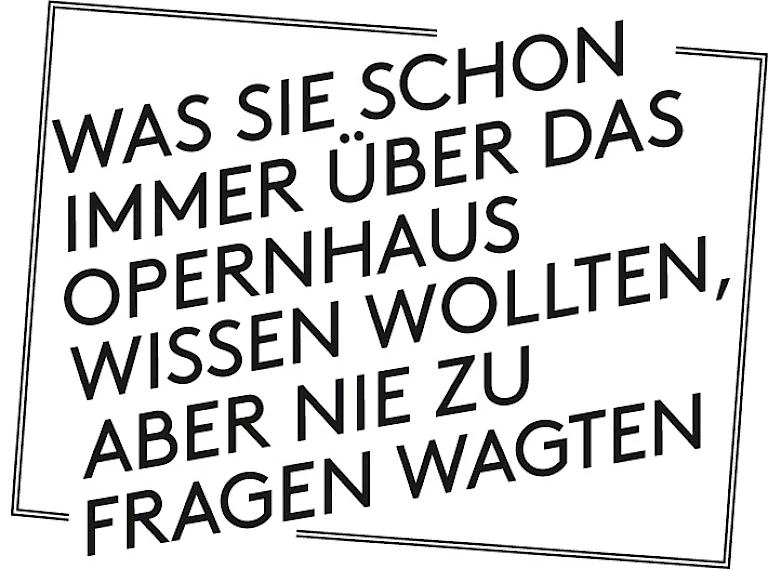
Was Sie schon immer...
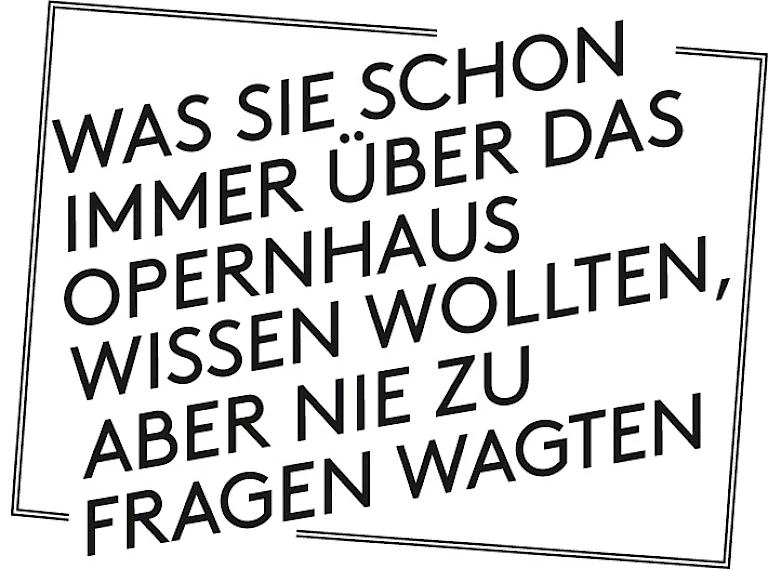
Am Opernhaus, da geschehen unerklärbare Dinge. So glaubt man zumindest. In dieser Filmreihe beschäftigen wir uns genau mit den Fragen, die man sich stellt, wenn man im Zuschauerraum sitzt und den Zauber von Oper, Ballett und Konzert auf sich wirken lässt. Denn so einiges ist dann plötzlich erklärbar. Anderes aber auch nicht… Doch sehen Sie selbst!

Alles auf einmal
Auch die schönste Kurzfilmreihe geht eines Tages zu Ende. Während der letzten 19 Episoden und 6 Spielzeiten haben wir Ihnen alles erklärt, was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Episode 20 blickt zurück und schliesst die Serie gebührend ab.

Ganz einfach: Stimmfach
Was hat es eigentlich mit all diesen lyrischen Tenören und dramatischen Sopranen auf sich? Der neueste Film der Reihe «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» bringt Licht ins Dunkel.
Der Inspizient
Felix Bierich ist seit 20 Jahren Inspizient am Opernhaus Zürich. Das bedeutet: Bei ihm laufen während einer Vorstellung alle Fäden zusammen, er ist verantwortlich für den reibungslosen Ablauf all dessen, was auf der Bühne passiert. Das erfordert gute Nerven. Die hat Felix Bierich zuletzt bei komplizierten Produktionen wie dem «Ring des Nibelungen» und «Amerika» bewiesen.
Seine Stimme habe ich sicher schon oft gehört, in der Cafeteria des Opernhauses, über die Gespräche und das Tassenklirren hinweg aus dem Lautsprecher kommend, den Chor zum Einsatz bittend, oder die Musiker, freundlich und unerbittlich und minutengenau zur Arbeit aufrufend. Aber anders als sie verband ich niemanden mit dieser Stimme. Irgendwer muss diese Ansagen ja machen… Naja, es ist nicht irgendwer. Es ist der, bei dem sämtliche Fäden einer Produktion zusammenlaufen, während er in einer Ecke hinter der Bühne an einem Pult mit Monitoren und Knöpfen steht, mit Headset und Klavierauszug versehen, und nicht nur minutengenau, sondern auf Sekunden und auf Millimeter genau die Koordination sichert, auch und gerade dann, wenn das Schiff auf hoher See ist, in der Vorstellung. Der Inspizient.
Aber jetzt sitzt Felix Bierich gerade gemütlich in der Wohnküche seiner Familie und gibt mir Nachhilfe per Fernstudium. Mit Zoom umgehen wir den aktuellen Bahnstreik, und Herrn Bierich merkt man an, wieviel er in seinem Job ohnehin über Mikro und mit Technik kommuniziert. Er ist ganz da und sehr entspannt. Pullover, Bart, Lachfältchen, klare baritonale Stimme. Er hat, wie sich erweisen wird, als Schauspieler begonnen, aber den Job in Zürich macht er seit 20 Jahren, einer von fünf Inspizient:innen des Hauses. Das Wort ist dem «Inspektor» nicht fern und klingt nach einem, der die Einhaltung von Regeln beaufsichtigt – was er im Theater des 18. Jahrhunderts auch tat. «Das englische ‹stage manager› trifft es ein bisschen besser», meint er, «man ist Pilot des Abends».
Nur ist dieser Pilot für Aussenstehende «möglichst nicht wahrnehmbar», auffallen würde er nämlich erst, wenn etwas schiefgeht. Und wenn Felix Bierich erzählt, was beim anstehenden Rheingold die «challenge» ist – er teilt sich den kompletten Ring mit einer Kollegin, die die mittleren beiden Abende übernimmt –, sieht man ein reiches Potential für Pannen vor sich. «Rheingold hat etwa 30 Fahrten mit der Scheibe. Da sind vier Viertel als Räume auf der Scheibe aufgeteilt, es gibt zwei komplette Ausstattungen für das Wohnzimmer in Walhall, dazwischen ist möglicherweise mal das Bild mit dem Stuhl, das dreht nach links raus, von rechts kommt aber schon wieder das Mobiliar angefahren, und das zweite Wohnzimmer wird hinten in kurzer Frist von der Bühne gewuchtet, weil da schon wieder Nibelheim aufgebaut wird…»
Die Bewegung der Drehscheibe ist vom Tempo des Dirigenten abhängig, den der Inspizient auf einem Monitor sieht, «manchmal kann es plötzlich viel schneller oder langsamer sein», und so sagt Bierich dem steuernden Maschinisten neben sich «plus» oder «minus», während er zugleich per Knopfdruck Zeichen für die Auftritte gibt: Pünktlich müssen die Sängerinnen und Sänger in die Räume gestellt werden. Per Funk sorgt er dafür, dass auf der Bühne im richtigen Moment eine Tür auf- und zugemacht wird. Immer wieder schaut er in seinen mit Anmerkungen übersäten Klavierauszug. «Es wird nervenaufreibend, wenn man bei Wagner nicht am Notentext bleibt.» Und zwischen all den Einzelaktionen muss er noch ein Gespür für den «Flow» des Ganzen entwickeln, «dass man merkt, wo geht das hin? Das Feingefühl für das Timing innerhalb des Stückes hängt unmittelbar mit Stimmung und Puls des Dirigenten zusammen und mit den Sängerinnen und Sängern, wie die drauf sind.»
Mir schwirrt schon der Kopf, und dabei erzählt Felix Bierich wirklich entspannt von all den «Vorgängen», die er da koordinieren muss. Er hat jetzt etwas Ruhe nach dem «Rausch», wie er das nennt, der letzten Wochen und Monate, als er nacheinander die Wiederaufnahmen des Tanzstücks Nachtträume, des Musicals Sweeney Todd, der Italienerin in Algier und schliesslich die Pioniertat Amerika auf Kurs hielt. Ehe ich ihn fragen kann, wie er mit dem Stress umgeht, sagt er selbst, «irgendwann dachte ich, es ist immer irgendwie aufregend, ob mir das nicht irgendwann aufs Herz schlägt? Aber zugleich wurde die Routine grösser.» Und eine besondere Gabe hat er schon am Anfang seiner Inspizientenlaufbahn entdeckt: «Dass ich ruhiger werde, wenn die anderen nervöser werden.»
Zur Bühne hat es Felix Bierich aber noch früher gezogen. 1964 in Hamburg geboren als Sohn eines Kinderarztes und einer Sportgymnastik-Trainerin, die nach Tübingen zogen, als er vier Jahre alt war, wollte Felix mit sechzehn Jahren Tanz studieren und wusste, «wenn das nicht klappt, werde ich Schauspieler». Den Tanzaspiranten lehnte die Kölner Hochschule ab, der Theaterhungrige fand – nach Abitur, Bundeswehr und nachträglicher Kriegsdienstverweigerung – einen Platz an der Schauspielschule in Saarbrücken, lernte dort umgehend seine Frau kennen, und mit einem Umweg über die Frankfurter Off-Szene landeten die beiden 1990 im thüringischen Altenburg, noch vor dem offiziellen Ende der DDR, und machten dort Theater mit Kindern und Jugendlichen.
«Mir kam dann die Idee mit der Regie, und ich habe in Bayreuth angeklopft», sagt Felix Bierich, der mit acht Jahren Klavierunterricht bekommen hatte und keine Sorge haben musste, «in der Prügelfuge der Meistersinger rauszufliegen». Tatsächlich durfte er dem 77-jährigen Wolfgang Wagner beim Inszenieren dieses Stücks assistieren, «mit seiner Tochter Katharina, die noch in der Schule war». 1997 wurde er Hospitant von Harry Kupfer, dem Intendanten der Komischen Oper Berlin. «Da fragte der Inspizient, ob Kupfer nicht einen von seinen sieben Hospitanten abstellen könnte als Helfer für Pique Dame.» Für Tschaikowskis Dreiakter gab es einen gigantischen Spieltisch, «mit fünf Elementen, bis zu acht Meter lang, die man rausfahren konnte, und diese Fahrten konnte der Inspizient nicht immer selbst steuern... Das habe ich gemacht und dabei gelernt, was ein Inspizient an Timing draufhaben muss, und war schon angefressen, als er fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das als Beruf zu machen…»
Ein Traumberuf ist es natürlich nicht dauernd. «Mit manchen Künstlerinnen und Künstlern arbeitet man gern und freut sich, wenn sie wiederkommen, bei manchen freut man sich, dass das Projekt beendet ist… Es muss reichen, wenn ich das schaffe, was als Aufgabe an mich gestellt ist, dass alle zufrieden sind. Es gibt Künstler, die mit wenigen Mitteln erstaunliche Dinge hinkriegen, und andere erreichen mit grossem Trara nicht den kleinsten Effekt.» Bei der jüngsten Produktion Amerika freut es ihn besonders, «dass sie diesen Flow gekriegt hat», denn durch die teils grafische Notation und die Bandzuspielungen war die Koordination dieser Oper von Roman Haubenstock-Ramati eine enorme Herausforderung. Ein «Höllenritt» sei aber Sweeney Todd, «da habe ich 120 Fahrten mit vier Podesten, und dreimal kippt dieser Stuhl», also der Frisierstuhl, aus dem die Opfer des blutrünstigen Barbiers in die Tiefe rutschen, «und es muss so angeordnet sein, dass keiner tief auf die Unterbühne stürzt… das treibt den Puls hoch!» Er lacht, und Snowy bellt, der kleine weisse Hund, der bis dahin brav dem Interview gelauscht hat.
So viel Aufwand für Illusionen, während fürs Kino ganze Katastrophen am Bildschirm entstehen, ohne dass auch nur ein echtes Steinchen aus der Wand fällt! «Unser Sohn macht diese Katastrophen. Er wird 22 und studiert in Luzern Filmanimation. Er ist wohl doch angefressen vom Theatralischen.» Und nicht nur er. Die älteste Tochter von Felix und Sabine Bierich arbeitet selbst schon als Inspizientin in Zürich, und die jüngere studiert Musiktheaterregie in Hamburg.
«Ich denke, dass es immer noch etwas hat, die Bühnenluft, das unmittelbare Erleben, bei dem auch was schiefgehen kann.» Besonders die Sängerinnen und Sänger sind ihm dabei nahe. «Bevor sie auf die Bühne gehen, sind sie in einer besonderen Lage. Sie bringen die Potenz der nächsten Szene mit sich, sie sind wie auf einer Abschussrampe, und ich bin mit der letzte, der ihnen davor begegnet. Manchmal kann man da noch Mut machen. Oder nur bestätigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind.» Und damit sie schon in der Garderobe gute Laune haben, erfolgt der Bühnenruf des Inspizienten, soweit er das hinkriegt, in der Muttersprache der Solisten: «Signora Bartoli sul palcoscenico, per favore!»
Das Gespräch führte Volker Hagedorn.
Dieser Artikel ist in der Reihe «Volker Hagedorn trifft...» erschienen in MAG 110, April 2024.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
Foto von Peter Hauser.

Und morgen sind wir Stars!
Lernen Sie im 18. Kurzfilm aus der Reihe «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» Nachwuchstalente aus dem Opernstudio, dem Junior Ballett und der Orchesterakademie kennen.

Do it Yourself
Wir lieben extravagante Kostüme auf der Bühne, aber wo kommen die eigentlich her? Kaufen wir die ein? Oder sind das alles Originalteile? Die geschickten Hände dreier Frauen klären auf. Episode 17 unserer Kurzfilmreihe: Do it Yourself!
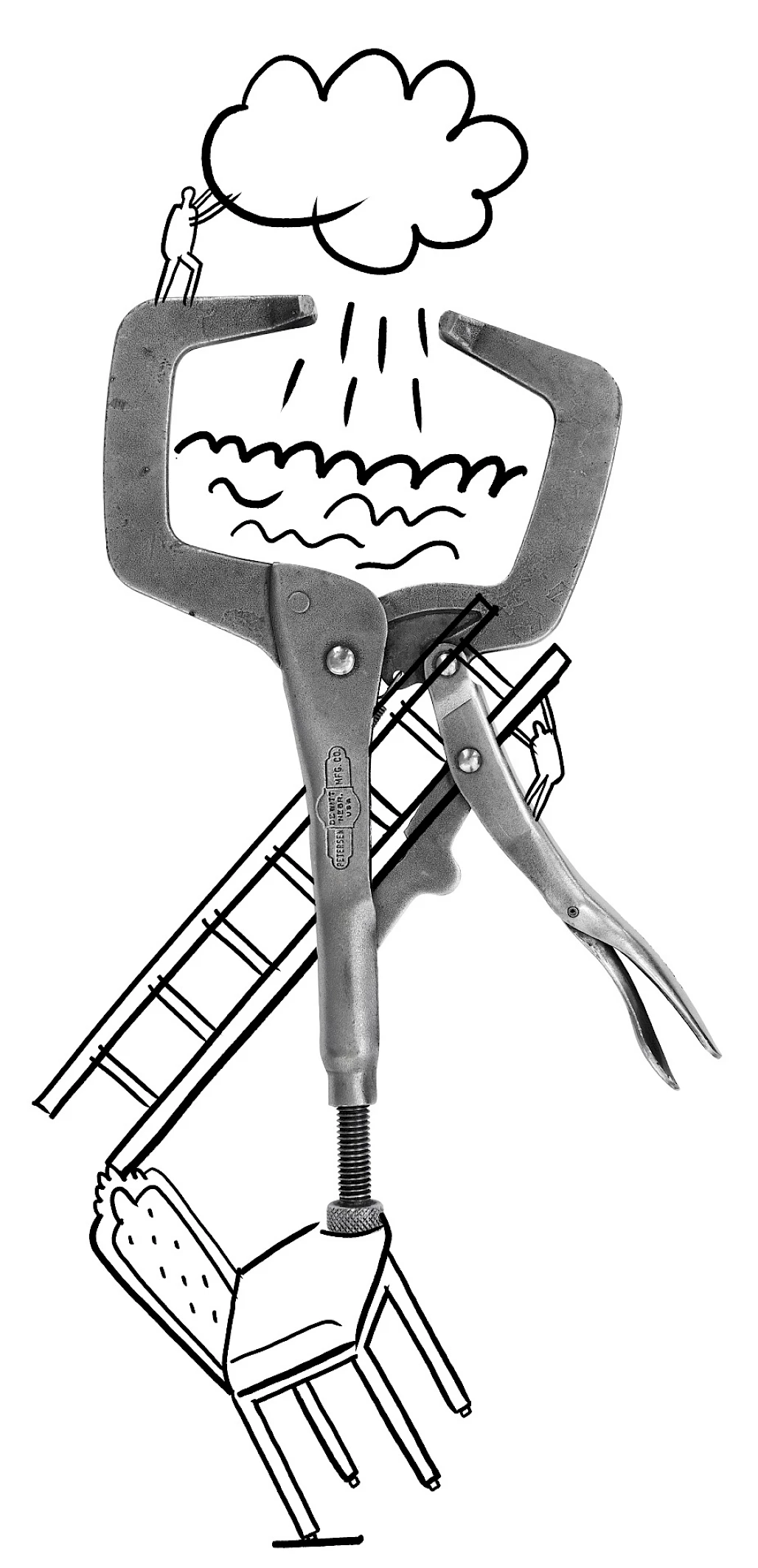
Projizieren statt bauen?
Immer wieder kommt die Frage auf, ob man Bühnenbilder heute nicht einfach projizieren kann, anstatt sie aufwändig zu bauen. Nur noch eine Leinwand auf die Bühne stellen und die Dekoration mit den Mitteln moderner Videotechnik zeigen – das würde doch viel Geld und Material sparen, wird manchmal behauptet. Heute sei die Technik doch so weit, dass virtuell hergestellte Welten von den realen nicht mehr zu unterscheiden seien. Tatsächlich ist es heute viel schwieriger als noch vor 25 Jahren, dem Publikum eine Kulisse als «echt» zu verkaufen.
Früher konnten die Theatermaler beispielsweise einen Wald auf ein Stück Stoff malen, der hinter die Sängerinnen und Sängern gehängt wurde – und schon hat das Publikum geglaubt, die Szene spiele «im Wald». Versuchen wir das heute, fallen uns als erstes die vielen Falten im Stoff auf. Unsere Sehgewohnheiten haben sich geändert. Durch Kino und Fernsehen haben wir uns an kristallklare Bilder gewöhnt. Wir finden es selbstverständlich, jedes Detail, jede Sommersprosse im Gesicht einer Filmheldin tiefenscharf betrachten zu können. Die Zeiten, in denen wir an den Antennen unserer Fernseher gewackelt haben, um weniger Schnee im Bild zu sehen, sind lange vorbei. Deshalb wollen wir heute auch die Darstellenden auf der Opernbühne sehr genau sehen können. Das viele Licht, das dazu nötig ist, «reisst alles auf», wie wir im Theaterjargon sagen, das heisst, es erhellt mehr, als uns eigentlich lieb ist: Wir nehmen die Stofffalten wahr und nicht den Wald.
Arbeiten wir mit VideoProjektionen, gibt es andere Probleme: Es ist sehr schwierig, ein Liebespaar hell auszuleuchten, ohne dass Licht auf die Projektionsflächen fällt und diese verblassen lässt. Projizieren kann man übrigens immer nur von «hinten», denn jede Projektion von vorne sieht man auch auf den Körpern der Darstellenden, die dann Schatten auf die Leinwand werfen. Vollends enden die Möglichkeiten von Videoprojektion, wenn die Darstellenden in und mit dem Bühnenbild spielen sollen. Das Bühnenbild unserer Eröffnungsproduktion La rondine zum Beispiel hat sehr schön gestaltete Seitenwände und eine Rückwand mit Fenstern, durch die «Sonnenlicht» auf den Holzboden fällt. In der Inszenierung von Christof Loy wird facettenreich in dem Raum gespielt, Dinge werden angefasst, es gibt Auftritte durch die Türen oder einen grossen Vorhang. In projizierten Kulissen ist das unmöglich. In unserer Götterdämmerung, die Anfang November Premiere hat, gibt es zwar keinen Drachen (Sie erinnern sich: Den hat Siegfried leider getötet), aber es gibt Baumstümpfe, Felsen, Möbel und natürlich sehr reale Räume. Das Publikum wird auch wegen des Klangs für sie dankbar sein: Hohe Holzwände sind für die Akustik viel besser geeignet als dünne Projektionsfolien. Und einen Schurken gegen die Wand schleudern, kann man auch nicht, wenn diese eine Folie ist. Auch das Argument, Projektionen seien günstig, stimmt nicht: Bis die Programmierung der virtuellen Bilder so perfekt ist, wie man das möchte, investieren Spezialist:innen hunderte von Stunden.
Aus all diesen Gründen bauen wir nach wie vor reale Bühnenbilder. Vielleicht wünscht sich die Choreografin eine zweite Etage als Spielebene wie im Ballett Snowblind von Cathy Marston, das demnächst Premiere hat, oder die Operettenhandlung soll auf einem Schiff spielen wie in unserer Csárdásfürstin, die im kommenden März wieder auf die Bühne kommt. Wegzudenken sind Videoprojektionen aus den meisten unserer Vorstellungen kaum mehr. Sie liefern grossartige Effekte, aber sie brauchen die detaillierte und liebevolle Arbeit unserer erfahrenen Theaterwerkstätten als Grundlage.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 105, September 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
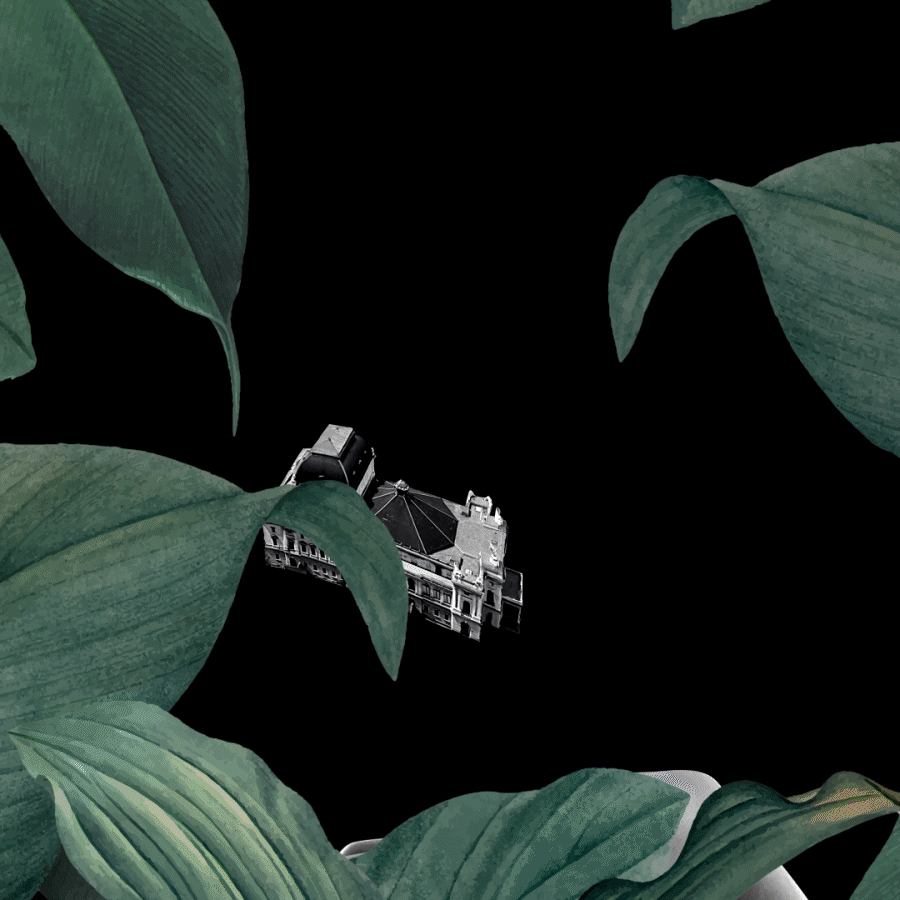
Eine unsichtbare Spezies
Was passiert im Unsichtbaren, wer kümmert sich darum, dass das Zahnrad-Getriebe «Oper» jeden Abend läuft? In unserer Filmreihe «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» schleicht sich das Kamera-Team hinter die Bühnenfassade. Gefunden haben sie eine ganz besondere Spezies. Seien Sie bereit für eine Expedition wie keine andere.
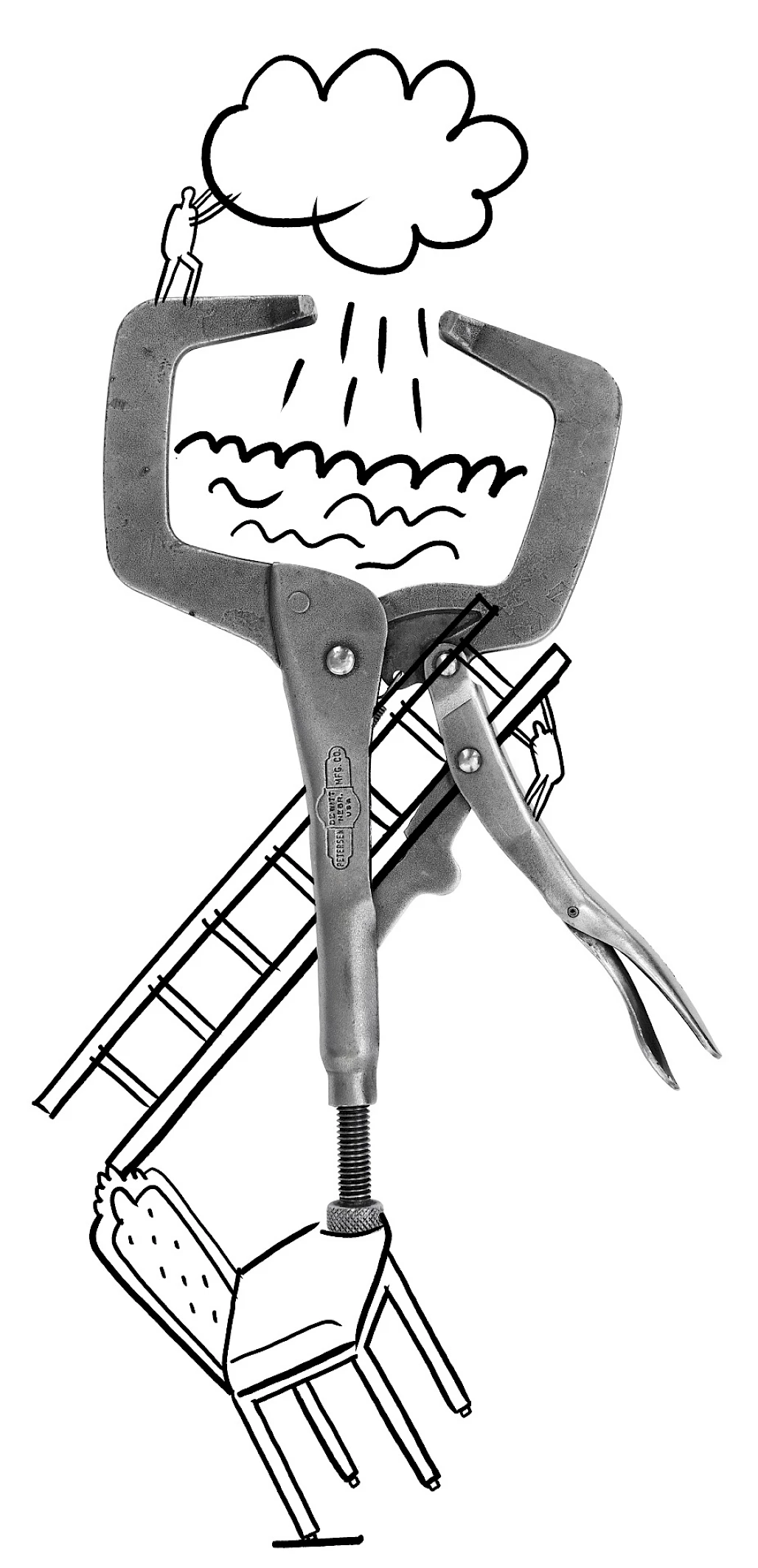
Kluge Köpfe im Kasten
Die meisten Opernproduktionen haben ihn. Bei Konzerten und Balletten gibt es ihn nie. Wissen Sie, wovon die Rede ist? Vom Souffleurkasten. Es ist an der Zeit, ihm eine eigene Kolumne zu widmen.
Warum eigentlich Souffleurkasten? Häufig sitzen bei uns auch Souffleurinnen darin. Ich habe mich deshalb entschieden, in diesem Text ausschliesslich die weibliche Form zu verwenden – es sind aber immer alle Geschlechter gemeint. Von dem Souffleurinnenkasten sehen Sie als aufmerksames Publikum in der Regel nur die Spitze, das ist der sogenannte «Deckel». Dieser Deckel – ob schwarz gemalt in der Götterdämmerung oder golden und in Muschelgestalt bei Platée – dient dazu, den Kopf der Souffleurin vor dem Publikum zu verstecken: Er ist nach oben, zu den Seiten und zum Zuschauerinnenraum geschlossen und zur Bühne offen. Nimmt man ihn weg, schaut man auf den Kopf der Souffleurin, die in einem Loch im Bühnenboden sitzt.
Unter diesem Loch ist der Souffleurinnenkastenunterbau: Diesen kann man sich als einen rollbaren Tennisrichterinnenstuhl vorstellen – also eine sehr steile Treppe mit einem Sitz oben drauf. Dieser Hochstuhl steht unter der Bühne im Orchestergraben, oft zwischen Pauken und Trompeten. Dort ist es meist recht laut, deshalb müssen wir die Souffleurin vor den Instrumenten schützen, aber auch die Musikerinnen im Graben vor den Rufen aus dem Kasten, denn unsere Souffleurin souffliert ununterbrochen. Der Hochstuhl mit der Treppe ist daher rundherum schallschutzverkleidet und schwarz bemalt, damit man ihn im dunklen Graben nicht sieht. Um zum Arbeitsplatz zu kommen, muss die Souffleurin vom Graben kommend eine Türe in der Verkleidung öffnen, hindurchtreten, dann die enge steile Treppe hochklettern und sich beim Erklimmen der letzten Stufe mit einer gekonnten Drehung auf den Sitz hieven. Nun kann sie die Stuhlhöhe noch anpassen, sodass sie mit dem Kopf nicht an den Deckel stösst, aber der Mund für alle Mitwirkenden auf der Bühne sichtbar und damit auch gut hörbar ist.
Wer jetzt schon Platzangst hat, dem sei gesagt, dass die Souffleurin auch noch einen dicken Klavierauszug dabei hat, den sie auf ein von ihr aufgeklapptes, im Bühnenboden verankertes Notenpult legt. Im Bühnenboden eingebaut sind ausserdem noch eine Leselampe und ein Fernsehmonitor, auf dem sie die Dirigentin sehen kann. «Wozu?» könnte man fragen, «sie hört doch die Musik». Trotzdem muss sie die Einsätze der Dirigentin sehen, denn anders als im Schauspiel ist in der Oper keine Zeit für eine Kunstpause und einen hilfesuchenden Blick, um einen Texthänger zu überspielen. Wenn die Note fällig ist, muss auch der Text da sein. Folglich spricht die Souffleurin den Text, der gleich gesungen wird, immer schon vor dem Einsatz so laut, dass die Sängerin ihn hören kann, die erste Reihe im Parkett aber nicht. Wer das jetzt schwierig findet, hat Recht, aber nicht mitbedacht, dass die Souffleurin ALLEN Sängerinnen und Sängern auf der Bühne Text souffliert! Ausserdem muss sie am Opernhaus Zürich noch mehr können, denn sie ist eine Maestra suggeritrice, d.h. sie zeigt mit den Händen wie eine Kapellmeisterin die Einsätze an – und szenisch unsicheren Gästen gerne auch noch den Gang über die Bühne, den sie gleich machen müssen. Der Souffleurkasten ist ein komplexes technisches Bauteil – doch wie so oft kommt die Magie von den Künstlerinnen: Es ist eine unglaubliche Aufgabe, die nahezu unbemerkt von unseren Souffleurinnen und Souffleuren unter dem Deckel vollbracht wird!
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 107, Dezember 2023.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Bühne frei?!
Wir vom Opernhaus Zürich haben Augen und Ohren für all Ihre Anfragen. Also ganz nach unserem Motto «oper für alle» wollen wir Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, gerne entgegen kommen. Es gibt allerdings Wünsche, die sicherlich sehr schön klingen, aber – sind wir mal ehrlich — nicht umsetzbar sind. Und welche das sind, sehen Sie diesmal in: «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten», Episode 15 — Bühne frei?!

Der Fleischkäs'
Es gibt im Grunde nur eine Sache, die Sie wissen sollten. Eine Sache, die den «Fleischkäs» zu einer echten Besonderheit, ja fast schon legendär macht. Und die wäre: er steht neben dem Opernhaus Zürich! Episode 14: Was Sie schon immer über den Fleischkäs wissen wollten, aber nie zu fragen wagten.
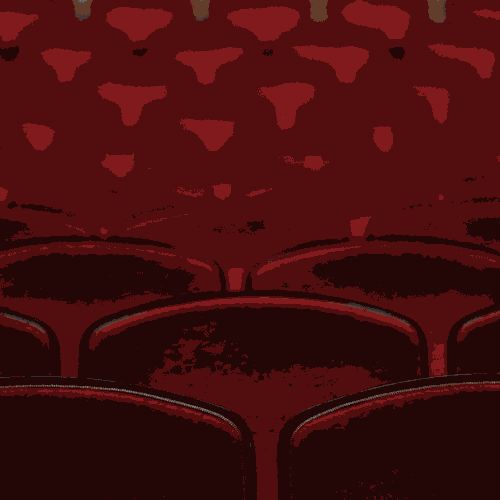
Wie geht nochmal Oper?
Ja, die Oper - es gibt sie noch! Schon lange nicht mehr da gewesen und vergessen, wie es geht? So geht es leider vielen... Wie gut, dass es diesen Film hier gibt, der nochmal zusammenfasst, was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten. Episode 13: Wie geht nochmal Oper?
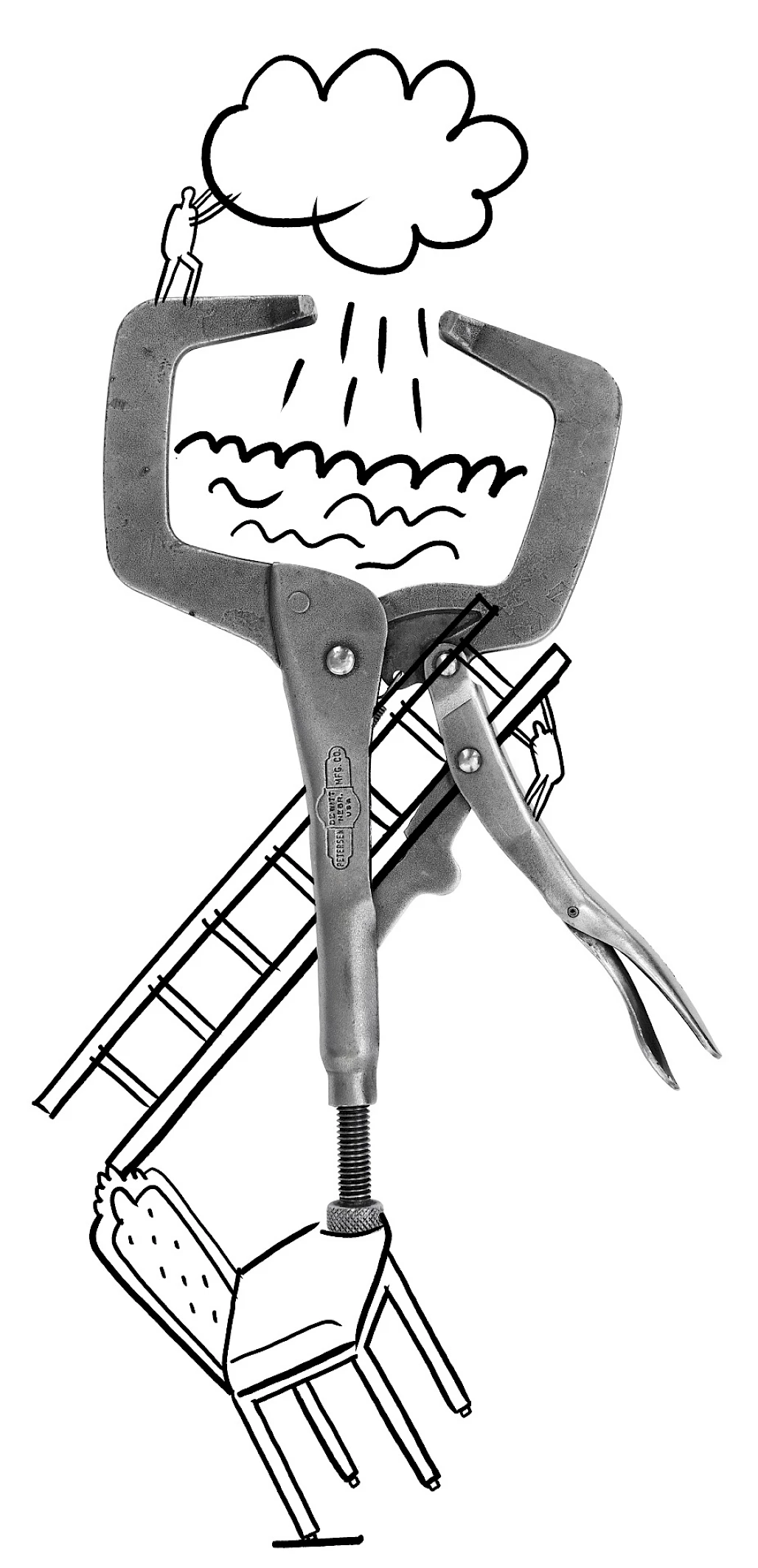
Altes Gemäuer, frisch gemalt
Wahrscheinlich haben Sie sich noch nie mit der Frage auseinandergesetzt, wie Sie etwas Neues möglichst einfach alt aussehen lassen können. Meistens ist es ja eher umgekehrt. Doch gerade unsere Bühnenbilder sollen oftmals nicht so aussehen, als wären sie soeben aus der Werkstatt gekommen, sondern so, als würden ihre Bewohner schon seit vielen Jahren in ihnen leben.
Im Bühnenbild zu Dialogues des Carmélites – ein altes Kloster, entworfen von Ben Baur – wohnen die Nonnen augenscheinlich schon seit Jahrhunderten und unterhalten das Kloster perfekt. Kein Staubkorn liegt herum, dennoch ist das Alter des Gemäuers offensichtlich: Die Wände scheinen im Laufe der Zeit immer wieder feucht geworden zu sein und haben Flecken, und die Farbe von Fenstern und Türen hat Risse. Flecken malen kann vermutlich jeder, aber rissige Farbe malen? Nach einem Besuch bei Christian Hoffmann, unserem Leiter der Theatermalerei, kann ich Ihnen das Rezept verraten, und Sie können damit einfach alles alt aussehen lassen:
Nehmen wir an, Sie wohnen in einem Märchenschloss. Nun zog es durch die Fenster immer fürchterlich, und Sie haben diese neu machen lassen. Von aussen ist der Anblick nun unerträglich: Alte Mauern, die mit verwunschenem Efeu bewachsen sind, in Kombination mit einer neuen Dreifachverglasung in weissen Kunststoffrahmen – das geht natürlich gar nicht! Grundieren Sie die Rahmen mit einer Kunststoffgrundierung aus dem Baumarkt, kaufen Sie auch noch 2K PU Pigmentlack in dunklem Braun (z.B. RAL 8017 Schokoladenbraun), die Farbe Hellelfenbein (RAL 1015) und Reisslack für lösungsmittelhaltige Farben. Dann lackieren Sie den Rahmen in Schokoladenbraun, möglichst unregelmässig – dies wird die Farbe der späteren Risse. Das lassen Sie trocknen. Mindestens 24 Stunden lang. Nun tragen Sie mit dem Pinsel fett das Hellelfenbein auf und lassen dieses nur antrocknen. Beim Testen mit der Fingerkuppe sollte der Lack nicht kleben bleiben. Nach 50 Minuten alle 10 Minuten testen. Wenn Sie lange warten, werden die Risse feiner, wenn Sie zu lange warten gibt es gar keine Risse… Nun tragen Sie auf die angetrocknete Farbe mit dem Pinsel gleichmässig den durchsichtigen Reisslack auf. Während des Trocknens des Reisslackes zieht dieser nach mehreren Stunden die darunterliegende Farbe zusammen und sorgt für grosse Risse im Hellelfenbein und das Schokoladenbraun kommt zum Vorschein. Lassen Sie das in der Nacht durchtrocknen und entfernen Sie dann die Reisslackschicht mit einem feuchten Schwamm. Sie haben ein «Craquelée», ein Rissnetz, erzeugt und Ihr Märchenschloss ist wieder makellos verwunschen.
Für das Kloster auf der Bühne konnten wir übrigens ohne lösungsmittelhaltige Farben arbeiten. Aber ich gehe davon aus, dass Sie nicht möchten, dass die Farbe Ihrer Fensterrahmen im Laufe der Jahre verwittert.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 89, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Der Ton macht die Musik
In unserer neuesten Episode der Kurzfilmreihe «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten», wagen wir die Frage, wie man in Zeiten von Corona Oper mit vollbesetztem Chor und Orchester spielen kann und dabei jederzeit den nötigen Hygieneabstand einhält und was eine hochkomplexe Audio- und Video-Installation im Opernhaus für einen Sinn macht.

Ein Graben voller Musiker
Jeder kennt sie, jeder lacht über sie: Die Musikerwitze. Doch wie viel Wahrheit steckt in diesen «harmlosen» Scherzen? Welche Stereotypen und Klischees verstecken sich wirklich im Orchestergraben? Oder ist der Orchestergraben am Ende tatsächlich ein «Käfig voller Narren»? In Episode 11 nehmen wir den Orchestermusiker genauer unter die Lupe.

Anleitung zur Diva
Mal angenommen, Sie haben eine klasse Stimme, die Sie kurzerhand auf die grosse Bühne bringt – die Opernbühne! Aber eins ist sicher: Den Titel «Diva» müssen Sie sich hart erarbeiten. Die «Anleitung zur Diva» liefern wir in der Episode 10 von «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten».
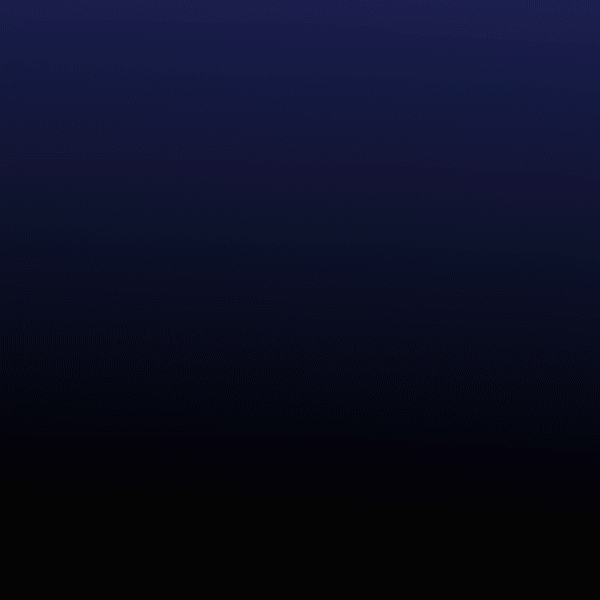
Opernchor
Es lebe das Kollektiv! Haut an Haut, immer in der Gruppe, im Chorsaal, in der Garderobe – und natürlich auf der Bühne. In der Episode 9 von «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» treffen wir auf Mitglieder des Chores der Oper Zürich.
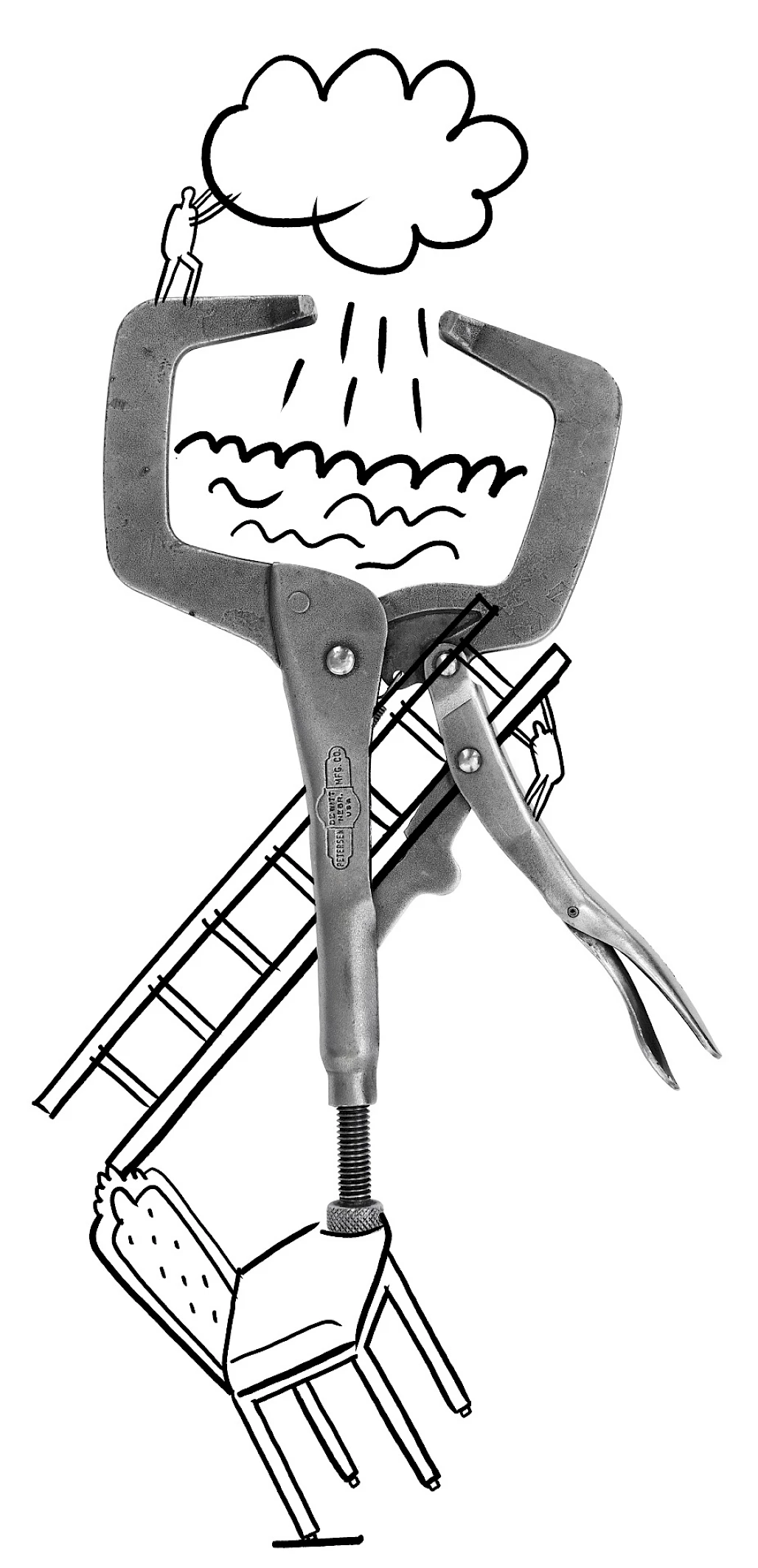
Fliegendes Zimmer
Unsere Inszenierung von «L’italiana in Algeri» ist eine Produktion der Salzburger Festspiele, deren Werkstätten das sehr abwechslungsreiche Bühnenbild von Christian Fenouillat für die Pfingstfestspiele 2018 auf ihre Bühne gestellt haben. In der idealen Welt sollte ich also diese Kolumne gar nicht schreiben, da sich meine Kolumnen ja damit beschäftigen, welche Zaubertricks unsere Zürcher Werkstätten anwenden, um Bühnenbilder auf die Bühne zu stellen. Dass ich dennoch über diese Produktion schreibe, liegt daran, dass wir nicht in einer idealen Welt leben.
Die Entscheidung, diese Inszenierung zu kaufen, wurde erst nach der Premiere getroffen, sodass wir keinen Einfluss mehr auf Bauweise oder Grösse der Dekorationsteile nehmen konnten. Und so kam es, wie es kommen musste: Abgesehen von den vielen Möbeln und Requisiten – darunter auch ein Kamel, ein Auto und ein ferngesteuerter Sessel – passte nichts auf die Bühne. Ausserdem sind die Verwandlungen, die völlig neue Szenenbilder entstehen lassen, auf unserer Bühne nicht in identischer Form möglich.
«Geht nicht: Gibt’s nicht!» ist ja unser Leitspruch, aber wenn in Salzburg für einen Szenenwechsel ein riesiges Haus mit mehreren Stockwerken und Balkonen einfach nach links von der Bühne fährt, während bei uns dafür die Aussenwand zum Nachbargebäude der NZZ aufgebrochen werden müsste, um ausreichend Platz zu schaffen, dann geht’s halt tatsächlich nicht. Bei uns fährt dieses Haus dann zum Teil nach oben und zu anderen Teilen zu beiden Seiten weg. Natürlich erfordert das auch statisch eine völlig andere Bauweise – wir Theatermenschen leben also nicht nur nicht in einer idealen Welt, sondern auch noch in einer ganz anderen Welt als in Salzburg.
Wenn das riesige Haus weggefahren ist, sieht das Publikum in Salzburg ein grosses Zimmer mit hohen Fenstern, Deckenventilatoren und kompletter Einrichtung von hinten nach vorne fahren, bis es an den bereits stehenden Teil des Bühnenbildes sauber anschliesst. In Zürich hätten wir dafür die Bühne nach hinten erweitern müssen, doch dort ist ja die viel befahrene Falkenstrasse. Auch hier haben wir uns entschieden, die Falkenstrasse in Ruhe und das ganze Zimmer von oben einfliegen zu lassen – auch das ist für das Publikum eine sehr spannende Verwandlung.
Ein letztes schönes Beispiel für die unterschiedlichen Welten in Salzburg und Zürich ist ein grosses Kreuzfahrtschiff, das in der Schlussszene in das grade beschriebene Zimmer hineinfährt (!). Das Schiff wurde in Salzburg auf der Bühne zusammengezimmert: Es gab kein Transportmass, das beachtet werden musste, weil das Schiff einfach immer auf der Bühne stand. Von der ersten Probe bis zur letzten Vorstellung. So können gute Werkstätten ein Schiff mit grossen dicken Balken und Brettern recht schnell bauen, mit Sperrholz verkleiden und schön anmalen. Das Zürcher Schiff besteht aus vielen Elementen, die mit dem Lift auf die Bühne gebracht und innerhalb von Minuten aufeinandergestellt und miteinander verbunden werden müssen. Nach jeder Probe und Vorstellung wird es komplett auseinandergebaut und von der Bühne gebracht, um zur nächsten Vorstellung wieder aufgebaut zu werden. Definitiv keine ideale Welt. Trotzdem eine fantastische – vor allem, wenn man sich am Abend die Vorstellung von L’italiana in Algeri mit ihren vielen Verwandlungen ansehen kann.
Sebastian Bogatu ist Technischer Direktor am Opernhaus Zürich.
Dieser Artikel ist erschienen in MAG 90, Februar 2022.
Das MAG können Sie hier abonnieren.

Der Einspringer
Einspringer sind an einem Opernhaus die Retter in höchster Not. Man engagiert sie kurzfristig, weil eine Sängerin oder ein Sänger krank geworden ist. Fieberhaft wird nach ihnen gefahndet, und manchmal werden sie von sehr weit her geholt: Das Opernhaus Zürich hat in der vergangenen Spielzeit eine Gastsängerin aus dem Urlaub auf Guadeloupe einfliegen lassen, weil kurzfristig kein anderer Ersatz zu finden war. Die Einspringer werden vom Publikum zwar mit Dankbarkeit und Nachsicht bedacht, aber Nerven wie Drahtseile brauchen sie trotzdem: Oft kennen sie weder das Haus, noch den Dirigenten und die Inszenierung. Gestern lagen sie noch am Strand, aber jetzt gleich müssen sie singen...
Illustration von Beni Bischof.

Die Aktie
«Es brennt, es brennt! Das Theater brennt!» – «Und ich dachte schon, das gehört zum 2. Akt?!»
Keine Verletzten, alle sind erleichtert. Aber vor allem darüber, dass es brennt. Das Theater, hier in Zürich, 1890. Erleichtert? Wollten die Bürger etwa kein Theater mehr? Oder wollten sie eigentlich schon ein Theater, aber nicht dieses und haben es deshalb angezündet?? Nein, haben sie nicht. Aber sie hatten dafür eine viel bessere, zündende Idee... In Episode 8 gehen wir dem Gründungsmythos der Opernhaus Zürich AG auf den Grund.

Die Damen der Repertoireschneiderei
Sie sind überall und doch nirgendwo. Sie sind Füchsinnen in Samthandschuhen, schnell, clever, intuitiv, feinste Spürnasen und haben einen messerscharfen Blick fürs Detail. Wenn Sie wissen wollen, wer den absoluten Röntgenblick hat, um durch jede Kleidung zu sehen, warum Alkohol die Lösung vieler Probleme ist, und diese Damen sowieso den besten Stoff haben, erfahren Sie dies in Episode 7 von «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten».
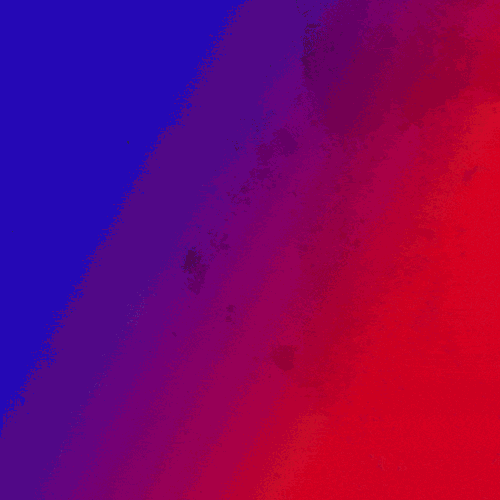
Das Leben eines Spitzenschuhs
«Viele finden mich wunderschön – was soll ich sagen – Sie haben Recht! Würden Sie das auch noch behaupten, wenn Sie wüssten, dass ich generell zerschnitten, gestochen, gequetscht, ja regelrecht verprügelt werde?»
Wahre Schönheit hat ihren Preis – so auch im Leben eines Spitzenschuhs. In Episode 6 von «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» wechseln wir die Perspektive und begleiten den Spitzenschuh von der Wiege bis zum Grabe.

Sessel, Stühle
und andere Sitzgelegenheiten
Unsere roten Samtsessel im Zuschauerraum, exakt 1066 an der Zahl, kennen Sie bestimmt, doch im Opernhaus Zürich gibt es eine ganze Reihe an weiteren Sitzgelegenheiten, die den Tag über gut genutzt werden. Diesen Stühlen und den Menschen, die darauf Platz nehmen, widmet sich unsere fünfte Episode.

Stimme
Ist Sweeney Todd ein Musical? Eine Operette? Oder doch eine Oper? In unserer vierten Episode von «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» klären Bassbariton Bryn Terfel, Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und Dirigent David Charles Abell auf.
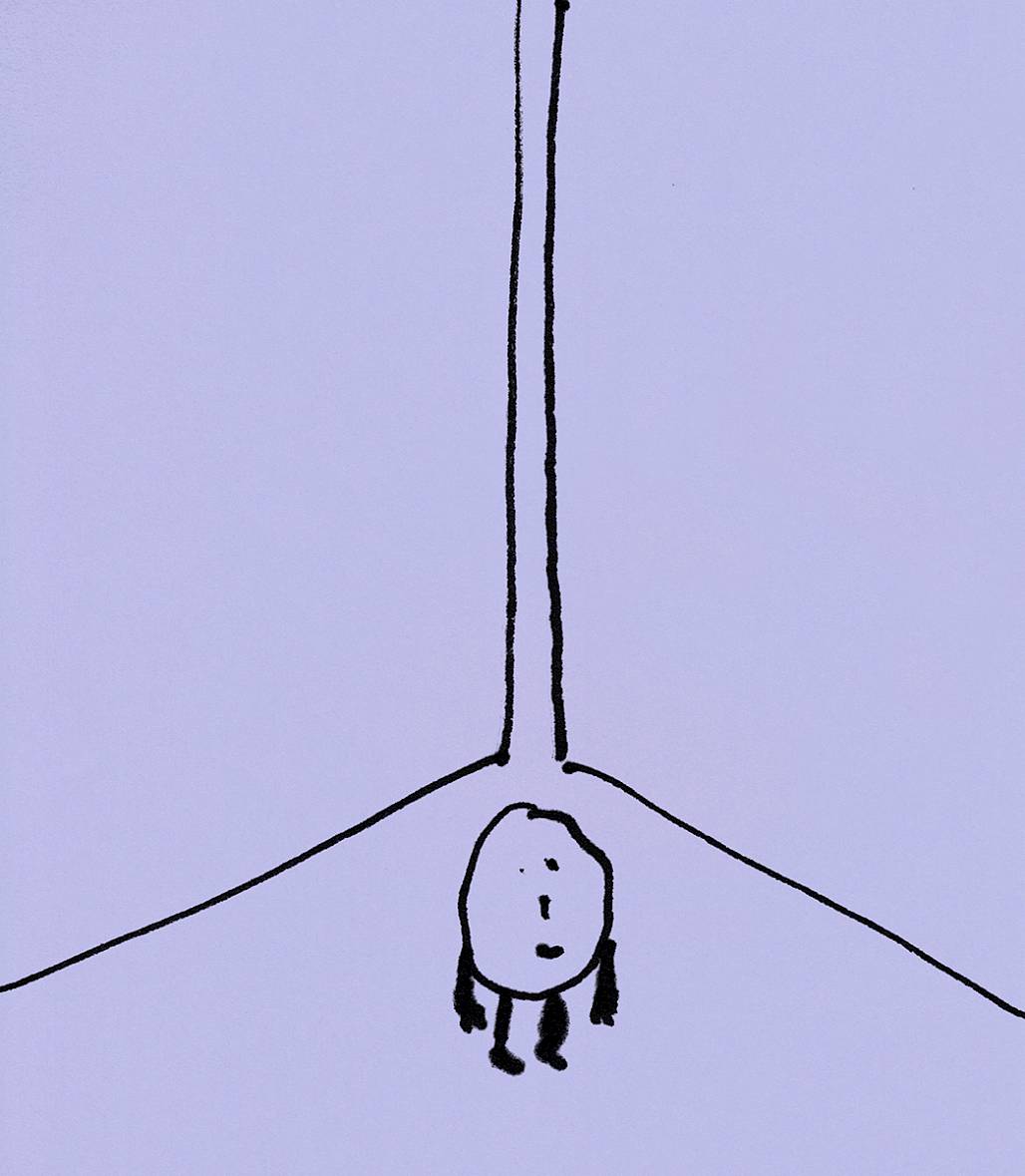
Die Null-Gasse
Im Theater ist der Bühnenraum an den Seiten oft durch gestaffelte Vorhänge und Kulissen begrenzt, zwischen denen sich Gassen auftun, durch die die Darstellerinnen und Darsteller auf- und abtreten können. Die Auftrittsgassen sind von vorne nach hinten durchnummeriert. Deshalb wird die allererste Gasse, die sich unmittelbar hinter dem Bühnenportal befindet, Nullgasse genannt. Die Nummer der Auftrittsgasse steht in keinem Verhältnis zur Bedeutung des Auftretenden. Wer durch die Nullgasse kommt, ist mitnichten eine Null. Nullen haben auf der Theaterbühne sowieso keinen Zutritt.
Illustration von Beni Bischof.

Lampenfieber
Unsere dritte Episode geht dem berühmt-berüchtigten Lampenfieber nach. Dirigentin Speranza Scappucci, Tenor Benjamin Bernheim und Bariton Huw Montague Rendall erzählen von einem ganz besonderen Moment im Leben eines Künstlers: dem Auftritt auf die Bühne.
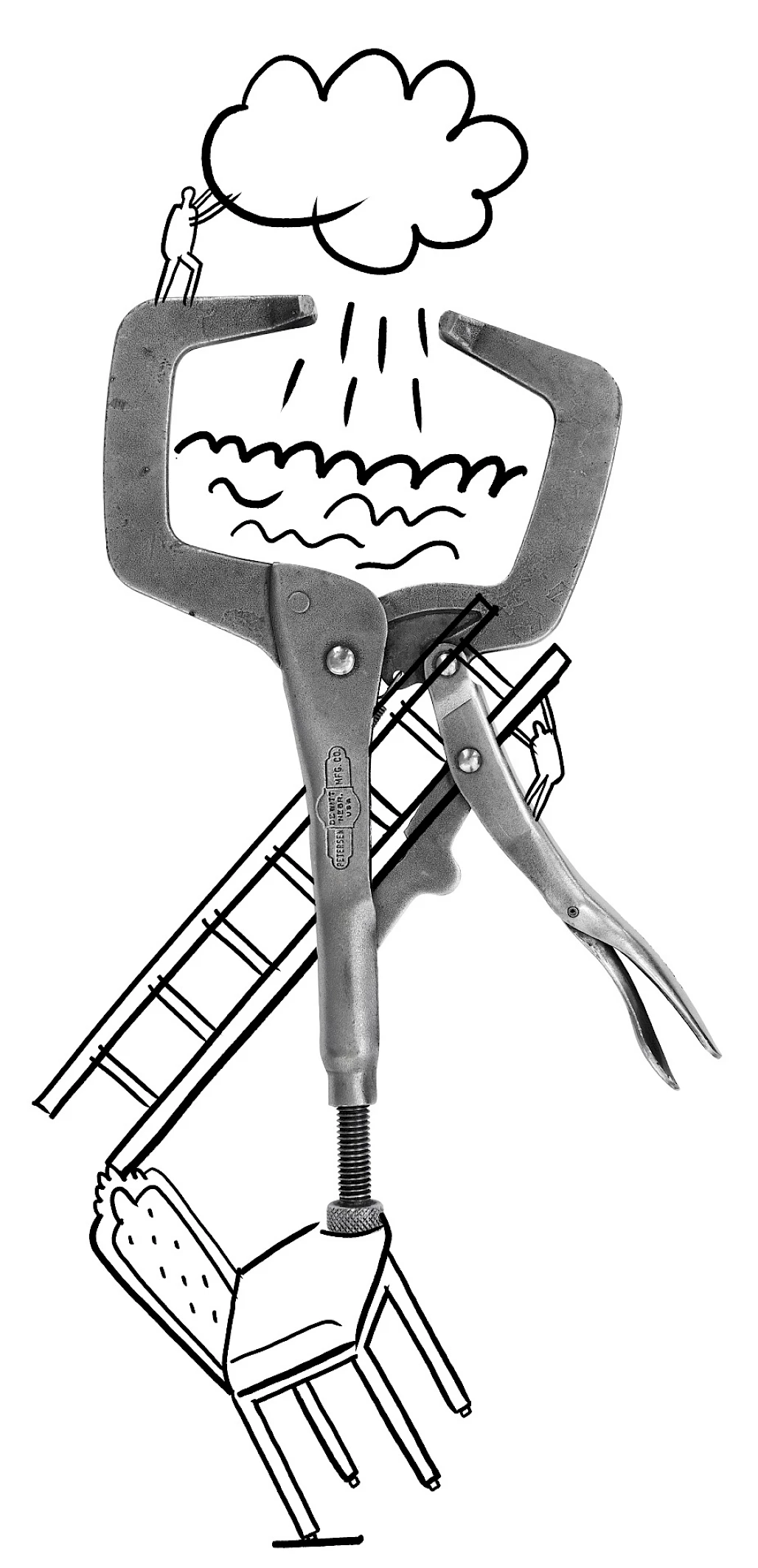
Wenn das Tram entgleist
Zu den spannendsten Momenten einer Opern- oder Ballettproduktion gehört die «Konzeptpräsentation». Um die Spannung nachzuvollziehen, müssten Sie eigentlich die Augen schliessen und sich die folgenden Situationen vorstellen (ich gebe aber zu, dass Lesen mit geschlossenen Augen eher schwierig ist): Stellen Sie sich vor, Sie seien Bühnenbildnerin oder Bühnenbildner und möchten, dass das Opernhaus Zürich ein ZVV-Tram als Bühnenbild für eine Neuproduktion auf die leere Bühne stellt.
Dazu müssten Sie uns Ihre Idee mindestens ein Jahr vor der Premiere zusammen mit den Ideen Ihres Teams, bestehend aus der Regisseurin, der Kostümbildnerin und der Lichtdesignerin, vorstellen (das könnten natürlich auch alles Herren sein – der Lesbarkeit zuliebe lege ich das mal ganz frech so fest). Dieser Termin nennt sich bei uns «Konzeptpräsentation». Und da muss die Regisseurin unseren Intendanten Andreas Homoki davon überzeugen, dass die zu inszenierende Oper in einem Tram spielt und es keinen geeigneteren Ort gibt, an dem die Handlung Fahrt aufnehmen kann. Ausserdem müssten Sie ihn überzeugen, dass das Züri-Tram die Beste aller möglichen Strassenbahnen ist. Gäbe es einen geeigneteren Ort oder ein überzeugenderes Fahrzeug, landete das Tram ganz schnell auf dem Abstellgleis.
Von Ihrer Präsentation hängt es also ab, ob das Konzept Anklang findet oder nicht. Deswegen haben Sie sich ganz viel Mühe gegeben und aus Papier, Pappe, Leim und Farbe ein kleines Modelltram gebastelt. Stellen Sie sich vor, dass Ihre Regisseurin die Idee präsentiert hat und der Intendant das richtig gut findet und anfängt, Sie zu den wundervollen Details am Modell zu befragen. Sie sind gerade dabei, ihm zu erklären, dass das Tram im grossen Finale auseinanderbricht, während die Hauptdarsteller aufeinander schiessend vom brennenden Dach in ein Wasserbecken springen, was wiederum auf einer grossen Videowand im Zuschauerraum live gezeigt wird, als vom bisher schweigsamen technischen Direktor ein schüchternes «das wird schwierig» ertönt. Er erklärt, dass das Tram viel zu gross, das Video viel zu teuer, Feuer viel zu gefährlich, Wasser zu kalt, Schüsse zu laut und eine Videowand im Zuschauerraum zu schwierig aufzuhängen sei.
Sie antworten, dass Sie ja auf die Videowand verzichten und das Tram ohne zusätzliche Dekoration auf die leere Bühne stellen könnten, und erhalten als Antwort, dass eine leere Bühne sowieso nicht geht, da auf der Hinterbühne immer noch Dekorationen von anderen Inszenierungen stehen. Sie geben nicht auf und sagen, dass Sie extra das Tram auseinanderbrechen lassen, damit man die kleineren Einzelteile schnell von der Bühne bekommt. Da erfahren Sie, dass Ihr Tram sowieso aus unzähligen Elementen zusammengebaut werden müsste und dementsprechend überall Teilungen sichtbar wären. Von den Schüssen und dem Wasser ganz zu schweigen. Kurz und knapp: Das Konzept ist entgleist, Ihr Team geschockt, die Stimmung im Keller.
Sie können sich nun sicher vorstellen, wie «spannend» diese Präsentationen sind, denn die beschriebene, rein fiktive Situation wäre nicht nur ein Albtraum für jedes Team, sondern auch für mich, denn wir haben den Ehrgeiz, Konzepte zu ermöglichen, und nicht, sie zu verhindern. Damit wir das können, legen wir allen Teams ans Herz, schon bei den ersten Ideen vor dem Bau eines Modells mal mit uns zu sprechen, damit nur die technisch auch umsetzbaren Konzepte weiterverfolgt werden. Das machen leider nicht alle. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieser Kolumne steht wieder eine Präsentation des Unbekannten vor der Tür und bereitet mir offensichtlich Sorge.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 67, März 2019.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
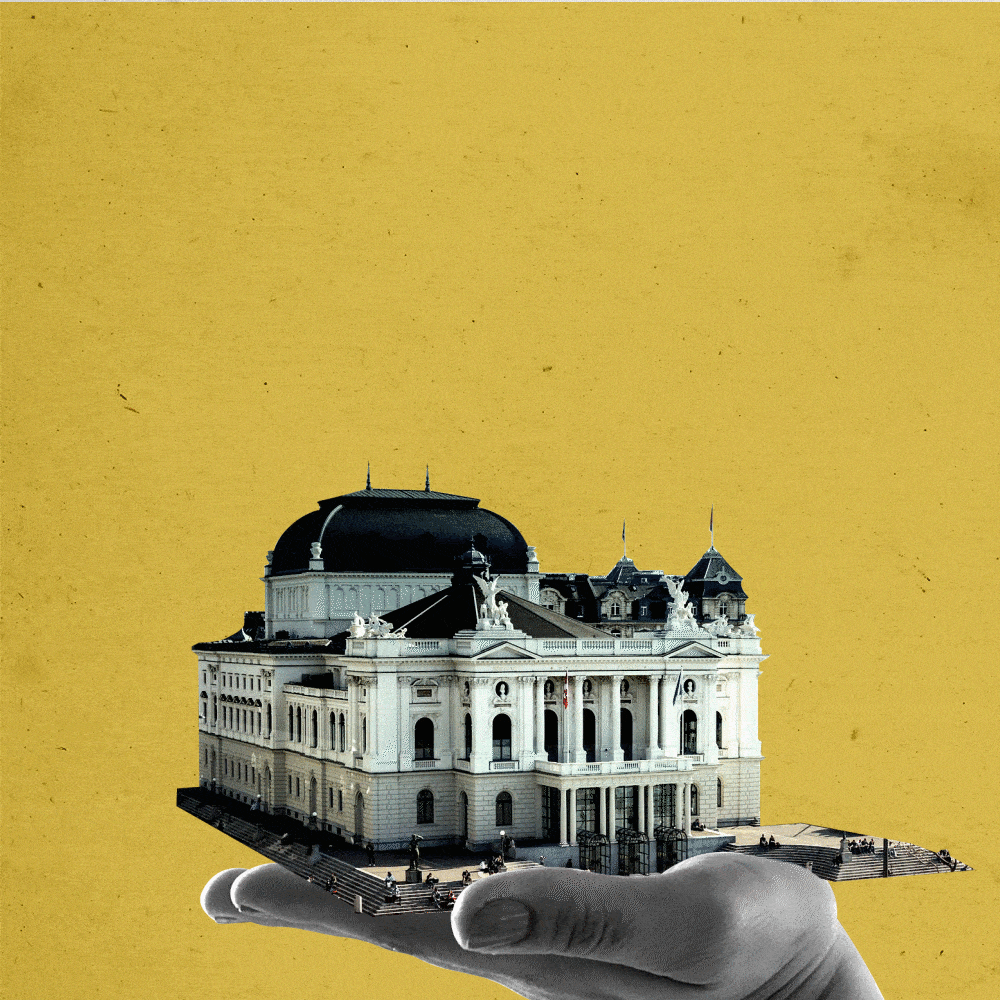
Kulisse
Haben Sie sich auch schon mal gefragt, weshalb wir «Werbeplakate» durch ganz Zürich transportieren? Dieser Film verrät, weshalb die roten Kulissenwagen so wichtig sind, damit das Opernhaus Zürich auch weiterhin in der Champions League der grossen Opernhäuser ganz vorne mitspielen kann!

Theaterzauber
Das Opernhaus Zürich ist eine «Schatztruhe voller Überraschungen», die zum Staunen verleitet – in der ersten Episode unserer Filmreihe widmen wir uns den magischen Erscheinungen auf und hinter der Bühne.

Das hohe C
Vom berühmten hohen C haben sogar diejenigen schon einmal gehört, die von Operngesang so viel Ahnung haben wie Luciano Pavarotti von Diätpillen. Es ist die magische Marke für alle Tenöre: Wer mit seiner Stimme effektvoll hinaufkommt bis zum zweigestrichenen C, kann sich der Bewunderung des Publikums sicher sein. Aber am Ende ist das hohe C auch nur ein einsamer schwarzer Punkt in einer von schwarzen Punkten wimmelnden Opern-Partitur. Auf ein sportives «schneller, höher, weiter» kommt es in der Musik nämlich nicht an. Vor allem schön und musikalisch soll ein Tenor singen. Hoch natürlich auch.
Illustration von Beni Bischof.
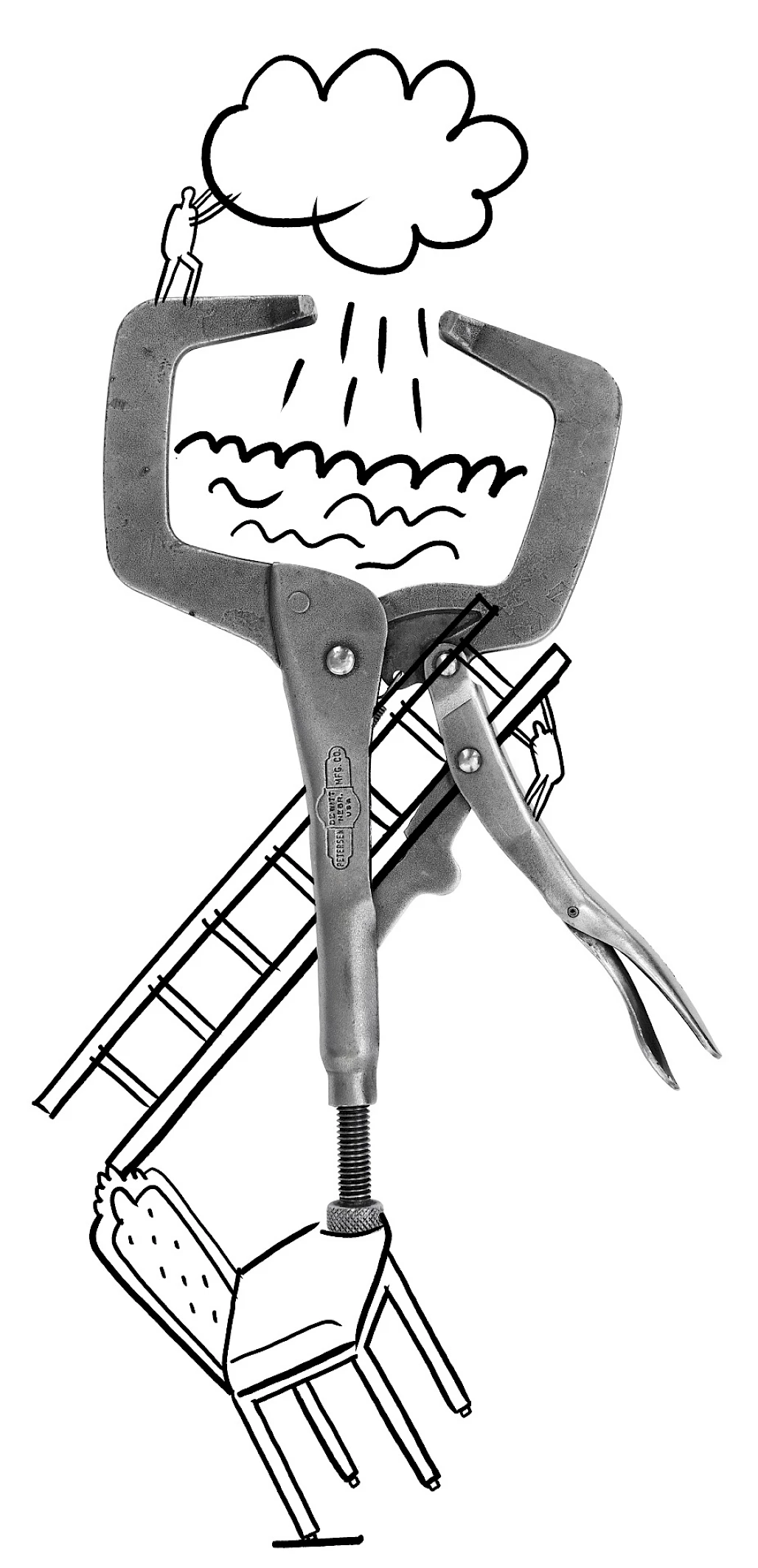
Besser aussehen mit Glatze
Unser Don Pasquale hat eine wunderschöne Glatze. Der Bariton Johannes Martin Kränzle sieht in den Vorstellungen so gut darin aus, dass sich bestimmt alle Herren im Publikum insgeheim auch so eine Glatze wünschen. Deshalb verrate ich hier das Rezept unseres Leiters der Maskenbildnerei, Wolfgang Witt.
Sie brauchen Folgendes: 1 offenes Fenster, 1 Porzellankopf, 1 Topf «Glatzan», 1 Töpfchen Glatzentrennpuder, 2 kleine Töpfchen Wasserschminke blau und rot, 2 Naturschwämme, 1 Puderquaste, 1 Glatzenauftragspinsel, 1 Tube Mastix, ausserdem Schminke und etwas Alkohol. Vorbereitungszeit: ca. 16 Stunden. Montagezeit: 30 Minuten (wenn Wolfgang Witt die Glatze macht); bis zu 3 Stunden (wenn ich sie machen müsste).
Sie stellen den Porzellankopf ans offene Fenster (Glatzan enthält Lösungsmittel) und tragen mit dem Glatzenauftragspinsel eine Schicht Glatzan auf den Porzellankopf auf. Dabei müssen Sie natürlich beachten, dass Sie die Glatze nicht über den Ohren und im Gesicht haben möchten – diesen Bereich sollten Sie frei lassen. Dann lassen Sie das Glatzan trocknen. Sie tupfen nun mit dem Schwamm die blaue Farbe unregelmässig auf das Glatzan auf und lassen diese trocknen. Bitte einmal mit der Puderquaste abpudern, bevor Sie die nächste Lage Glatzan auftragen. Nach dem Trocknen verfahren Sie mit der roten Farbe genau gleich, lassen diese trocknen und pudern wieder ab. Nun folgen zwei weitere Schichten Glatzan – wobei Sie nun an den Rändern nur noch sehr wenig Glatzan auftragen, damit es später zwischen Ihrer Haut und der Glatze keine Kante gibt. Je nach Hauttyp können Sie auch mit Schminke den Farbton der Glatze noch stärker Ihrer Haut anpassen. Nachdem die Schichten (am Besten über Nacht) komplett getrocknet sind, pudern Sie diese sorgfältig ab und lösen die Glatze vorsichtig vom Porzellankopf. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollte die Konsistenz ungefähr die einer Badekappe sein, und durch die Farbschichten sieht sie bereits wie Ihre Haut aus. Bevor Sie sich die Glatze aufsetzen, sollten Sie Ihre eigenen Haare (soweit vorhanden) möglichst gleichmässig auf dem Hinterkopf verteilen und feststecken – sonst haben Sie später eine recht unförmige Glatze. Nun ziehen Sie sich die Glatze wie eine Badekappe über. Die Glatze sollte über Ihren Haaransatz hinweggehen, damit Ihr Haar komplett abgedeckt ist. Nun kleben Sie einfach mit einem in Mastix getauchten feinen Pinsel die Glatzenränder rundum an Ihrer Haut fest und kaschieren den Ansatz nach Bedarf noch mit Schminke. Der grosse Vorteil einer Glatze ist natürlich, dass sie sich nicht ständig die Haare waschen und frisieren müssen – lediglich die Ränder der Glatze müssen Sie ab und zu wieder mit Mastix ankleben. Der Nachteil: Man schwitzt darunter.
Sollten Sie kein Fenster haben oder die Herstellung misslingen, können Sie eine Glatze auch direkt im Internet für 20 Franken bestellen. Natürlich nicht so kunstvoll eingefärbt und auf Ihren Hauttyp angepasst. Kleben müssen Sie diese natürlich auch.
Den Alkohol brauchen Sie übrigens, wenn Sie die Glatze ohne Schmerzen wieder ablegen möchten – der Mastixkleber lässt sich damit sehr gut entfernen. Die Glatze können Sie natürlich beliebig wiederverwenden oder auch verleihen.
Text von Sebastian Bogatu.
Illustration von Anita Allemann.
Dieser Artikel ist erschienen im MAG 75, Januar 2020.
Das MAG können Sie hier abonnieren.
... aber nie zu fragen wagten
In unserer Kurzfilm-Reihe «Was Sie schon immer über das Opernhaus wissen wollten, aber nie zu fragen wagten» präsentieren wir aktuelle, bewegende und überraschende Geschichten aus unserem Opernhaus-Kosmos.
Unterstützt von